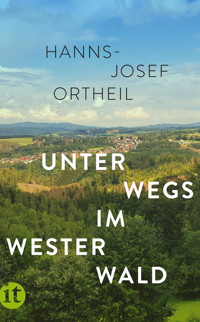SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die Erfindung des Lebens« ist die Geschichte eines jungen Mannes von seinen Kinderjahren bis zu seinen ersten Erfolgen als Schriftsteller. Als einziges Kind seiner Eltern, die im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach vier Söhne verloren haben, wächst er in Köln auf. Die Mutter ist stumm geworden, und auch ihr letzter Sohn lebt stumm an ihrer Seite. Nach Jahren erst kann er sich aus der Umklammerung der Familie lösen, in Rom eine Karriere als Pianist beginnen und nach deren Scheitern versuchen, mit dem Schreiben sein Glück zu machen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,5 (98 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
I – Das stumme Kind
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
II – Lesen und Schreiben
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
III – Die Flucht
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
IV – Roma
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
V – Die Rückkehr
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Copyright
Wir wissen sehr wohl, mit welcher Vertrautheit wir uns durch den Tag bewegen, aber nachts bewegt sich der Tag mit der gleichen Vertrautheit durch uns …
(Inger Christensen)
I
Das stumme Kind
1
DAMALS, IN meinen frühen Kindertagen, saß ich am Nachmittag oft mit hoch gezogenen Knien auf dem Fensterbrett, den Kopf dicht an die Scheibe gelehnt, und schaute hinunter auf den großen, ovalen Platz vor unserem Kölner Wohnhaus. Ein Vogelschwarm kreiste weit oben in gleichmäßigen Runden, senkte sich langsam und stieg dann wieder ins letzte, verblassende Licht. Unten auf dem Platz spielten noch einige Kinder, müde geworden und lustlos. Ich wartete auf Vater, der bald kommen würde, ich wusste genau, wo er auftauchte, denn er erschien meist in einer schmalen Straßenöffnung zwischen den hohen Häusern schräg gegenüber, in einem langen Mantel, die Aktentasche unter dem Arm.
Jedes Mal sah er gleich hinauf zu meinem Fenster, und wenn er mich erkannte, blieb er einen Moment stehen und winkte. Mit hoch erhobener Hand winkte er mir zu, und jedes Mal winkte ich zurück und sprang wenig später vom Fensterbrett hinab auf den Boden. Dann behielt ich ihn fest im Blick, wie er den ovalen Platz überquerte und sich dem Haus näherte, er schaute immer wieder zu mir hinauf, und jedes Mal ging beim Hinaufschauen ein Lachen durch sein Gesicht.
Wenn er nur noch wenige Meter von unserem Haus entfernt war, eilte ich zur Wohnungstür und wartete darauf, dass sich die schwere Haustür öffnete. Ich blieb im Flur stehen, bis Vater oben bei mir angekommen war, meist packte er mich sofort mit beiden Armen, hob mich hoch und drückte mich fest. Für einen Moment flüchtete ich mich in seinen schweren Mantel, schloss die Augen und machte mich klein, dann gingen wir zusammen in die Wohnung, wo Vater den Mantel auszog und die Tasche ablegte, um nach Mutter zu schauen.
Das Erste, was er in der Wohnung tat, war jedes Mal, nach Mutter zu schauen. Wo war sie? Ging es ihr gut? Sie saß meist im Wohnzimmer, in der Nähe des Fensters, heute kommt es mir beinahe so vor, als habe sie in all meinen ersten Kinderjahren ununterbrochen dort gesessen. Kaum ein anderes Bild habe ich aus dieser Zeit so genau in Erinnerung wie dieses: Mutter hat den schweren Sessel schräg vor das Fenster gerückt und die helle Gardine beiseite geschoben. Neben dem Sessel steht ein rundes, samtbezogenes Tischchen, darauf eine Kanne mit Tee und eine winzige Tasse, Mutter liest.
Oft liest sie lange Zeit, ohne sich einmal zu rühren, und oft schleiche ich mich in diesen stillen Leseraum, ohne dass sie mich bemerkt. Ich kauere mich leise irgendwohin, gegen eine Wand oder vor das große Bücherregal, ich warte. Irgendwann wird sie etwas Tee trinken und von ihrer Lektüre aufschauen, das ist der Moment, in dem sie auf mich aufmerksam wird. Sie schaut etwas erstaunt, ich schaue zurück, ich versuche, herauszubekommen, ob ich mich zu ihr ans Fenster setzen darf … Manchmal ging es ihr damals nicht gut, ich spürte es bereits am frühen Morgen, weil sie alles in einer anderen Reihenfolge als sonst tat und sich zwischendurch häufig ausruhte. Dann hatte ich sie den ganzen Tag, vom frühen Morgen bis in die Nacht, im Blick. Meist aber beobachteten wir beide zugleich, was der andere jeweils gerade tat, denn wir beide, Mutter und ich, gehörten damals so eng zusammen wie sonst kaum zwei andere Menschen. Das jedenfalls glaubte ich fest, ja, ich weiß noch genau, dass ich manchmal sogar glaubte, nichts könnte uns beide je trennen, niemand, nichts auf der Welt.
Am frühen Abend aber kam Vater, und Vater gehörte noch hinzu zu uns beiden. Er war der Dritte im Bunde, er verließ die gemeinsame Wohnung am frühen Morgen und war oft den ganzen Tag lang in der freien Natur unterwegs. Vater arbeitete als Vermessungsingenieur für die Bahn, und wenn er am Abend nach Hause kam, schaute er zuerst, wie es um uns beide so stand. Nach dem Ablegen von Mantel und Tasche ging er hinüber zu Mutter, er beugte sich etwas zu ihr herunter und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Einen kleinen Moment hielt sie sich an ihm fest, und es sah so aus, als klammerten sich die beiden eng aneinander. Doch spätestens, wenn Vater zu sprechen begann, lösten sie sich wieder aus der kurzen Umklammerung und waren danach ein wenig verlegen, weil sie nicht wussten, wie es nun weitergehen sollte.
Meist stellte Vater dann einige kurze Fragen, wie geht es Dir, ist alles in Ordnung, was gibt es Neues, und Mutter reagierte darauf wie immer stumm, indem sie ihm den kleinen Packen mit Zetteln zuschob, die sie während des Tages beschrieben hatte. Die Zettel lagen neben der Kanne mit Tee auf dem runden Tisch, sie wurden durch ein rotes Gummi zusammengehalten und sahen aus wie ein kleines, fest geschnürtes Paket, das Vater zu öffnen hatte. Er steckte es zunächst aber nur in die rechte Hosentasche und ging dann, die Hand ebenfalls in der Tasche, ins Bad.
Die Tür des Badezimmers ließ er offen, so dass ich zusehen konnte, wie er zum Waschbecken ging, den Wasserhahn aufdrehte, etwas Wasser in die hohle Hand laufen ließ und zu trinken begann. Wenn er genug getrunken hatte, fuhr er sich mit beiden Händen mehrmals durchs Gesicht, manchmal schöpfte er auch noch ein zweites Mal Wasser, ließ es sich über den Kopf laufen, griff nach einem Handtuch und blickte kurz in den Spiegel. Meist schaute er sehr ernst in den Spiegel, viel ernster, als er sonst schaute, dann fuhr er sich mit dem Handtuch über die Stirn und trocknete sich die Haare.
Nach Verlassen des Bades kam er gleich in die Küche und sah nach, ob es dort etwas zu erledigen gab, er musterte den großen Tisch, auf dem oft eine Zeitung oder die Post lagen, beides rührte Mutter niemals an, ich habe sie ausschließlich Bücher lesen sehen, nichts sonst, keine Zeitung, auch sonst nichts Gedrucktes, höchstens einmal einen Brief, aber auch den nur, wenn sie wusste, wer ihn geschrieben hatte. Überhaupt hatte sie gegenüber allem, was sie in die Hand nehmen sollte, eine starke Berührungsangst. Als Kind hielt ich diese Vorsicht für etwas Normales und übernahm instinktiv etwas davon, wie Mutter blieb auch ich zu allem Neuen zunächst auf Distanz, ich umkreiste es, betrachtete es länger und genauer als üblich und brauchte meist erst ein Motiv oder etwas Überwindung, um mich bestimmten Gegenständen oder Menschen zu nähern.
Wenn Vater da war, war jedoch alles viel einfacher, ich war dann erleichtert, weil ich dann nicht mehr allein auf Mutter aufpassen musste. Immerzu befürchteten Vater und ich nämlich, es könnte ihr etwas zustoßen, obwohl ich selbst noch gar nicht erlebt hatte, dass ihr in meinem Beisein etwas Schlimmes zugestoßen war. Ich wusste aber, dass so etwas früher einmal passiert war, und ich wusste auch, dass es etwas ganz besonders Schlimmes gewesen sein musste. Mehr jedoch wusste ich noch nicht, ich kannte keine Details, und ich hörte auch niemals jemanden von dieser Vergangenheit sprechen, obwohl sie doch ununterbrochen gegenwärtig war. Gegenwärtig war sie dadurch, dass Mutter nicht sprach, gegenwärtig war die Vergangenheit in Mutters Stummsein.
Damals dachte ich mir, dass sie die Sprache irgendwann einmal verloren haben musste, wusste aber nicht, wann und wodurch das geschehen war. Eine Mutter, die immer sprachlos gewesen war, konnte ich mir jedoch nicht vorstellen, nein, so weit gingen meine Vermutungen nicht, schließlich erlebte ich ja jeden Tag, dass sie lesen und schreiben konnte, und folgerte daraus, sie habe neben Lesen und Schreiben auch einmal das Sprechen beherrscht.
Natürlich wäre es am einfachsten gewesen, jemanden danach zu fragen, das aber war nicht möglich, weil auch ich selbst kein Wort sprach, sondern stumm war wie meine Mutter. Mutter und ich – wir bildeten damals ein vollkommen stummes Paar, das so fest zusammenhielt, wie es nur ging. Ich hatte, wie schon gesagt, Mutter im Blick und sie wiederum mich, wir achteten genau aufeinander. Meist ahnte ich sogar, was sie als Nächstes tat, vor allem aber wusste ich oft, wie sie sich fühlte, ich spürte es sehr genau und direkt und manchmal war diese direkte Empfindung sogar so stark, dass ich ganz ähnlich fühlte wie sie.
Wenn Vater nach Hause kam, war sie zum Beispiel meist unruhig, sie stand nach der Begrüßung und nachdem Vater Wasser getrunken und den Kopf unter das Wasser gehalten hatte, auf, legte die Bücher beiseite und schaute nach, ob Vater sich nun auch der Zettel annahm, die sie während des Tages beschrieben hatte. Vater, Mutter und ich, die ganze Kleinfamilie Catt befand sich wenige Minuten nach Vaters Rückkehr zusammen in der Küche, wo Vater mit der Lektüre der Zettel und dem lauten Vorlesen all dessen begann, was Mutter vom frühen Morgen an aufgeschrieben und notiert hatte.
Dieses Zusammensitzen war ein Familienritual, wie alles, was ich gerade beschrieben und wovon ich erzählt habe, ein Ritual war: Mutters Lesen, mein Warten auf Vaters Heimkehr, sein Aufenthalt im Badezimmer und danach in der Küche. Wenn ich mich zurückerinnere, sehe ich dieses Ritual von Vaters Heimkehr in immer derselben Reihenfolge ablaufen, als hätte es eine geheime Vorschrift oder sogar ein Gesetz gegeben, dass alles genau so und nicht anders abzulaufen hatte. Wie Darsteller in einem Stück waren wir drei aufeinander bezogen, beinahe jeden Tag handelten wir in derselben Weise, und niemand von uns störte sich an dieser Wiederholung, sondern tat im Gegenteil alles dafür, dass alles so blieb.
Heute weiß ich, dass uns die Wiederholung beruhigte und dass sie unser merkwürdiges und gewiss nicht einfaches Leben ordnete. Jeder hatte seine Rolle und hielt sich genau daran, das gab uns eine kurzfristige Sicherheit und band uns eng aneinander. Wir drei waren sogar so eng miteinander verbunden, dass jeder von uns sofort in Panik geriet, wenn unsere Rituale durch irgendeine Kleinigkeit durcheinandergerieten. Meist kamen sie durch Einwirkungen von außen durcheinander, und meist taten wir dann beinahe zwanghaft und hektisch alles, um Störenfriede zu vertreiben oder auf andere Weise aus unserem Kreis zu verdrängen.
So war die Welt der Kleinfamilie Catt damals, in den frühen fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auf eine beinahe unheimliche Weise geschlossen, und jeder von uns wachte mit all seinen Sinnen darüber, dass sich daran nichts änderte.
2
ALLE ZETTEL, die Vater in der Küche vorlas, waren gleich, gleich groß und gleichfarbig, sie hatten rundherum einen grünen Rand, und sie wurden von Notizblöcken abgerissen, von denen Vater alle paar Wochen einen kleinen Stapel in dem nahe gelegenen Schreibwaren- und Buchladen kaufte.
Mutter beschrieb jeden Zettel sehr ordentlich, niemals verrutschten die Zeilen, und nur selten war etwas durchgestrichen oder verbessert, Mutter schrieb schön. Klar und deutlich waren die etwas verschnörkelten Buchstaben zu erkennen, ich konnte sie zwar noch nicht lesen, dafür war ich mit meinen fünf Jahren noch viel zu jung, aber ich betrachtete sie oft, weil die gleichmäßigen und geordneten Schriftzüge den beruhigenden Eindruck erweckten, Mutter wisse ganz genau, was sie schreiben und sagen wolle. Kurz bevor Vater mit der lauten Lektüre begann, befiel mich oft ein leichtes Kribbeln und ein Gefühl von Spannung, ja, ich war sehr gespannt darauf, was ich nun endlich an diesem Höhepunkt eines jeden Tages zu hören bekam. Als wolle er die Feierlichkeit des Moments unterstreichen, machte Vater überall Licht, räumte den großen Tisch frei und pulte das Gummiband von den Zetteln herunter.
Sie waren nach der Reihenfolge ihres Entstehens geordnet, denn Mutter sammelte sie während eines Tages und schichtete sie dann aufeinander, nur ganz selten blieb einer der vielen Zettel aus Versehen irgendwo liegen und wurde dann später gefunden, Mutter mochte das nicht, sie wollte unbedingt, dass die Zettel am Nachmittag, wenn Vater aus seinem Büro oder von der Arbeit im Freien zurückkam, alle beisammen waren. Wenn er sie zur Hand nahm, setzte sie sich dicht neben ihn, während ich mich auf das schmale Ecksofa legte und zuhörte.
Den Text der meisten Zettel las Vater laut vor, einige wenige andere aber las er auch im Stillen und legte sie dann beiseite, ich verstand lange Zeit nicht, warum er das tat. Manchmal vermutete ich, dass auf einigen etwas stand, das nur für ihn bestimmt war und nicht für mich, aber ich konnte es nicht beweisen, und fragen konnte ich Vater ja auch nicht.
Die nicht vorgelesenen und beiseite gelegten Zettel beunruhigten mich jedenfalls sehr, manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie geheime, wichtige Botschaften enthielten, am schlimmsten aber war es, wenn Vater mich nach der stummen Lektüre eines solchen Zettels kurz anschaute, denn dann wusste ich, dass Mutter auf dem fraglichen Zettel etwas notiert hatte, das mich betraf.
Deshalb sehnte ich mich damals nach kaum etwas so sehr wie danach, die nicht laut vorgelesenen Zettel einmal lesen zu können, ich wusste aber nicht, ob das jemals möglich sein würde, denn nachdem Vater die Zettel vorgelesen hatte, nahm er sie an sich, er steckte sie wieder in seine Hosentasche oder ließ sie in das vordere Fach seiner braunen Aktentasche gleiten und damit waren sie dann ein- für allemal verschwunden, scheinbar endgültig, wie weggezaubert.
Ich wusste nicht, ob Vater die Zettel irgendwo aufbewahrte oder ob er sie nach der Lektüre einfach wegwarf oder verbrannte, ich hatte nicht die geringste Ahnung, sondern konnte nur feststellen, dass die einmal vorgelesenen Zettel nirgends mehr auftauchten. Meist beruhigte ich mich mit der Vermutung, dass Vater sie vernichtete, denn auf den meisten war ja nur notiert, was er als Nächstes zu tun oder welche Sachen er noch zu besorgen habe, bestimmte Einkäufe standen an und waren dringend zu erledigen, es waren Einkäufe in jenen Läden rings um den großen, ovalen Platz, die von Mutter aus irgendwelchen Gründen niemals betreten wurden. In solche Läden ging Vater, nachdem er am späten Nachmittag von der Arbeit nach Hause zurückgekehrt war, immer allein, während ich Mutter, wenn sie alle paar Vormittage ihre eigenen Einkaufsrunden drehte, auf ihren Wegen begleiten durfte.
Ich lief meist dicht neben ihr her, oder ich hielt sogar ihre Hand, und dann betraten wir gemeinsam einen Laden, wo Mutter eine kleine Liste abgab, auf der all die Waren notiert waren, die für sie zusammengestellt werden sollten und die wir dann später abholen würden. Nach der Abgabe der Liste gingen wir, so schnell es ging, wieder hinaus und eilten dann weiter in das nächste Geschäft, um dort erneut eine Liste mit Bestellungen abzugeben, das alles geschah unglaublich rasch, weil Mutter sich niemals lange in den Läden aufhalten und anreden lassen wollte.
Natürlich war es vergebens, sie anzureden oder sie etwas zu fragen, denn Mutter war ja stumm und konnte nicht antworten, alle Verkäuferinnen wussten das, in jedem Laden, den wir gemeinsam betraten, war es bekannt, und doch wurde Mutter immer wieder etwas gefragt und auch direkt angeredet, meist reagierte sie nicht darauf oder schüttelte nur kurz den Kopf, um dann schnell zu bezahlen und sich mit mir aus dem Staub zu machen.
Für mich waren diese kurzen und hastigen Auftritte in all diesen Läden sehr unangenehm, am liebsten hätte ich draußen, vor der Tür, auf Mutter gewartet und mir die Wartezeit mit Spielen vertrieben. Das aber kam überhaupt nicht in Frage, Mutter hätte mich niemals draußen, vor einem Geschäft, allein zurückgelassen, immer musste ich in unmittelbarer Reichweite zur Stelle sein, so dass wir überall, wo wir hinkamen, wirklich den Eindruck eines fest aneinandergeketteten Paars machten.
Manchmal glaubte ich zu bemerken, dass man dieses Paar bemitleidete oder sogar belächelte, mit uns stimmte ja so einiges nicht, wir waren nicht nur beide stumm, sondern anscheinend auch aufeinander angewiesen, keiner von uns beiden verließ das Haus ohne den anderen und die ganzen Einkaufswege über hielten wir uns an der Hand oder gingen so dicht nebeneinander her, als wäre der eine der Schatten des anderen.
Niemals hätte ich es denn auch fertiggebracht, einfach einmal ein paar Schritte oder Sprünge zur Seite zu machen, so einen Übermut kannte ich nicht, man hätte mich deshalb für übertrieben gehorsam oder brav halten können, ich selbst hielt mich aber nicht dafür, sondern einfach nur für ein Kind, das sehr anders war als die anderen Kinder. In mir steckte trotz meiner fünf Jahre noch viel von einem Kleinkind, das weit hinter seinen fünf Jahren zurückgeblieben war und doch gleichzeitig auch schon etwas von einem Erwachsenen hatte, denn meine Rolle an Mutters Seite war eben manchmal auch die Rolle eines Beschützers, der Mutters merkwürdige Verhaltensweisen genau kannte und ihr half, trotz dieser Verhaltensweisen einigermaßen in der Welt zurechtzukommen.
Wenn uns dabei Mitleid oder sogar offener Spott begegneten, empfand ich mich als sehr hilflos, ich konnte darauf ja nicht antworten, hatte aber das Gefühl, unbedingt antworten und manchmal sogar laut schreien zu müssen, ach, wie gern hätte ich mich zur Wehr gesetzt und es all den Spöttern gezeigt, aber ich konnte es nicht, nicht einmal eine Grimasse zog ich, ich reagierte überhaupt nicht, sondern tat, als sähe und hörte ich all die dummen und oft auch beleidigenden Bemerkungen nicht. Abtauchen, sich taub stellen, irgendwo anders hinschauen – das waren meine einzigen Reaktionen, ich nahm mich so sehr zusammen, dass ich die Anstrengung körperlich spürte, nicht das Geringste sollte man mir anmerken. Erst wenn ich Stunden später einmal allein war und unsere Peiniger nicht mehr vor mir hatte, ließ ich meine Wut heraus, heimlich und noch immer viel zu zurückhaltend erlaubte ich mir, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, einen solchen Ausbruch, denn natürlich durfte Mutter nicht mitbekommen, wie sehr mich das alles getroffen und verletzt hatte.
Immer wieder habe ich dann auch in späteren Jahren damit gehadert, dass sich solche Verhaltensmuster wiederholten und nicht verändern ließen, denn auch später tat ich, wenn ich mich von irgendjemandem angegriffen, verhöhnt oder verspottet fühlte, einfach so, als gäbe es den Angreifer nicht. Ich schaute weg, beschäftigte mich mit etwas anderem und ging nicht auf die Attacken ein, obwohl es doch viel gesünder gewesen wäre, sich zur Wehr zu setzen und auf die Angriffe etwas zu erwidern. Insgeheim brodelte es in mir weiter, und innerlich war ich unruhig oder sogar völlig durcheinander, während ich nach außen den Eindruck eines gefassten, in sich ruhenden und durch nichts zu erschütternden Menschen machte. Meist erinnerte dieses seltsame, eine tiefe Ruhe ausstrahlende Wesen sich dann an bestimmte Szenen der Kindheit, es waren stille Szenen am Rhein, und fast immer half die Erinnerung wahrhaftig, mit allem Unangenehmen fertig zu werden.
In der Zeit nämlich, in der Mutter und ich darauf warten mussten, dass die von uns bestellten Waren in den Einkaufsläden zusammengestellt und verpackt wurden, gingen wir meist hinunter zum Fluss. Es waren nur ein paar Minuten bis zu seinem Ufer, und ich wusste, dass Mutter dorthin am liebsten ging, weil wir beide dort allein waren und niemand uns weiter anredete oder befragte.
Am Rhein setzte sie sich immer auf dieselbe Bank, es war unsere gemeinsame Bank, es war die Bank, von der Mutter und ich stillschweigend glaubten, dass sie nur uns beiden gehörte, niemand sonst noch sollte dort Platz nehmen, und wenn doch jemand dort saß, gingen wir so lange am Ufer des Flusses auf und ab, bis die Bank wieder frei war. Dann holte Mutter ein Buch aus ihrer Tasche und begann zu lesen, während ich am Ufer des Flusses spielen durfte, natürlich nicht unten, direkt am Ufer, sondern etwas oberhalb, auf dem Spazierweg, von dem aus die schmalen, meist feuchten Treppchen hinunter zum Wasser führten, die ich niemals betreten durfte.
In jedem Fall aber musste Mutter mich sehen und im Auge behalten können, das war sehr wichtig, ich durfte Mutters Gesichtskreis auf keinen Fall je verlassen, deshalb spielte ich ganz in ihrer Nähe, nur einige Schritte von ihr entfernt, während sich unterhalb der breite Fluss als eine große Gefahrenquelle auftat. Zwischen der Gefahrenquelle des Flusses und der Bank, auf der Mutter saß, durfte ich mich aufhalten, das genau war mein kleines Gelände, dieser schmale Streifen gehörte mir und stand mir zu, keinen Schritt darüber hinaus durfte ich machen, ohne dass Mutter aufgestanden und mich mit sanfter Gewalt wieder zurückgezogen hätte in das begrenzte Gebiet, das sie überblickte.
Es kam aber kaum vor, dass ich dieses Gebiet verließ, längst hielt ich die Grenzen instinktiv ein, wie ich überhaupt sehr genau wusste, wo und wie ich mich während des Tages in Mutters Nähe aufhalten durfte. Mutter war der Mittelpunkt von allem um mich herum, den Mittelpunkt durfte ich nie aus den Augen verlieren, ja noch mehr, ich durfte auch die körperliche Verbindung zu Mutter niemals abreißen lassen, um keinen Preis, denn ein solches Abreißen der Verbindung spürte sie sofort und geriet darüber in eine solche Aufregung, dass sie manchmal Tränen in die Augen bekam.
Es gibt nichts Schrecklicheres und Furchtbareres als das Bild einer in Panik geratenen Mutter, deshalb tat ich damals alles, aber auch alles, um sie nicht zu beunruhigen oder zu erschrecken. Die körperliche Verbindung mit ihr nicht abreißen zu lassen, das bedeutete, dass ich in ihrer unmittelbaren Nähe bleiben und dann und wann zu ihr hingehen musste, um sie zu berühren oder darauf zu warten, dass ich von ihr berührt wurde. Manchmal las sie dabei weiter in einem Buch und strich mir wie geistesabwesend mit einer Hand über den Kopf, als fühlte sie nach, ob ich noch da sei, dann hielt ich still und schlich mich erst wieder davon, wenn sie ihre Hand wieder zurückzog. Selten kam es dagegen vor, dass sie mich umarmte oder mir gar einen Kuss gab, die heftige Umarmung und der Kuss waren vielmehr die Sache meines Vaters, während Mutter mich meist nur leichthin oder flüchtig, dafür aber viele Minuten lang hintereinander berührte, im Grunde erstreckten sich diese leichten Berührungen ja über den ganzen Tag.
Am einfachsten war es deshalb, wenn ich mich neben sie auf die Bank setzte, die Beine baumeln ließ und auf den Fluss schaute. Dann hielt sie während ihrer Lektüre oft meine Hand, und ich wurde dann vollkommen ruhig, weil ich genau spürte, dass auch meine Mutter nun ruhig und vollkommen aufgehoben war in dem, was sie las. Meist hatte ich ein paar Steine und Gräser gesammelt und sortierte sie dann auf der Bank, oder ich blätterte in einem Bilderbuch, das Mutter für mich ausgesucht und mitgenommen hatte, es kam aber auch vor, dass ich einfach nur dasaß und den Frachtschiffen zuschaute, wie sie auf dem Fluss entlangfuhren, oder dass ich lange die Möwen beobachtete, wie sie von einem Ufer zum andern trudelten, in immer anderen Kurven und Drehungen, wie Trunkenbolde, die den geraden Weg nicht mehr fanden.
Ich starrte auf einen winzigen Ausschnitt der Umgebung und beobachtete ihn so lange, bis es rings um diesen Ausschnitt zu schwanken und zu flirren begann. Manchmal wurde mir dann etwas heiß, und ich musste die Augen rasch schließen, ja es kam sogar vor, dass mir in solchen Augenblicken richtig übel und schwindlig wurde, dann hatte ich zu lange auf einen Punkt gestarrt und musste mich bemühen, den Blick wieder von diesem Punkt wegzubekommen.
Besser war es, nicht einen festen Punkt oder einen kleinen, unveränderlichen Ausschnitt zu betrachten, sondern etwas, das sich bewegte. Ich ließ meine Beine langsam hin und her baumeln und beobachtete eines der langsamen Frachtschiffe bei seiner ruhigen Fahrt, wie es eine schmale, schwankende Rinne ins Wasser zog, und wie der gläserne Strudel mit den winzigen, hin und her springenden Blasen an seinem Heck sich allmählich verflüchtigte und in kleine, bleiche Wellen verwandelte, die dann ausrollten, bis hin zum Ufer.
Was glotzt er denn so?, mokierten sich damals manchmal einige Spaziergänger, die sich darüber wunderten, wie lange ich irgendwohin starren konnte, ohne mich zu bewegen. Sie konnten nicht wissen, dass Glotzen half, stark und unverletzbar zu werden, und dass es darüber hinaus half, den fremden Dingen um einen herum ein kleines Stück näher zu kommen, so dass sie etwas von ihrer Fremdheit verloren.
Auch das Glotzen habe ich im späteren Leben nicht aufgegeben, ich bin ein großer Glotzer und Anstarrer geblieben, und oft hat mir das sogar geholfen. Wenn ich in Museen gehe, laufe ich so lange durch die Säle, bis ich ein Bild zum Anstarren finde, und dann setze ich mich hin und glotze und glotze, bis ich das Bild selbst mit geschlossenen Augen in allen Details vor mir sehe. Wenn das Bild mir gut gefällt, wird es mir während des Glotzens von Minute zu Minute vertrauter, und schließlich habe ich das Gefühl, dass es zu mir gehört wie die kleinen Lebensbilder, die ich draußen, im Freien, beobachtet habe.
Das schönste Bild aber, das ich kenne, ist eine bunte Fotografie, die meine Mutter und mich auf einer Bruchsteinmauer am Rhein zeigt. Wir sitzen dicht aneinander gelehnt, meine Mutter hält unmerklich meine linke Hand, sie trägt einen langen, hellen, sehr schönen Mantel und einen eleganten, weißen Hut. Ich selbst starre irgendwohin, noch bin ich ein kleiner Knabe und wirke doch wahrhaftig auch schon wie ein Alter.
Ich liebe dieses Bild sehr, ich habe es jeden Tag hier in meinem römischen Arbeitszimmer vor Augen. Einmal entdeckte es ein Freund und fragte, wann es entstanden sei, und ich ließ mich im Überschwang unseres Gesprächs zu der Bemerkung hinreißen, dass ich mich manchmal stark danach sehne, noch einmal neben meiner Mutter auf dieser sonnigen, trockenen Bruchsteinmauer sitzen zu dürfen. Der Freund nannte meine Bemerkung sofort »regressiv«, Mann, das ist aber verdammt regressiv, was Du da sagst, meinte er.
Ich hasse das Wort »regressiv«, es ist ein Wort, mit dem man mir bestimmte Wünsche und Bilder austreiben will, es ist ein hartes, scharfes, spöttisches und lebloses Wort, es ist eines von den Worten, die all jene gerne benutzen, die mir nicht erlauben wollen, so zu sein, wie ich nun einmal bin, oder die sich nicht die geringste Mühe geben, zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin.
Ich jedenfalls halte meine Sehnsucht danach, noch einmal auf jener Mauer sitzen zu dürfen, nicht für »regressiv«, sondern für eine Sehnsucht nach jener in diesen Kindertagen zum ersten Mal empfundenen, sehr starken und ungetrübten Nähe zu einem anderen Menschen, nach der ich in meinem weiteren Leben dann immer wieder so sehr gesucht habe. Doch darüber später mehr.
3
ICH ERZÄHLTE bereits, dass ich diese Geschichte meiner Jugend in Rom schreibe. Ich habe immer wieder mehrere Monate am Stück in dieser Stadt gelebt, zuletzt aber war ich über zehn Jahre nicht hier. Mein jetziger Aufenthalt hat damit zu tun, dass ich zu Hause nicht mit meiner Arbeit vorankam. Ich setzte immer von Neuem an, aber ich hatte nicht genügend Abstand zu dem, was ich erzählen will. So kam ich auf den Gedanken, es in Rom zu versuchen, denn in Rom habe ich gute Zeiten meines Lebens verbracht.
Ich habe eine kleine Wohnung im ersten Stock eines fünfstöckigen Hauses gemietet, sie liegt im Viertel Testaccio, weitab von den touristischen Zonen, in einer Gegend, in der die Römer noch selbst glauben, sie seien ganz unter sich. Kaum mehr als ein paar Minuten von meiner Wohnung entfernt, steht der weiße, hoch aufragende Bau der Cestius-Pyramide, und daneben befindet sich der Metro-Bahnhof Piramide, von dem aus ich schnell ins Zentrum, aber auch nach Ostia, ans Meer, fahren kann.
Testaccio gefällt mir aber nicht nur wegen der guten Metro-Verbindungen, sondern vor allem, weil es das Viertel der Märkte, der kleinen Lebensmittelgeschäfte und versteckt liegenden Restaurants ist. Jeden Tag gehe ich meist zur Mittagszeit auf den zentralen Markt, einen der lebendigsten in Rom überhaupt, ich kaufe zwei, drei Zeitungen, lasse mich in einigen der kleinen Bars sehen, trinke hier einen Caffè und dort ein Glas Wein und überlege mir, ob ich irgendwo im Freien eine Kleinigkeit esse oder etwas einkaufe, um mir eine einfache Mahlzeit in der Wohnung zuzubereiten.
Sie liegt ganz in der Nähe des Marktes, an der Piazza di Santa Maria Liberatrice, einem für römische Verhältnisse ungewöhnlich weiträumigen Wohnplatz, den ich noch von meinen früheren Aufenthalten her kenne. Damals habe ich mir immer gewünscht, einmal genau an diesem Platz wohnen zu dürfen, so sehr gefielen mir seine hohen Kastanien und die dunklen Steineichen, die überall für schattige Zonen und Sitzmöglichkeiten sorgen. Schon vom frühen Morgen an ist der Platz mit lesenden, rauchenden und sich unterhaltenden Menschen bevölkert, trotz dieses Lebens herrscht auf ihm aber kein Lärm, sondern eine Art von gelassener Ruhe, die Anwohner bewegen sich langsam, bleiben oft lange in kleinen Gesprächsrunden stehen und erwecken den Eindruck von Menschen, die alles, was sie tun, genauso tun wie die Generationen vor ihnen.
Aus früheren Zeiten habe ich in Rom noch einige Bekannte und Freunde, aber ich werde mich diesmal nicht bei ihnen melden. Stattdessen unterhalte ich mich unten auf dem weiten, grünen Platz mit den Anwohnern, zum Glück spreche ich leidlich Italienisch, so dass ich vom ersten Tag meines Aufenthalts an Kontakte geknüpft habe. Solche Kontakte verpflichten mich aber zu nichts, weder Einladungen noch andere gemeinsame Unternehmungen entstehen aus ihnen, und genau das ist mir recht. Diesmal möchte ich mir meine Freiheit erhalten und nicht an Verabredungen und Treffen gebunden sein, die meinen Arbeitsrhythmus durcheinanderbringen könnten.
Ich stehe morgens mit den ersten Sonnenstrahlen auf, dann öffne ich die dunkelgrünen Holzläden vor den Fenstern und schaue hinunter auf den lang gestreckten, an allen Seiten von gleich hohen Häusern umsäumten Platz. Jetzt, in den ersten Frühlingstagen, verfängt sich das helle Morgenlicht noch wie ein schwacher Dunst zwischen den Bäumen, ein paar Hundebesitzer sind unterwegs und schauen zu mir hinauf, der Betrieb in der kleinen Bar gegenüber ist schon in vollem Gang, und von der Bäckerei rechts an der Ecke strömt der Duft von frisch gebackenem Brot zu mir herauf.
In diesen ersten Augenblicken des Tages empfinde ich oft so etwas wie eine starke Lebenslust und eine seltsame Hochstimmung, das Herz schlägt schneller, eigentlich möchte ich sofort hinuntergehen und den ersten Sonnenspuren folgen, das tue ich dann aber nur selten, vielmehr mache ich mir einen Cappuccino und nehme ihn mit hinüber zu meinem Schreibtisch, um gleich mit der Arbeit zu beginnen.
Die Fenster sind noch geöffnet, die frühen Aromen des Tages strömen herein, ich nippe an dem leicht cremigen Schaum, der den Caffè beinahe ganz verdeckt, ich nippe ein zweites Mal und nehme durch den porösen, lauwarmen Schnee einen kleinen Schluck des schwarzen Caffès, sofort bin ich hellwach und gespannt wie ein kleines Kind, das sich auf ein lange ersehntes Geschenk freut. Mein Geschenk ist die Schrift, ich setze mich an den Schreibtisch, ich trinke weiter in kleinen Schlucken, ich schreibe.
Natürlich ist mir nicht entgangen, wie sehr die Piazza di Santa Maria Liberatrice dem weiten und ovalen Platz vor dem Kölner Wohnhaus gleicht, in dem ich aufgewachsen bin. Gerade weil es aber gewisse Ähnlichkeiten gibt, empfinde ich die Unterschiede zwischen der Gegenwart und meinen stummen, frühen Kindertagen umso stärker. Niemand, der mich heutzutage über diese römische Piazza gehen sieht und bemerkt, wie ich hier und da stehen bleibe, einen Anwohner grüße und mich unterhalte, wird vermuten, dass derselbe Mensch als Kind kein einziges Wort gesprochen und vor jedem Gang ins Freie erhebliche Angst ausgestanden hat.
Diese Angst war nur dann etwas schwächer, wenn ich zusammen mit dem Vater hinausging. Manchmal sagte er am frühen Abend Wir machen jetzt einen Spaziergang, und dann gingen wir die Treppe hinab, bis in den Keller, wo der kleine Roller stand, den ich während der Spaziergänge mit ihm benutzen durfte. Da ich sehr genau darauf achtete, was man zu mir sagte und was man sonst in meiner näheren Umgebung noch alles so redete, fiel mir auf, dass der Vater mich niemals fragte, ob wir zusammen einen Spaziergang machen wollten, sondern immer so tat, als stünde von vornherein fest, dass wir einen machten.
Die meisten anderen Kinder wurden unaufhörlich etwas gefragt, Möchtest Du ein Eis?, Hast Du nasse Füße?, Warum hast Du das getan?, ich aber wurde das nie, höchstens aus Versehen in einem Kaufladen, wenn die Verkäuferinnen mich fragten, ob ich eine Scheibe Wurst wolle, und dann, wenn ich mich nicht rührte, die Frage rasch wieder zurücknahmen und sagten: Ach Gott, er kann uns ja gar nicht verstehen!
Jedes Mal ärgerte ich mich über eine so blöde Bemerkung und begriff nicht, warum sie bloß annahmen, ich könne sie nicht verstehen, denn natürlich verstand ich sie sehr genau. Manche Verkäuferinnen und auch einige Menschen in unserer Nachbarschaft glaubten aber fest, ich verstünde sie nicht, ja sie taten, wenn sie einmal begriffen hatten, dass ich stumm war und nur sehr verhalten reagierte, sogar so, als wäre ich mit dieser Auskunft für sie gestorben. So etwas bemerkte ich schnell, ich merkte es daran, dass sie mich gar nicht mehr oder nur noch sehr flüchtig anschauten, es war, als existierte ich nicht mehr, sondern stünde nur noch herum wie ein Phantom, das sich irgendwann ganz in Luft auflösen würde.
Mein Vater wäre der einzige Mensch gewesen, der gegen dieses Verhalten etwas hätte tun können, aber er redete nicht mit anderen Menschen über mein Schweigen. Ich glaube nicht, dass es ihm peinlich gewesen wäre, das zu tun, nein, das war es nicht, ich glaube vielmehr, dass er der Meinung war, die dunkle Geschichte unserer kleinen Familie gehe die anderen Menschen nichts an. Außerdem konnte man von meinem Schweigen nicht erzählen, ohne auch vom Schweigen meiner Mutter zu erzählen, das eine existierte nicht ohne das andere – und deswegen war alles Erzählen sehr schwierig, vielleicht war auch das ein Grund dafür, dass mein Vater es erst gar nicht versuchte.
Jedenfalls machten wir uns, wie schon gesagt, oft am frühen Abend zu zweit auf den Weg, und Vater sagte dann, ohne mich zu fragen, nur: Jetzt gehen wir in die Wirtschaft oder Jetzt holen wir uns eine Zeitung. Ich habe auch in meinem späteren Leben kaum einen Menschen gekannt, der ein so großer Zeitungen- und Zeitschriften-Liebhaber war wie er, beinahe jeden Tag kaufte er welche an dem kleinen Kiosk direkt neben der Kirche, in die wir an fast jedem Sonntag zu dritt in den Gottesdienst gingen. Mit dem Kioskbesitzer verstand er sich gut, ja er lauerte richtiggehend darauf, dass er ihn für seine Auswahl der Zeitschriften lobte und Perfekt! Eine perfekte Wahl! sagte.
Ich aber freute mich, dass er bei diesen Einkäufen nicht nur an sich selbst, sondern immer auch an mich dachte. So legte der Zeitschriftenhändler auch mir ganz selbstverständlich einige Zeitschriften zur Auswahl hin, und ich blätterte in ihnen wie Vater in den seinigen, bis ich mich für eine entschied. Der Zeitschriftenhändler war denn auch einer der wenigen Menschen in unserer Umgebung, der mich nicht anders behandelte als die anderen Kunden. Schwungvoll kommentierte er meine Wahl, indem er sich selbst fragte, warum ich gerade diese und nicht eine andere Zeitschrift ausgewählt hatte, und trocken und knapp beantwortete er seine eigenen Fragen, indem er zwei oder drei Gründe aufzählte.
Das, fand ich damals, war genau die richtige Art, mit meinem Stummsein umzugehen, denn der Zeitschriftenhändler beachtete es nicht weiter und erwähnte es nie, sondern tat so, als wäre es etwas so Vorübergehendes wie eine Krankheit, die ich irgendwann wieder los sein würde. Es war, als wäre ich heiser oder erkältet und würde in ein paar Tagen wieder reden, so dass man mich jetzt nicht weiter belästigen, sondern schonen müsse. Genau diese Schonung und dieses Drüberwegreden aber war mir am liebsten, denn es stempelte mich nicht ab und ließ mir die Hoffnung, alles könne irgendwann einmal besser werden.
Am besten aber fand ich schließlich, dass Vater mich immer allein entscheiden ließ, welche Zeitschrift ich wollte, niemals sagte er Nein oder Nimm doch die andere hier, die ist besser, vielmehr kaufte er einfach die, die ich ausgesucht hatte. Es stimmte also, was der Zeitschriftenhändler am Ende unserer Einkäufe sagte: Perfekt!, ja genau, diese Einkäufe waren – anders als all die anderen, die ich durchzustehen hatte – ein einziges Vergnügen und daher wirklich perfekt.
Vom Kiosk mit den vielen Zeitschriften aus gingen Vater und ich dann oft weiter zu einem nahe gelegenen Wirtshaus, jetzt kehren wir ein!, sagte Vater mit einer spürbaren Vorfreude, und dann betraten wir den Vorraum des großen Brauhauses, das Zum Kappes hieß, ja im Ernst, es hieß wirklich so. Anfangs hatte ich nicht verstanden, was das heißen sollte, ich hatte nur manchmal gehört, dass jemand behauptete, etwas sei Kappes, womit er doch anscheinend sagen wollte, etwas sei Unsinn oder der reine Blödsinn. Hieß also das Wirtshaus vielleicht so, weil man dort viel Unsinn oder Blödsinn machte?
Erst nach einer Weile hatte ich verstanden, dass mit dem Wort Kappes die Unmengen von Kohl gemeint waren, die in diesem Wirtshaus auf großen Tellern zusammen mit dicken, schwitzenden Würsten serviert wurden. Der Geruch von Kohl und Wurst empfing einen auch gleich in dem kleinen Vorraum mit all seinen Stehtischen und den dicht gedrängt um die Tische herum stehenden Männern, zwischen denen wir uns einen Platz suchten. Kaum hatte man den gefunden, kam auch schon ein Mann in einem blauen Wams und einer Lederschürze vorbei, der von den Gästen der Köbes genannt wurde. Der Köbes brachte dem Vater in Windeseile ein Kölsch, alle Gäste in diesem Vorraum tranken Kölsch, eins nach dem andern und meist sehr rasch, auf einen Zug.
Dieses rasche und ununterbrochene Trinken beobachtete ich genau, ich schaute zu, wie die vielen feuchten Münder sich immer wieder einen kleinen Spalt öffneten, damit der kurze goldgelbe Strahl mit der dünnen, schwankenden Schaumkrone hineinschießen konnte, es handelte sich eigentlich nicht um ein Trinken, sondern eher um ein Stillen, den Durst stillen, so nannten es oft die Männer, und so war es denn auch, ein einziges Leersaugen der kleinen Kölsch-Stangen, ein einziges Zucken und Zittern der leicht geöffneten Lippen, in Erwartung des nächsten Glases.
Waren schon diese Vorgänge faszinierend genug, so waren die Unterhaltungen es noch mehr, beruhten sie doch auf der Kunst, alle Anwesenden beinahe gleichzeitig in ein einziges großes Gespräch zu verwickeln. Mit offenem Mund lauschte ich, wie sich die Trinkenden zu zweit, zu dritt, über den Kopf des Gegenübers hinweg, durch das ganze Lokal unterhielten, selbst der Mann, der das begehrte Kölsch aus den Kölschfässern zapfte, murmelte ununterbrochen etwas, begrüßte die Neuankömmlinge mit Namen, antwortete auf ein paar Wortfetzen, die er aufgeschnappt hatte, und legte mit einer kurzen, trockenen Bemerkung nach.
Durch diese ununterbrochene Unterhaltung entstand ein höllischer Lärm, der bald hier, bald da lauter wurde, sich verdichtete, kurz verebbte und dann an den Rändern des Vorraums wieder zunahm, das Ganze glich einer gewaltigen Wortwoge, die in immer neuen Schüben durch den Raum rollte, sich brach, sich wieder aufbäumte und schließlich überschlug. Vater aber beteiligte sich an dieser Woge nicht durch lang ausholende Beiträge, sondern eher durch Nachfragen, kurze Sätze und Bestätigungs- oder Anfeuerungsrufe, vor allem aber hatte er eine Eigenheit, die oft wie eine Krönung der gesamten Wortmusik wirkte, indem es sie zu einem Höhepunkt oder Abschluss brachte: Vater lachte. Es war kein lautes, sondern ein herzliches Lachen, es war, wie ich einmal gehört hatte, ein Lachen aus voller Brust, das von tief innen kam und heranrollte, als säße in diesem tiefen Innern ein tagsüber eingesperrter Fremder, der sich nun endlich nach Kräften austoben durfte.
In der Wirtschaft konnte ich Männer beobachten, die andere unaufhörlich zum Lachen brachten, selbst aber wenig lachten, es gab auch die, die nur kurz lachten und dann rasch wieder ernst wurden, niemand aber brachte so wie der Vater die anderen bereits dadurch zum Lachen, dass er einfach nur lachte. Dieses mir manchmal durchaus unheimliche Lachen war eine Angewohnheit, die ich auch sonst oft an Vater beobachten konnte. Begegneten wir zum Beispiel auf der Straße einem Bekannten, so dauerte es nicht lange, bis Vater lachte und auch sein Gegenüber zum Lachen gebracht hatte, es schien ganz einfach, er lachte alles Befremdliche und Steife weg, und wenn ihm jemand besonders gehemmt oder gar schwierig daherkam, imitierte er ihn ein wenig und lachte.
Es hätte Menschen geben können, die ihm das sehr übel genommen hätten, das kam aber nicht vor, die meisten waren vielmehr erleichtert, von Vater so munter und aufgeräumt angesprochen zu werden, als gäbe es in der Welt nichts Schwieriges oder Unlösbares, sondern als bildeten sich die anderen so etwas nur ein. Eine Verkäuferin hatte Vater deswegen einmal eine Frohnatur genannt, Sie sind eben eine richtige Frohnatur, hatte sie zu ihm gesagt und mir dadurch wieder einmal etwas zum Grübeln gegeben.
Wieso, fragte ich mich, war Vater denn eine solche Frohnatur? Wieso lachte er bereits, wenn ich meinen Roller aus dem Keller geholt hatte und losfuhr? Was war an diesem Losfahren denn bloß so komisch oder befreiend, dass man darüber lachen konnte? Vielleicht, dachte ich damals, war Vater oft so munter und gelöst, weil Mutter das genaue Gegenteil war, vielleicht wollte er in unser Leben etwas Leichtigkeit hineinbringen, während Mutter weiß Gott keine Person war, die irgendetwas leicht zu nehmen verstand.
Jedenfalls mochte ich meinen Vater sehr, nicht nur wegen seines befreienden Lachens, sondern auch, weil er mich niemals tadelte oder schimpfte oder zu etwas aufforderte, was ich nicht gern getan hätte. Vater und ich – wir verstanden uns gut, auch ohne das ununterbrochene, korrigierende und besserwisserische Reden, das andere Eltern auf ihre Kinder niederregnen ließen. Dabei spielte auch eine Rolle, dass mir Vaters Kleidung gefiel. Immer war er anders und gut gekleidet, er trug Kleidung, die zur jeweiligen Jahreszeit passte, und überlegte sich sehr genau, was er anzog. Oft trug er ein frisches, weißes Hemd und eine Fliege, er besaß sehr viele Fliegen, sie baumelten in einer langen Kette an der Innentür des Kleiderschrankes, und manchmal holte ich mir zwei, drei von der Schnur und probierte sie an, als wollte ich für ein paar Minuten hineinschlüpfen in die Rolle des Vaters.
In der Gegenwart eines so großen und stattlichen Mannes hatte ich keine Angst, auch in der lauten Wirtschaft, in deren Vorraum sich niemals andere Kinder aufhielten, hatte ich keine, ich war Vater vielmehr dankbar, dass er mich dorthin mitnahm und so wenigstens für kurze Zeit einmal unter Leute brachte. Die trinkenden Männer ließen mich ohnehin in Ruhe, niemand sprach mich an und brachte mich damit in Verlegenheit, es kam höchstens vor, dass einer von ihnen auf die Toilette verschwand, mir beim Vorbeigehen kurz übers Haar strich und fragte, wie es mir gehe. Eine solche Frage war aber nicht ernst gemeint, das konnte ich schon daran erkennen, dass der Frager nicht auf eine Antwort wartete, sondern einfach weiterging, als genüge die Frage vollkommen und als erwarte er überhaupt keine Antwort.
Und so stand ich denn an vielen Abenden unter den trinkenden und sich laut unterhaltenden Männern, blätterte in einer Zeitschrift, lauschte den vielen Stimmen und träumte, dass ich von all den Speisen kosten dürfe, die aus der Küche an den trinkenden Männern vorbei in den eigentlichen Gastraum gebracht wurden. Die meisten Gäste bestellten die dicken, schwitzenden Würste, dazu etwas Sauerkraut und Püree, das Sauerkraut dampfte leicht, und die Würste sahen prall und fest aus, während das Püree cremig, als ein kräftiger, hell leuchtender Farbklecks, am Rand des Tellers lag.
Ich träumte, dass ich mit den Eltern im Gastraum saß und mir aus den kleinen Tontöpfchen, die auf den blank gescheuerten Tischen standen, etwas Senf nahm, ich träumte, dass ich eine Portion Sauerkraut auf einer kleinen Gabel balancierte und langsam in den Mund führte, und ich träumte davon, einmal von Vaters Kölsch nippen zu dürfen, um endlich zu erfahren, ob es wirklich das beste Getränk der Welt war und so unglaublich gut und frisch schmeckte, wie die Männer um mich herum immer wieder behaupteten.
Aus dieser Zeit habe ich mir einen unausrottbaren Hang zu einfachen Wirtschaften, zu Brauhäusern und Weinstuben mit einer schlichten, regionalen Küche erhalten. Nicht dass ich nur in solchen Wirtschaften etwas trinken und essen würde, das nicht, aber wenn ich eine von ihnen sehe, gehe ich gern hinein und freue mich jedes Mal, wenn ich die vielen, sich überlagernden Stimmen höre. In der Nähe meines römischen Mietshauses gibt es eine große Anzahl dieser einfachen Wirtschaften, viele von ihnen liegen rund um den Markt, so dass man von den Marktständen aus sofort in sie hineinschlüpfen und dann wieder zurück zwischen die Stände gehen kann. Es ist, als gäbe es eine geheime Osmose zwischen den Wirtschaften und den Ständen, die Gerüche jedenfalls verbinden und vermengen sich vom frühsten Morgen an, und wenn ich mich eine Weile in solchen Zonen aufgehalten habe, durchziehen sie auch meine Kleidung, und ich nehme sie mit hinauf, in meine stille römische Wohnung.
4
BISHER HABE ich von meiner Mutter, meinem Vater und unserem gemeinsamen Leben in Köln so erzählt, als habe es außerhalb dieses Lebens zu dritt keine andere Welt gegeben. Man könnte mich fragen, ob das wirklich so war und ob so etwas überhaupt möglich ist – ich kann darauf aber nur antworten, dass es mir heute wirklich so vorkommt, als wäre ich in meinen ersten Lebensjahren wahrhaftig nur mit zwei Menschen in Berührung gekommen und hätte in einer Art verschwiegenem Geheimbund mit nur den notwendigsten Außenkontakten gelebt.
Das Leben dieses Geheimbundes vollzog sich nach festen Regeln und in einer großen Stille, es war die unheimliche, wie von großer Erschöpfung herrührende Nachkriegsstille der fünfziger Jahre, in denen man jeden Laut, jede Stimme und jeden Klang noch sehr genau wahrnahm, weil diese Stille noch nicht durchsetzt war von fremden, künstlichen Klängen. Es war eine Welt ohne Fernsehen, ja sogar weitgehend noch ohne Radio oder Schallplatte, eine Welt, in der man sich bemühen musste, ein Geräusch zu erzeugen oder die Entstehung von Geräuschen zu veranlassen, eine Welt, in der es also nicht immer schon und dazu noch ununterbrochen Geräusche und Klänge gab.
Wenn wir frühmorgens die Fenster unserer Wohnung öffneten, um etwas frische Luft hereinzulassen, hörte man höchstens das Zirpen der Vögel, die sich in kleinen Schwärmen in den hohen Pappeln herumtrieben, und manchmal einen einzelnen, vorbeifahrenden Wagen, sonst aber kaum etwas anderes als die Stille selbst, als hielte der gewaltig große Himmel über uns den Atem an oder als wäre die schwere Erde in ein brütendes Schweigen versunken. Diese Stille war immer gegenwärtig und machte sich sofort wieder breit, wenn eines der Einzelgeräusche verebbt war, sie war einfach nicht abzuschütteln, sondern höchstens für Momente zu vertreiben oder zu verdrängen, dann aber setzte sie gleich wieder ein, wie eine überdimensionale Glocke, die sich über das gesamte kleine Leben stülpte.
Ein kleines Leben, ja genau, so kommt es mir heute vor, als wäre ich in einem Spielzeugland aufgewachsen, in einer großen geräuschlosen Zone, in der man sich nur in den Brauhäusern und Wirtschaften laut unterhielt, während auf den Straßen sehr leise gesprochen oder auch nur geflüstert wurde. Manchmal versuchte ich, diese Straßengeräusche zu identifizieren, ich legte mich vor einem offenen Fenster unserer Wohnung mit dem Rücken und geschlossenen Augen auf den Boden und lauschte angestrengt: was war das?, was war das genau?, wessen Stimme?, wessen Schritte?
Ich ahnte natürlich noch nicht, wie sehr dieses Lauschen mein Gehör forderte und trainierte, es war ein geradezu ideales Training, um Geräusche und Klänge unterscheiden zu lernen. Später, als man von mir verlangte, die Stimmen eines großen Orchesters zu identifizieren und genau anzugeben, welche Instrumente gerade zusammen spielten, kam mir dieses Training zugute, den Eindruck, eine Art Musikstück zu hören, hatte ich aber damals, in den frühen Kinderjahren, schon.
Denn zu den damals noch einzeln wahrzunehmenden Klängen und Stimmen gehörte ja auch, dass sie sich ankündigten und dann sehr langsam auftraten, so langsam, dass ich genau verfolgen konnte, wie sie begannen, eine Weile zu hören waren und wieder verschwanden. Immer waren sie zeitlich exakt begrenzt und wirkten daher wie Abläufe mit einer bestimmten Spieldauer, so dass ich zum Beispiel recht genau sagen konnte, wie lange ein Wagen brauchte, um an unserem Haus vorbeizufahren und wieder in der Stille zu verschwinden.
Solche Wahrnehmungen waren typisch für jene Jahre und vor allem für mich, sie hatten etwas von skurrilem Autismus, denn das kleine Kind, das ich war, protokollierte die Welt unaufhörlich in den sonderbarsten, selbst erfundenen und beinahe manisch perfektionierten Systemen. Von diesen Systemen gab es sehr viele, und ich hatte sie alle im Kopf: Das Zeitschriften-Beobachtungssystem, mit dessen Hilfe ich mir die Titelblätter der Zeitschriften merkte, das große Lauschsystem, in dem ich die Stimmen und Klänge speicherte, vor allem aber das System der fertigen Sätze und Redewendungen, die von den anderen Menschen immer wieder zu bestimmten Gelegenheiten gebraucht wurden.
All diese immer wiederkehrenden Sätze und Redewendungen versuchte ich mir zu merken, indem ich sie Menschen, Situationen und Bildern zuordnete, so glaubte ich, zumindest heimlich etwas von der Sprache mitzubekommen. Hören und sehen, wie die Sprache gebraucht wurde, konnte ich ja schließlich sehr gut, und genau das versuchte ich, mir zunutze zu machen, als lernte ich für den Ernstfall, für den einen großen Moment, von dem an ich sprechen würde, einfach so, wie nach einem Urknall.
Im täglichen Leben aber führten meine Beobachtungssysteme und all meine anderen seltsamen Spleens dazu, dass ich viel Zeit wie in Trance herumsitzend oder -liegend verbrachte, in Gedanken versunken, nur mit mir selbst beschäftigt. Heute erscheint es mir merkwürdig, dass niemand sich daran störte oder versuchte, mich aus diesem Dasein herauszulocken. Im Grunde kümmerte sich niemand um mich, selbst die Mutter nicht, die den ganzen Tag viel mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten beschäftigt und anscheinend damit zufrieden war, dass sie mich nicht ununterbrochen zu unterhalten brauchte, sondern mich mir selbst überlassen konnte.
Außerdem erweckte ich ja nicht den Anschein, unglücklich oder gelangweilt zu sein, auch begehrte ich niemals auf oder geriet mit der Mutter in Streit. Es gab keine Auseinandersetzungen und nur selten kleinere Missverständnisse, wie ja auch die Eltern fast niemals miteinander stritten, sondern den Eindruck eines Liebespaares machten, das mit großer Vorsicht und einer geradezu rührenden Hilfsbereitschaft miteinander umging.
Bestimmt war diese Innigkeit, die auch fremde Menschen oft erstaunte, letztlich noch ein weiterer Grund dafür, dass wir drei uns so sehr von der Außenwelt abschotteten, die Eltern traten auf, als gehörten sie seit ewigen Zeiten zusammen und bräuchten niemand weiteren zu ihrem Glück. Ich selbst aber war der sichtbare Ausdruck ihrer Zusammengehörigkeit und daneben das stumme und gesteigerte Bild allen Leids, das ihnen widerfahren war. Wahrhaftig hatte ich in diesen Jahren auch nie das Gefühl, im Mittelpunkt ihres Lebens zu stehen, ich war nicht das behütete, verwöhnte oder mit Liebe überschüttete Kind, sondern eine Art herumwandelndes Phantom, von dem man niemals genau wusste, was in ihm gerade vorging und wie es tickte.
Als ein solches, oft nur am Rande wahrgenommenes Wesen lief ich während unserer gemeinsamen Spaziergänge hinter den Eltern her oder begleitete sie auf meinem Roller, während Mutter und Vater meist eng zusammen gingen. Vater legte den Arm um die Mutter, oder Mutter hängte sich bei ihm ein, und oft gaben sie sich in fast regelmäßigen Abständen einen Kuss, als wollten sie damit ihr gegenseitiges Einverständnis besiegeln. Fast immer küsste Vater die Mutter zuerst, und fast jedes Mal schaute ich vorher, wenn sich Derartiges anbahnte, genauer hin, um zu sehen, wohin genau der Vater die Mutter küssen würde, ob auf die Stirn, den Mund oder etwas seitlich, hinter das Ohr, auf den Hals.
Die Küsse auf die Stirn waren die häufigsten, während die Küsse auf den Mund viel seltener waren, weil hierzu ja auch gehörte, dass die Mutter ebenfalls Lust hatte, den Vater zu küssen. Der seltsamste Kuss aber war der Kuss des Vaters hinter das Ohr auf Mutters Hals, es war, wie ich damals annahm, der verliebteste Kuss, und er kam vor allem in Augenblicken vor, in denen man dem Vater seine Verliebtheit anmerkte oder in denen er zeigen oder beweisen wollte, wie verliebt er war.
Solche Liebesküsse waren ganz anders als die Küsse, die ich selbst von den Eltern erhielt. Als das Kind, das sie begleitete, wurde ich dann und wann zwar ebenfalls kurz geküsst und manchmal auch abgeküsst, die Liebesküsse aber waren intensiver, wie ein Austausch unter Berauschten, deshalb lösten sie ja auch schon beim bloßen Zuschauen einen leisen Schauer aus. Manchmal überlegte ich, wie es wohl wäre, genauso geküsst zu werden, gab diese Überlegungen aber rasch wieder auf, weil ich nicht daran glaubte, irgendwann in meinem Leben einmal einen Menschen zu finden, den ich selbst so küssen oder der mich so küssen würde. Die Eltern, dachte ich damals, gehörten zusammen, für mich aber gab es niemanden meines Alters, zu dem ich gehörte, ich war eben allein.
Und so trieb ich mich meist seit den frühen Morgenstunden auf dem dunklen, lang gestreckten Flur unserer Wohnung herum, nach beiden Seiten gingen die Zimmer ab, das Wohnzimmer, das Esszimmer, das Schlafzimmer der Eltern und die große Küche. Von manchen Zimmern aus schaute man in den kleinen Innenhof, von den anderen, jenseits des Flurs liegenden, aber auf den großen ovalen Platz mit seinen Pappeln, den gepflegten Rosenbeeten und dem Kinderspielplatz, auf dem erst später die ersten Kinder mit ihren Müttern eintrafen.
Im dunklen Flur war ich allein, ich schlug den blauen Vorhang der Abstellkammer beiseite und ordnete meine Zeitschriften auf den hellen Holzregalen in schweren Stapeln, ich nahm das Spielzeug aus den unter den Regalen stehenden Kisten und baute es dann irgendwo in einer Ecke des Flurs oder entlang der Wände auf: Den kleinen Bauernhof mit all seinen Tieren, Hütten und Zäunen, die winzigen, mit einem kleinen Drehschlüssel aufziehbaren Autos, die ich zu kleinen Wettrennen durch die ganze Länge des Flurs schickte, vor allem aber die Bälle, unendlich viele, kleine und große Bälle, die ich durch den Flur wirbeln ließ, hintereinander, wie auf der Jagd, oder gezielt, wie Kugeln, die an der Front ein paar Kegel abschießen mussten. Mit diesen Bällen konnte ich Stunden verbringen, indem ich mir immer ein neues Spiel ausdachte, insgeheim ließ ich Mannschaften gegeneinander antreten und merkte mir dann die Spiel- und Punktestände, auch hier entwarf ich Pläne und Systeme und beschäftigte mich mit der Erfindung der seltsamsten Spielvarianten.
Manchmal kam dann die Mutter vorbei, sie hatte aufgehört zu lesen und ging hinüber in die Küche, tat aber, als bemerkte sie mich nicht, jedenfalls blieb sie niemals stehen oder schaute mir zu, sondern warf höchstens einmal einen kurzen Blick auf mein Treiben, als könnte mein Tag ja gar nicht anders verlaufen als genau so. Wenn sie etwas länger und aufwendiger kochte, ließ sie die Küchentür offen, schaltete das Radio ein oder legte eine Schallplatte auf, sie hörte ausschließlich klassische Musik, aber auch die nur sehr gedämpft, so dass sie im Flur fast kaum noch zu hören war.
Oft waren es Frauenstimmen, in allen Höhenlagen singende Frauenstimmen, die eine Arie oder sonst etwas Getragenes sangen, ich mochte all diese Stimmen nicht sehr, sie machten mich traurig, denn jedes Mal, wenn ich sie hörte, kam mir ein seltsames Bild vor Augen: das Bild einer einsamen Frau in einer abgelegenen Landschaft, die ihre Einsamkeit oder etwas ganz und gar Unheimliches, ja Furchtbares beklagte. Auch Vater mochte diese Art von Musik nicht, der musikalische Geschmack der beiden war sehr verschieden, zwar hörte auch Vater nur klassische Musik, aber fast ausschließlich orchestrale und nur in seltenen Fällen etwas mit Gesang.
Hatte Mutter in der Küche mit der Vorbereitung des Essens begonnen, wartete ich meist noch eine Weile, bis ich meine Spielsachen stehen ließ und zu ihr in die Küche ging. Ich setzte mich an den Küchentisch und schaute ihr bei der Küchenarbeit zu, ich bekam etwas zu probieren oder half ihr beim Kleinschneiden von Gemüse oder Obst, manchmal legte ich mich auch einfach nur auf das schmale Sofa, das für mich bestimmt war, weil ich auf diesem Sofa in meinen Zeitschriften blätterte und mir dort auch eine kleine Ecke mit Bilderbüchern eingerichtet hatte.
Meist gab es am Mittag für Mutter und mich nur eine Suppe mit etwas Brot, Mutter liebte das Suppenkochen, und sie kochte gewiss die besten Suppen, die ich je gegessen habe. Das Suppenkochen hatte den Vorteil, dass man mit seiner Vorbereitung irgendwann beginnen und während des Vor-sich-Hinkochens der Suppen etwas anderes tun konnte, genau so machte es Mutter jedenfalls meist, sie enthäutete Tomaten, schnitt sie klein, gab sie in den mächtigen Suppentopf und ließ daneben, in einem zweiten Topf, eine gute Brühe ziehen.
Zwei, drei oder auch vier Stunden brauchten diese Suppen, bis sie gut eingekocht waren, es gab wunderbare Linsensuppen mit sehr feinen, kleinen Linsen, klein geschnittenem Gemüse und etwas Speck, es gab Tomaten-, Kartoffel-, Gemüse- und Zwiebelsuppen, und immer wurden sie mit einer selbst gemachten, ebenfalls über viele Stunden gekochten Brühe angesetzt, so dass sie einen kräftigen, intensiven Geschmack hatten.
Kochten Gemüse, Kartoffeln oder Tomaten sowie die Brühe vor sich hin, konnten Mutter und ich am späten Morgen entweder zum Einkaufen aufbrechen oder hinunter auf den Kinderspielplatz gehen. Wenn wir nach zwei oder mehr Stunden zurückkamen, durchströmten die ganze Wohnung Wolken eines schweren, kompakten Geruchs, es war, als träte man in eine warme Höhle mit den üppigsten Aromen, mit Aromen von Gemüse, Kräutern und etwas Fleisch, die so köstlich und verführerisch dufteten, dass man sich am liebsten noch im Stehen über die beiden Kochtöpfe hergemacht hätte.
Bis es aber so weit war, hatten wir Zeit, auf den Kinderspielplatz zu gehen, und dieser für mich sehr unangenehme Gang war so etwas wie ein Tribut an die Gemeinschaft um uns herum. Der ganze Zweck dieses Unternehmens nämlich bestand darin, den anderen zu zeigen, dass wir uns mit ihnen zumindest ein wenig verbunden fühlten und doch zu ihnen gehörten. Merkwürdig war nur, dass wir diese Gemeinschaft während unserer Aufenthalte dann keineswegs suchten.
Wir brachen auf, als wollten wir zu den vielen anderen Kindern und ihren Müttern hinuntergehen, in Wirklichkeit aber ließen wir uns am Rand des Platzes nieder, weit im Abseits, als wollten wir doch für uns bleiben. Meine Mutter setzte sich nämlich meist in eine kleine Laube, die nur als Unterstand bei schlechtem Wetter dienen sollte. Im Sommer war sie von Efeu und wild wachsenden Rosen beinahe zugewuchert, aber auch sonst ähnelte sie eher einem Versteck, in dem sich Mutter an einen kleinen, runden Tisch setzte, auf dem sie ihre Bücher und die anderen mitgebrachten Utensilien ausbreiten konnte. Selbst bei schönstem Sonnenschein setzte sie sich in diese Laube, es war, als brauchte und suchte sie diesen Schutz und als wäre es ganz und gar unmöglich, dass sie sich auf eine ungeschützte, frei stehende Bank setzte.
Dieser Rückzug führte dazu, dass auch ich mich nicht auf die anderen Kinder zu bewegte, sondern allein spielte, die anderen Kinder hatten sich daran längst gewöhnt und beachteten mich nicht mehr, als käme ich für das gemeinsame Spielen sowieso nicht in Frage.
Die Folge dieser Nichtbeachtung war, dass ich nur ein paar Minuten vor mich hin spielte, dann aber resigniert aufgab, es machte schließlich nicht das geringste Vergnügen, allein im Sand zu sitzen und mit einigen Förmchen zu spielen, die sonst niemand in die Hand nahm. Mit der Zeit führte meine Lustlosigkeit zu einer immer stärker werdenden Erstarrung, ich saß regungslos oder wie festgefroren auf dem Boden und beschäftigte mich schließlich nur noch damit, genau zuzuhören, was die anderen Mütter miteinander besprachen und wie sie ihre Kinder anredeten.
Dabei erschien es mir sehr merkwürdig, wie oft das geschah, im Grunde sprachen die anderen Mütter nämlich ununterbrochen mit ihren Kindern und sagten ihnen laufend, was sie nicht und was sie anders tun sollten. Gehorchten die Kinder nicht sofort, standen sie meist auf und fassten die Kinder an und drehten und wendeten sie hin und her, bis sie zumindest teilweise gehorchten und genau das machten, was die Mütter von ihnen verlangt hatten.
Am wichtigsten schien es zu sein, sich nicht schmutzig zu machen, die Kinder sollten zwar im Sand spielen, auf keinen Fall aber den Sand an die Kleidung bekommen, immer wieder sagte eine Mutter, dass sie nun wieder alles waschen müsse, obwohl sie doch gerade erst alles gewaschen habe, und dass dieses ewige Waschen eine Qual sei und sie noch zur Raserei bringe.