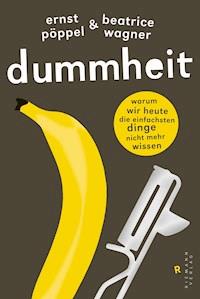Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Im Alltag sind wir selten kreativ. Wir passen uns an, erfüllen Pflichten, werden Normen gerecht. Ob im Bildungssystem, das von Pisa und Bologna reglementiert wird, oder in der Arbeit, wo Routine und Angst vor Jobverlust immer öfter in den Burn-out führen. Für das Entdecken von persönlichen Potentialen ist wenig Raum. Dabei befähigt uns das Gehirn zu so viel mehr. Ernst Pöppel und Beatrice Wagner präsentieren eine befreiende Sicht auf den Menschen: Wir sind biologisch und neurologisch auf kreative Entfaltung angelegt - in allen Bereichen unseres Lebens, von der Bewegung bis zur Erinnerung. Diese Erkenntnis kann uns helfen, unser soziales Leben positiv zu beeinflussen. So zeigen die Autoren z.B., wie man individuell lernenden Kindern gerecht wird und warum wir uns gerade in persönlichen Krisen auf das kreative Gehirn verlassen können. Ein Buch, das mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Mut macht, die eigene Kreativität zu entdecken und auszuleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Pöppel, Beatrice Wagner
Von Natur aus kreativ
Die Potenziale des Gehirns entfalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2012 Carl Hanser Verlag München
Internet: http://www.hanser-literaturverlage.de
Herstellung: Thomas Gerhardy
Covergestaltung und Motive: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-446-43286-4
ISBN (Buch) 978-3-446-43212-3
Inhalt
Vorwort
Teil 1 Vom Sinn der Kreativität
Teil 2 Bedingungen der Kreativität
Der Verlust des Ortes
Gespräche mit Gunter Henn und Isolde Zondler
Die Fülle der Wahrnehmung
Gespräch mit Igor Sacharow-Ross
Der Reichtum des Zufalls
Gespräch mit York von Heimburg
Die Beharrlichkeit der Erinnerung
Gespräch mit Hubert Burda
Der Terror der Wahrheit
Gespräch mit Julian Nida-Rümelin
Die Gelassenheit der Verwegenen
Gespräche mit Christa Maar und Maria Reinisch
Die Qual der Liebe
Gespräch mit Henryk M. Broder
Die Gnade des Vergessens
Gespräch mit Hans Magnus Enzensberger
Die Lust am Unmöglichen
Gespräch mit Kai Diekmann
Das Gute des Bösen
Gespräch mit James Giordano
Das Geschenk der Wiederholung
Gespräche mit Yan Bao und ihren Studenten und Abdulla Al Karam
Die Zeit der Gegenwart
Teil 3 Vier Milliarden Jahre Kreativität
Lebens- und Erlebensprinzipien
Die Versklavung des Bewusstseins und einige Befreiungsversuche
Komplementarität als kreatives Prinzip
Teil 4 Wissenschaftliche Kreativität in Gedichten
Warum gibt es überhaupt Gedichte?
Dichterische Spiele mit linguistischen Kompetenzen
Philosophische Themen
Vom Anfang bis zum Ende: Sex und Tod
Teil 5 Kreativität in den Augen anderer
Eine anarchistische Vorbemerkung
Kommentierte Texte von A bis Z
Dank
Gedichts- und Fotoquellen
Vorwort
Jeder Mensch ist kreativ. Das ist die Botschaft dieses Buches. Auch wenn die Kreativität ein wenig verschüttet ist, kann sie wieder hervorgelockt werden, und dann kann man wieder aus sich herauslassen, was in einem verborgen ist. Dass wir alle kreativ sind, das ergibt sich aus unserer Natur, aus unseren biologischen Anlagen. Das evolutionäre Erbe, das in jedem Menschen steckt, gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen sich kulturelle und individuelle Kreativität entfalten können.
Wie ist dieses Buch aufgebaut? Wir Autoren, Beatrice Wagner (BW) und Ernst Pöppel (EP), haben uns die Arbeit aufgeteilt, wobei jeder dem anderen über die Schulter geschaut hat. Nach einem einleitenden Kapitel, in dem wir uns Gedanken über den Sinn der Kreativität machen, folgen Berichte und Geschichten über Kreativität (BW), die ein weit gespanntes Netz unterschiedlicher Aspekte von Kreativität ausbreiten. Hinter jedem Kapitel gibt es ein oder mehrere Gespräche mit Personen, deren Kreativität uns beeindruckt; die Meinungen anderer erweitern das Bild davon, was es mit der Kreativität auf sich hat.
Es folgt eine naturwissenschaftliche Begründung der Kreativität (EP), die sich an der Evolutionstheorie orientiert. Als Kräfte, von denen die Evolution vorangetrieben wird, gelten Mutation und Selektion, also zufällige Veränderungen und eine intelligente Auswahl aus diesen Veränderungen; doch dahinter steht von Anbeginn des Lebens Kreativität als biologisches Prinzip. Das „Neue“ war immer schon mitgedacht, auch wenn es auf den ersten Stufen des Lebens ein „Denken“, wie wir es verstehen, noch nicht gab.
Nach dieser Begründung dafür, dass wir geradezu kreativ sein müssen, kommt ein Abschnitt, der überraschen mag, in dem nämlich die Kreativität von Dichtern genutzt wird, um die Grundlagen der Kreativität auf eine andere Weise anschaulich zu machen (EP): Es wird gezeigt, dass in vielen Gedichten wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt oder sogar vorweggenommen werden, und viele Gedichte unter diesem Blickwinkel zu lesen sind. Die Gedichte, die zur Veranschaulichung ausgewählt wurden, sind eher von „leichterer Natur“ – sie sollen auch Vergnügen bereiten.
Schließlich gibt es am Ende des Buches ein „Literaturverzeichnis“, aber eines ganz ungewöhnlicher Art, das eingeleitet wird mit einer zynischen Erläuterung, warum es in Büchern überhaupt solche Verzeichnisse gibt (EP). Die Werke anderer sind hier jedoch nicht nur genannt, sondern werden durch Kommentare ergänzt. So kommen weitere Perspektiven auf das Thema Kreativität zur Geltung.
Schon an dieser Stelle gilt ein besonderer Dank unseren Gesprächspartnern. Es sind dies (in alphabetischer Reihenfolge) der Direktor von KHDA (Knowledge and Human Development Authorities) in Dubai Abdulla Al Karam, die Professorin für Psychologie an der Peking University Yan Bao, der Autor Henryk M. Broder, der Verleger und Mäzen Hubert Burda, der Chefredakteur Kai Diekmann, der Dichter Hans Magnus Enzensberger, der Neurowissenschaftler James Giordano, der Vorstand des Verlages IDG in Deutschland York von Heimburg, der Architekt Gunter Henn, die Präsidentin der Felix Burda Stiftung Christa Maar, der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin, der Professor für Orthopädie Wolfgang Pförringer, der Pionier, Visionär und Psychiater Bertrand Piccard, die Kommunikationschefin für Siemens Deutschland Maria Reinisch, der russisch-deutsche Künstler Igor Sacharow-Ross und die „Seele“ des Golfclubs Beuerberg Isolde Zondler. Sie alle haben unseren Horizont darüber erweitert, was Kreativität bedeutet.
Wenn zwei Autoren an einem Buch arbeiten, dann ist nicht zu verhindern, dass sie oft an verschiedenen Orten sind. Wie wichtig Orte für die Entfaltung der Kreativität sind, das ist auch ein Thema dieses Buches. Entscheidend ist, dass man ungestört ist, und das ist merkwürdigerweise besonders dann der Fall, wenn man von vielen Unbekannten umgeben ist, sei es in einem Restaurant, in der Eisenbahn oder im Flugzeug. So saßen wir manchmal in Icking, Irschenhausen oder Beuerberg im Restaurant und die anderen Gäste wunderten sich, warum immer ein Computer dabei war. Doch das meiste wurde in der notwendigen Abgeschiedenheit erarbeitet, sei es in Icking (BW) oder in Peking (EP).
Teil 1 Vom Sinn der Kreativität
Nein, im Leben geht es nicht darum, glücklich zu sein. Das empfiehlt zwar der Dalai Lama, und die amerikanische Verfassung verspricht es. Man sollte sich aber keine Ziele wie das Glück, das Paradies oder die Liebe vorgeben, weil diese so nicht zu erreichen sind – und weil häufig über sie vergessen wird, was im Augenblick zählt. Denn oft erkennen wir erst im Nachhinein, dass etwas gut war, dass wir glücklich waren. Und dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, uns dorthin führen würde, das hätten wir in vielen Fällen nicht gedacht. Wer aber sagt: „Jetzt bin ich glücklich“, der riskiert bereits mit diesem Satz, den zauberhaften Moment vorbeiziehen zu lassen. Wer das Paradies auf Erden will, muss immer die Wünsche anderer übergehen, denn jeder hat sein eigenes Bild paradiesischer Utopien, weshalb diese oft genug mit Gewalt durchgesetzt werden wollten. Wer immerwährende Liebe fordert, überfordert den anderen, und der Wille zur Liebe wird zur Freiheitsberaubung.
Liebe und Glück sind hehre Ziele, die nur die wenigsten erreichen. Aber zum Glück wurden uns Menschen andere Hilfsmittel mitgegeben, ein gelingendes Leben zu führen. Was uns vor allem anderen ausmacht, ist das Prinzip der Homöostase: der Drang, die eigene Mitte zu entdecken, das Gleichgewicht zwischen extremen Gefühlszuständen zu finden, eine Balance zwischen zu viel Energie und lähmender Tatenlosigkeit zu halten. Das schaffen wir nur dank einer Kreativität, die jedem von uns biologisch mitgegeben ist, auch wenn sie manchmal verschüttet ist.
Was ist diese Homöostase, die hier so wichtig wird? Der Begriff aus der Medizin meint das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen und die Stabilität des Verhältnisses von Blutdruck, Körpertemperatur, pH-Wert des Blutes und Ähnlichem. Wie wir unten noch genauer erläutern werden, gehen wir davon aus, dass die Natur eine Einheit bildet, dass Biologie und soziokulturelle Lebenswelt miteinander verbunden sind. Den Begriff der Homöostase verwenden wir deshalb für ein allgemeines Lebensprinzip. Unsere Kreativität besteht nun darin, in Extremzuständen Lösungen zu finden, um die Homöostase wieder zu erreichen.
Wir sind von Natur aus kreativ, doch müssen wir auch den Mut haben, unsere Kreativität zu nutzen, sie einzusetzen. Sapere aude – „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, so schreibt Immanuel Kant 1784 in seinem berühmten Aufsatz „Was ist Aufklärung?“. Ebenso gilt: Habe Mut, deiner Kreativität zu vertrauen, und habe Mut, zu handeln – agere aude.
Icking. Ein kleines bayerisches Dorf südlich von München. Die „Nackerten“ aus der Berliner Kommune I haben hier Zuflucht gesucht, ebenso der Schauspieler Gert Fröbe. Und Rainer Maria Rilke hat hier gewohnt, im Haus Schönblick in der Irschenhausener Straße 87, von 1911 bis 1915. Die wenigen Menschen, die Icking kennen, ahnen vielleicht, dass Rilke die folgenden Zeilen mit Blick auf die wunderbare Alpensilhouette am Horizont gedichtet hat:
Berge ruhn, von Sternen überprächtigt; –
aber auch in ihnen flimmert Zeit.
Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt
obdachlos die Unvergänglichkeit.
Wir, die beiden Autoren, sitzen im Rittergütl im Ickinger Ortsteil Irschenhausen, wo auch Rilke oft hingegangen ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Molekül Sauerstoff einatmen, das Rilke vor etwa 100 Jahren hier sitzend ausgeatmet hat? Es sind weit über 90 Prozent. So ist man über die Zeiten hinweg durch die Luft und das Atmen miteinander verbunden. Auch eine Form von „Unvergänglichkeit“. Mutter Natur – oder wen immer man für die Schöpfung verantwortlich machen will – hat seit jeher für Unvergänglichkeit gesorgt.
Dies ist das Thema unseres Buches: Kreativität und Leben gehören zusammen. Von der Ursuppe, wo inmitten rein chemischer Prozesse Leben entstand, durch die gesamte Evolutionsgeschichte hindurch bis in unsere Gegenwart. Von den Einzellern bis zur angeblichen Krone der Schöpfung, von den Stammesgesellschaften bis zur heutigen Hochzivilisation.
„Jeder Mensch ist kreativ!“ Es war eine Sensation, als Joy Paul Guilford, Präsident der American Psychological Association, dies 1949 in seiner Antrittsrede sagte. Als kreativ hatte man bis dahin nur die herausragenden Persönlichkeiten der Geschichte bezeichnet. Doch das Leben an sich ist kreativ, und jeder einzelne Mensch ist es auch. Und was sind Merkmale einer kreativen Person, die für jeden gelten oder zumindest gelten können, wenn man gleichsam rauslässt, was in einem steckt? Natürlich Neugier und eine Sensitivität für ungelöste Probleme; ein ungehemmter Gedankenfluss, der sich nicht durch Banales unterbrechen lässt; die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein; die Fähigkeit, Dinge zusammenzufassen und sich nicht in Einzelheiten zu verlieren; Flexibilität, um seine Ziele zu erreichen, also nicht krampfhaft an einem Weg festzuhalten; die Fähigkeit zur Abstraktion und dazu, einen Sachverhalt analysieren zu können; eine lebendige Vorstellungskompetenz, denn häufig entwickeln sich kreative Gedanken in einer bildlichen Welt. Und was ganz wichtig ist: Man muss an sich selbst glauben, man muss unabhängig sein und man muss eine hohe Frustrationstoleranz haben, denn alles Neue wird zunächst von anderen als störend abgelehnt.
Wir sind also nicht kreativ um der Kreativität willen, sondern um unsere Ziele zu erreichen. Wir können gar nicht anders. Wir Menschen sind zum Entscheiden geboren, doch vor der Entscheidung findet im Gehirn ein häufig unbemerkter kreativer Prozess statt. Dass sich unsere Kreativität oft versteckt, heißt nicht, dass sie nicht da ist. Will man sie nutzen, muss man sie also erst „entbergen“, um einen Begriff des Philosophen Martin Heidegger zu verwenden. Wir können uns selbst entdecken, ein Ventil für unsere Kreativität finden und herauslassen, was in uns steckt. Die Methoden hierfür werden im nächsten Teil dieses Buches beschrieben.
Kreativität dient immer dazu, dass wir in unsere Mitte, zu innerer Balance, gelangen. Konkreter: Wer in seiner Arbeit frustriert ist und aufgerieben wird, sucht sich in seiner Freizeit einen Ausgleich, der idealerweise das Gegenteil von dem darstellt, was in der Arbeit verlangt wird: Motorradfahren etwa oder alpines Bergsteigen, Aktivitäten, die Konzentration auf den Moment und Selbstverantwortlichkeit erfordern. Zwischen Frust (Arbeit) und Erfolg (Risikosport) gibt es eine gedachte Mitte, ebenso zwischen Liebeskummer und Wolke sieben oder zwischen Abenteuer und Langeweile. Um diese Mitte herum rankt sich unser Leben. Und auch wenn wir gelegentlich die Extreme ausleben, so ist doch der Platz zwischen den Extremen unser Lebensbereich. Um dort immer wieder hinzulangen, benötigen wir die Kreativität, sie lässt uns Lösungen finden. Die biologisch in uns angelegte Kreativität ermöglicht erst und beschleunigt das Finden und das Erhalten unserer Mitte.
Mit diesem Buch wollen wir zeigen, dass das kreative Herstellen einer Mitte für jeden Lebensbereich gilt. Für das Denken, das Bewerten, die Bewegung, das Handeln. Ein gelangweilter Mensch öffnet Büchsen und Tüten, um sich zu sättigen. Ein kreativer Mensch stellt sich an den Herd und entdeckt die Geheimnisse der Zubereitung von frischen Lebensmitteln. Ein erschöpfter Mensch schlurft abends von der S-Bahn nach Hause. Ein kreativ-dynamischer Mensch geht mit Schwung und gönnt seinem Körper die Bewegung, die er braucht. Ein reservierter Mensch betreibt Sexualität nach dem Prinzip: Acht Minuten Missionarsstellung sind genug. Ein sinnlich-kreativer Mensch belässt es nicht dabei, sondern sucht nach neuen Ausdrucksformen für seine Lust. Und so ist es in allen Bereichen unseres Lebens. Wir sind so gemeint, kreativ zu sein, um ein ausgeglichenes Leben zu leben und zu erleben. Und wir sind nicht so gemeint, immer nur Extreme wie das höchste Glück zu erleben. Deswegen sind alle Bücher über Glück gut fürs Altpapier, aber nicht fürs Leben. Wir können für einen Augenblick glücklich gewesen sein und wir können traurig gewesen sein. Doch das Ziel des irdischen Seins liegt in der Mitte, trotz oder sogar mithilfe glücklicher und trauriger Momente.
Diese notwendige und uns aufgegebene Mitte ist natürlich individuell verschieden und immer auch von den Situationen abhängig, an die wir uns anpassen (oder auch nicht). In der Biologie kennzeichnet die Homöostase das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen und ist genau definiert – in Bezug auf die Psyche jedoch ist sie nicht normiert. Jeder Mensch hat seine eigene Mitte zwischen extremen Gefühlen und Zuständen. Dahinter verbirgt sich ein weiteres Prinzip des Lebens: Wir haben zwar unsere vorgegebenen Muster, nach denen wir leben, aber wir sind auch dazu in der Lage, diese an die realen Umstände anzupassen. Der Sollwert richtet sich nach dem Ausgangswert. Wer krank ist, entwickelt andere Ziele, als der, der gesund ist. Und so kann der Kranke, der seine (heruntergeschraubten) Ziele erreicht, lebenszufriedener sein als der Gesunde, der seine (hochgesteckten) Ziele verfehlt.
Die Natur war schon kreativ, als sie aus der Ursuppe das Leben erschuf. Wie dies geschah und warum, das versteht kein Mensch, außer jenen Gläubigen aus Religion und Wissenschaft, die mit dem Anspruch auftreten, für alles eine Erklärung zu haben. Aus dem einfachen Einzeller heraus entfaltete sich die ganze unfassbare Natur, mitsamt Rilke und seinen Gedichten und Gottfried Benn, der dieses Prinzip des Lebens wiederum in einem Gedicht zur Ursuppe beschrieben hat. Überhaupt tritt in Gedichten viel verborgene Wissenschaft zutage, in ihnen versteckt sich oft das Wissen der Naturforscher oder kündigt sich an. Künstler können Sinnschöpfer, Wissensschöpfer sein, die aufdecken, was dem rationalen Verstand erst nach anstrengender Reflexion bewusst wird.
Gottfried Benn: Gesang I
O daß wir unsere Ururahnen wären.
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor.
Leben und Tod, Befruchten und Gebären
glitte aus unseren stummen Säften vor.
Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel,
vom Wind Geformtes und nach unten schwer.
Schon ein Libellenkopf, ein Möwenflügel
wäre zu weit und litte schon zu sehr.
Die Natur wirkt kreativ, indem sie Zustände in der Zeit von früher für später in Form von Erbsubstanz gleichsam einfriert und somit Erfahrungen für die Zukunft festhält. Das konnte schon die Urbakterie und das können wir. Über Jahrmilliarden hat sich dieses Prinzip gehalten, und zwar ohne dass die Natur weiß, ob ihr das Eingespeicherte später einmal von Nutzen sein wird. Wir sammeln Erfahrungen wie Eichhörnchen Nüsse – ob die Nager sie jemals wiederfinden werden, wissen sie nicht. Im genetischen Speicher bilden sich aus den aufbewahrten Erfahrungen die Möglichkeiten zu neue Kombinationen. Und auch das entspricht einem Grundprinzip der Kreativität: Je mehr Erfahrungen, desto mehr Möglichkeiten, neue Wege zu gehen und neue Ideen zu entwickeln. Dies kennzeichnet übrigens auch einen Vorteil des Alters gegenüber der Jugend. Unerfahrenere Menschen haben allerdings die Möglichkeit, unkonventionell in alle Richtungen zu denken. Dieses „wilde Denken“ ist aber zumeist noch kein kreativer Prozess. Kreativität entfaltet sich immer auf der Grundlage von realen Gegebenheiten.
Auch wird Kreativität manchmal mit Innovation verwechselt. Kreativität ist eine persönliche Angelegenheit, denn das einmalig Neue kann immer nur einem Gehirn entspringen. Auch wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, etwa in einem Think Tank, dann mag die Gruppe die Bedingung dafür sein, dass jemandem etwas einfällt, aber es fällt immer einem Einzelnen ein. Eine Innovation dagegen ist ein soziales Gebilde: Ein kreativer Gedanke kann noch so genial sein, doch erst in Relation zu den Ideen anderer kann er eine Innovation sein. Und wenn er schließlich an die Öffentlichkeit gelangt und von anderen aufgenommen wird, dann gelten andere Gesetze, insbesondere Marktgesetze, wenn es um neue Produkte oder Dienstleistungen geht.
Machen wir uns also auf die Reise durch die Lande der Kreativität. Welches sind die Bedingungen dafür, dass wir kreativ sind oder sein können? Was mag unserer Kreativität, die in jedem steckt und aus jedem heraus will, im Wege stehen? Was meinen andere über ihre Kreativität, die sie durch ihr Lebenswerk beweisen und bewiesen haben? Wie konnte sich Kreativität überhaupt in uns entfalten, was also sind die Vorgaben unseres Gehirns, das auf eine Geschichte von einigen Milliarden Jahren zurückblicken kann? Wie äußert sich wissenschaftliche Kreativität, an die Autoren vielleicht gar nicht gedacht haben, in ihren Gedichten? Aus allem, was um uns und in uns geschieht, was sich unserem Bewusstsein zeigt und anderen sichtbar wird, aus allem können neue Wege der Kreativität entstehen. Man muss sie nur gehen.
Teil 2 Bedingungen der Kreativität
Der Verlust des Ortes
Warum ein Ort mit durchlässigen Grenzen wichtig ist
Es braucht gute Randbedingungen für Kreativität. Wenn wir uns anschauen, wie eine Zelle organisiert ist, sehen wir, dass ihre Grenzen halb durchlässig sind: Sie sind offen für manches, was sie von außen brauchen, und undurchlässig für manches, was nicht wieder hinaus soll – ein Vorbild für die Gestaltung von Arbeitsplätzen.
Als Herr K. an diesem Tag zur Arbeit kam, war alles anders. An den Eingangstüren seines Bürotowers prangte ein neues Firmenschild mit dem Zusatz: „Zukunftsbetrieb 3000. Ausgezeichnet nach DIN …“, und es folgte eine fünfstellige Ziffer, die Herrn K. nichts sagte. Die Empfangsdame erklärte geschäftsmäßig, dass er nun kein eigenes Büro mehr besitze. Aber mit dem Transponder, den sie ihm überreichte, könne er jeden Büroraum in seiner Abteilung öffnen. Und die PIN-Nummer auf dem Zettel sei für den Laptop und das Telefon. Seinen früheren Computer könne er nicht mehr benutzen, der sei sowieso veraltet gewesen. Nun sei alles modernisiert, man habe im ganzen Tower nur noch geleaste Laptops, die jedes Jahr erneuert werden. Doch selbstverständlich sei sein Account unberührt. Wenn er mit dem Transponder ein Büro betrete und mit der PIN-Nummer das Telefon entsperre, werden Anrufe, die für ihn bestimmt sind, automatisch an diese Nebenstelle geleitet. Es sei ganz einfach. Dann drückte sie ihm noch einen Briefumschlag in die Hand und wünschte ihm einen schönen Arbeitstag.
Herr K. war platt. Drei Wochen Urlaub, und jetzt das. Erst mal einen Kaffee, um die Gedanken zu ordnen. Zumindest der Automat stand noch an der alten Stelle. Im Umschlag, den ihm die Empfangsdame gegeben hatte, war ein Anschreiben seines Chefs: „Wir haben festgestellt, dass unsere Mitarbeiter 70 Prozent ihrer Arbeitszeit nicht in ihren Büroräumen verbringen. Sie halten Meetings ab oder sind auf Kongressen, haben Urlaub oder befinden sich in der Kaffeepause. Und zehn Prozent sind immer auf der Toilette. Deswegen haben wir nach der Gleitzeit nun auch die ‚gleitenden Büroräume‘ eingeführt. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie sich in jedem Büroraum niederlassen können, der frei ist. In Stoßzeiten müssen Sie damit rechnen, dass alle Büros belegt sind. In einem solchen Fall können Sie jederzeit in eine der Arbeitslounges ausweichen und dort einen Einzelarbeitsplatz belegen.“
Herrn K. fiel ein, dass auf seinem alten Schreibtisch noch Fotos von seiner Frau und seinen Kindern gestanden hatten. Und in den Schubladen lagen Aspirin, eine Packung Zigaretten, weil ihm seine Frau zu Hause das Rauchen untersagte, und aus ähnlichen Gründen eine Packung Kondome. Was war damit? „Ihre Sachen haben wir unter Aufsicht eines Juristen in einer abschließbaren Box verstaut, diese händige ich Ihnen heute bei Feierabend aus“, schnurrte die Empfangsdame mechanisch. Wahrscheinlich hatte sie das in den letzten Tagen schon mehrere Hundert Mal erklärt. Dass seine persönlichen Dinge, die wenigen, die er im Büro hatte, von anderen einfach angefasst und zusammengepackt worden waren, traf Herrn K. mehr als die Umorganisation seines Büros. Ihm kamen die Bilder von einer kürzlich stattgefundenen Kernreaktor-Katastrophe in den Sinn. Die Arbeiter im zerstörten Kraftwerk hatten alles Persönliche abgelegt und Schutzkleidung angezogen, eine Gasmaske, Schutzanzug, -schuhe und -handschuhe. Keiner war mehr vom anderen zu unterscheiden gewesen. Nicht mehr wie Individuen sahen sie aus, sondern wie austauschbare Arbeitsroboter. Und genau so fühlte sich Herr K. Er nahm seine Utensilien und ließ sich einen freien Raum zuteilen. Endlich am Schreibtisch, loggte er sich in seinen Account ein. Er blickte lange auf die Datenketten auf seinem Bildschirm. Doch an diesem Tag wusste er damit einfach nichts anzufangen.
Aus Sicht der Hirnforschung verständlich. Wir sind von Natur aus ortsverankerte Wesen. Wir brauchen für die Entfaltung unserer Möglichkeiten Sicherheit, und diese Sicherheit wird uns dann gegeben, wenn wir uns irgendwo heimisch fühlen. Da viele einen großen Teil ihrer Zeit in einem Büro zubringen, ist das ebenfalls ein Ort, an dem wir uns heimisch fühlen könnten und es intuitiv auch wollen. In einem neuen Arbeitsraum breiten wir häufig zuerst die persönlichen Dinge aus, und seien es nur die eigene Kaffeetasse und ein Foto. Damit wird ein Revier in Besitz genommen, der Raum wird zu einem persönlichen Ort, zu einem Bezugspunkt, von dem aus man lebt und handelt.
Der geschützte Raum ermöglicht eine Erweiterung unserer Innenperspektive, aus der heraus wir die Welt betrachten. Indem wir persönliche Sachen um uns herum verteilen, erweitern wir sozusagen unser Inneres. Der Schreibtisch, der Laptop, die Bilder und Bücher um uns herum sind Teile unserer selbst und helfen, uns am Arbeitsplatz heimisch zu fühlen. Der japanische Hirnforscher Atsushi Iriki hat dies einmal an Makaken beobachtet. Die Gehirnstruktur dieser kleinen Affen ist der von uns Menschen sehr ähnlich. Wenn ein solcher Makake versuchte, mit einem Stöckchen an ein Leckerli zu kommen, wurden interessanterweise dieselben Hirnareale aktiviert, wie wenn er mit den Pfoten danach griff. Das Stöckchen wurde also zum erweiterten „Selbst“.
Dieses erweiterte Selbst aber wird wieder auf uns alleine eingeschränkt, wenn wir nur einen leeren, austauschbaren Büroraum zugewiesen bekommen. Um uns dort heimisch zu fühlen und dort anzuknüpfen, wo wir am Tag zuvor die Arbeit unterbrochen haben, brauchen wir in diesem fremden Raum erst einmal eine Anlaufzeit. Der Büroraum ist zunächst anonym, wir blicken auf ihn als etwas, was außerhalb unserer selbst ist, mit dem wir uns aber nicht identifizieren. Will man also erreichen, dass sich jemand mit seiner Arbeit identifiziert, sollte man ihm eine Ausweitung der Innenperspektive ermöglichen. Dies gilt für Büroräume, aber auch für entindividualisierte enge Arbeitsplätze wie in einer Fabrik oder auf einem Schiff. Dort wird der eigene Spind zum kleinen Wohnzimmer, zum Hort der Individualität.
Kreativität gedeiht aber nicht nur an einem individuellen Ort, sondern auch an öffentlichen Plätzen. Ein besonders plakatives Beispiel dafür, dass man kreativ sein kann, wenn Menschen um einen herum sind und man von einem permanenten Geräuschteppich umgeben ist, ist der Erfolg der Autorin Joanne K. Rowling. Als alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter lebte sie von Sozialhilfe, als sie am ersten Band von „Harry Potter“ arbeitete. „So machte ich mich in einem regelrechten Rausch an die Arbeit, weil ich unbedingt das Buch beenden und zumindest versuchen wollte, es veröffentlichen zu lassen. Wenn Jessica in ihrem Kinderwagen einschlief, eilte ich stehenden Fußes ins nächste Café und schrieb dort wie eine Wahnsinnige.“ (Nachzulesen in der Biografie auf ihre Website. Auch in einem Interview gab sie einmal bekannt, ihr liebster Schreibort sei das Café Nicholson’s in Edinburgh.)
Ein öffentlicher Platz als liebster Ort zum Schreiben? Ein Café als Ort der Kreativität? Ja, denn auch die Isolation, das Abschotten von sinnlichen Eindrücken, lässt kreative Potenziale ungenutzt. Das Gehirn braucht Anregungen von außen zur Förderung der Kreativität. „Trigger“ wie Geruch, Gehörtes und Alltagsszenen sind geeignet, um Erinnerungen wachzurufen und neue Ideen anzuregen. Untersuchungen haben gezeigt: Der Blick auf eine belebte Straße lässt die Gedanken leichter fließen als der Blick ins Grüne. Denn das Straßenleben wirkt belebend, das Grüne beruhigend. Man benötigt zum Denken ein erhöhtes Aktivierungspotenzial des Gehirns. Dafür ist das Arbeiten im Cafe optimal. Man kann sich zugehörig fühlen, ist Sinneseindrücken ausgesetzt und wird dennoch nicht gestört. Die Umgebung von anderen Menschen beinhaltet außerdem eine psychische Komponente. Beim Schreiben im Café wie bei Rowling, aber auch beim Arbeiten im ICE stellt sich das Gefühl ein, dass andere im Fall des Falles da seien und man sich mitten in einem sozialen Netz befinde. Und gleichzeitig kann man sich abschotten, denn die unbekannten Menschen in der direkten Umgebung treten nicht als Individuen in Erscheinung und kommunizieren nicht direkt mit einem, sie stören also nicht. – Der Mensch lebt von Paradoxien.
Austausch und Durchlässigkeit – das ist ein naturgegebenes Prinzip von Kreativität und in der Natur zu beobachten. So sind etwa die Wände einer lebendigen Zelle ebenfalls nicht starr und schließen die Welt draußen nicht vollkommen von der Welt im Zellinnern ab. Sie sind semipermeabel: Sinnvolle Stoffe werden hineingelassen, andere nicht. Dies ist die Funktionsweise der Osmose, ein Vorgang, der für viele regulative Abläufe in der Natur von Bedeutung ist.
Auch in vielen Büros findet Osmose statt, nämlich dann, wenn die Zimmertüren geöffnet bleiben, zumindest temporär. Gespräche finden dann nicht im Refugium des einen oder des anderen statt, sondern entstehen im Türrahmen. Will man die Interaktion mit anderen fördern, sodass sich kreative Prozesse entfalten können, spielt auch die Gestaltung der Räume oder eines Gebäudes eine maßgebliche Rolle. Bereits ein anderes Stockwerk hindert daran, mit anderen in einen kreativen Kontakt zu treten. Kreativität findet in einem Radius von etwa 50 Metern statt, und dies auf einer einzigen räumlichen Ebene. Eine gelungene Architektur, die Kreativität anregt, muss also von der Innenperspektive des Menschen ausgehen und gleichzeitig den „osmotischen“ Kontakt zu anderen ermöglichen. Übereinandergetürmte Räume in einem Bürotower isolieren die Menschen voneinander, und durch fehlenden Kontakt zu anderen bleiben kreative Potenziale ungenutzt.
Das Prinzip der Kreativität ist eine unglaubliche Leistung der Natur, und was sich in der Natur bewährt, das wird immer wieder angewandt. Dies schlägt eine Brücke zwischen den molekularen und den sozialen Prozessen, weshalb die Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit einer Zelle und eines Büroraumes vom Prinzip her gleich sind.
Die Beispiele der Zelle und der Büroräume verdeutlichen also zwei Grundvoraussetzungen dafür, unsere Kreativitätspotenziale zu entfalten: die Ruhe und Entfaltungsmöglichkeit einerseits und der Kontakt und Austausch mit anderen andererseits. Kreativität findet zwischen den extremen Polen Isolation und Integration statt. Oder, psychologisch betrachtet: zwischen Introversion und Extraversion. Dies mögen als aktuelles Beispiel die fehlgeschlagenen Ermittlungen bei den Morden des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU), auch kolportiert unter „Zwickauer Zelle“, verdeutlichen: Der fehlende kommunikative Austausch zwischen den einzelnen Strafverfolgungsbehörden – auch eine Art von Zellen – verhinderte, dass Kreativität sich entfalten und man zu Ergebnissen und einem Gesamtbild kommen konnte. Die terroristische Neonazi-Zelle NSU hingegen spielte bloß ein (destruktives) Programm ab – dafür allerdings war die Isolation sogar förderlich.
Aus der Biologie ist der Ausgleich zwischen zwei Extremen als Homöostase bekannt. Wir sind von vorneherein in ein genetisches Programm eingebettet, das Stoffwechsel, Körpertemperatur, Blut- oder pH-Werte nur im „mittleren“ Bereich funktionieren lässt – jeder Ausschlag zu einem Extrem hingegen ist äußerst ungesund. Auch im sozialen Umfeld versuchen wir immer, die richtige Position zu finden, die weder zu extrem in die eine Richtung geht, noch zu sehr in die andere. Nach einer öden Bürowoche wollen wir am Wochenende etwas erleben; wenn eine Woche aber sehr aufregend war, suchen wir am Wochenende eher Ruhe und Erholung. Um den Ausgleich herzustellen und die Lebensumstände entsprechend zu gestalten, brauchen wir Kreativität. Das ist ein Sinn von Kreativität, der sich durch das ganze Buch zieht, und dem wir in immer unterschiedlichen Umständen begegnen. Kreativität ist das Werkzeug, mit dem wir uns an die Herausforderungen der Welt anpassen können.
Wissen es viele Unternehmen also nicht besser? Ist eine Infrastruktur, die Kreativität behindert, nicht kontraproduktiv und schränkt schlussendlich die Gewinnmarge ein? Und berauben Unternehmen ihre Mitarbeiter tatsächlich nur aus Unwissenheit der Grundlage für Kreativität? Auf der Führungsebene wird die Kreativität der Mitarbeiter oftmals als Hindernis für die Funktionsfähigkeit und damit die Produktivität eines Unternehmens betrachtet. Denn Kreativität beinhaltet auch Unvorhersehbares, und das ist für die Linie eines Unternehmens nicht immer gewünscht. Doch durch die Beseitigung von Kreativität entstehen neue Probleme: Wer nicht mehr das Gefühl hat, innerhalb seines Bereichs eigenverantwortlich entscheiden zu dürfen, sondern Aufgaben nur noch abarbeiten muss, der steuert auf Frustration und Burn-out zu. Kreative Arbeit ist immer auch erfüllende Arbeit, für die sich Mitarbeiter gerne engagieren. Doch dafür müssen sie Aufgaben zu Ende bringen dürfen, erst dann kann sich ein Belohnungsgefühl einstellen: das Gefühl, dass uns etwas gelungen ist.
Wir müssen also Büroräume, Arbeitsplätze oder andere Begegnungsstätten kreieren, welche uns optimal arbeiten und denken lassen. Dazu meldet sich nun Stararchitekt Gunter Henn zu Wort, dessen Aufgabe es ist, in großem Stil Bauten zu erschaffen, in denen die Kreativität Fuß fassen kann, von Forschungszentren und Hochschulgebäuden über Ausstellungsräume bis hin zu Bürogebäuden. Anschließend erläutert Isolde Zondler, die zusammen mit ihrem Mann Urs Zondler einen der schönsten Golfclubs in Deutschland mit einem vorzüglichen Restaurant betreibt, ihre persönlichen Erfolgsrezepte.
Ich spüre, wenn etwas perfekt ist
Ein Gespräch mit Gunter Henn
Gunter Henn – einer der Großen unter den Architekten: In München hat er zusammen mit seinem Team das Projekthaus im Forschungs- und Innovationszentrum von BMW entworfen, für Volkswagen die Autostadt Wolfsburg und die Gläserne Manufaktur Dresden, sowie viele weitere maßgebliche Gebäude für Wissenschaft und Industrie. Er prägt das Erscheinungsbild ganzer Stadtteile, vor allem auch in China. Er hat eine Vielzahl an Architekturpreisen gewonnen, er lehrt am Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA) und ist Inhaber der Professur für Industriebau an der Technischen Universität Dresden. Architektur ist für ihn eine Antwort auf die Bedürfnisse eines Bauherrn: Welche Art von Gemeinschaft soll entstehen, welche Kommunikations- und Kooperationsform sich entwickeln? Dafür werden kreativ ästhetische und nützliche Lösungen gesucht. Ein Besuch bei ihm in der Münchner Augustenstraße.
Wagner: Sie arbeiten in einem Feld, in dem sowohl Nützlichkeit als auch Ästhetik eine große Rolle spielen. Was ist eigentlich „Ästhetik“ – und wie wirkt sie?
Henn: Je nach Kultur gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen von Ästhetik, aber dennoch gibt es eine Grundübereinstimmung: Überall geht es um Ausgewogenheit, von oben und unten, eng und weit, der faktischen Ordnung. So entstehen Symmetrien. Diese sind etwas Universales in der Natur, sie reichen von Bäumen über Blüten und Schneckenhäuser bis hin zum Antlitz des Menschen.
Wagner: Machen nicht auch Abweichungen etwas schön?
Henn: Doch, genau, das ist das nächste Prinzip. Eine vollkommene Wiederholung ist langweilig. Symmetrie bedeutet auch nicht die Wiederholung des Gleichen, sondern ein Gleichgewicht der Formen.
Wir kennen verschiedene Symmetrien. Zunächst einmal gibt es die Grundrisssymmetrie, die uns Halt gibt, zum Beispiel in der Längsrichtung einer Basilika. Dann haben wir die vertikale Symmetrie: Betrachten Sie einmal den Barcelona-Pavillon, den Mies van der Rohe für die Weltausstellung 1929 entworfen hat. Hier erfassen wir den Grundriss nicht mit einem Blick, aber dafür werden Boden und Decke durchgängig gespiegelt, auch das gibt Halt, denn auf halber Raumhöhe entsteht eine Symmetrieachse. Im Guggenheim-Museum in New York wiederum liegt eine Drehsymmetrie vor. Das Drehzentrum bildet den Mittelpunkt, nach der Drehung um einen gewissen Winkel sieht die Figur wieder genauso aus wie zuvor. Wahrscheinlich würden wir uns dauerhaft in unsymmetrischen Umgebungen nicht wohlfühlen. Wir haben ein Bedürfnis nach einem gewissen Maß an Symmetrie.
Pöppel: Unsere Vorstellungen von Ästhetik wandeln sich. Worin liegt dies begründet?
Henn: Wir haben ein Bedürfnis nach Veränderungen. Unsere heutige Gesellschaft ist nicht mehr feudal überwölbt, sodass nur ein Stil vorherrscht. Vielmehr hat sich eine Gleichzeitigkeit von Unterschieden herausentwickelt. Diese kann entweder über viele Jahre hinweg entstehen, sie kann aber auch schlagartig hergestellt werden, weil wir Funktionen koppeln möchten. Betrachten Sie das Konzept eines Flughafens: Es muss die Funktionen „Taxi fahren“, „shoppen“ und „fliegen“ koppeln, wie es Soziologe Armin Nassehi ausgedrückt hat, und beinhaltet deshalb eine Gleichzeitigkeit von Unterschieden. Gleichzeitigkeiten nehmen heute zu, und dies wird häufig als Verunsicherung erlebt. Architektur hat dann die Aufgabe, Instabiles in eine Stabilität zu überzuführen, ohne die Unterschiede zu leugnen. Aus diesem Grund spricht man auch von der „Architektur“ eines Friedensabkommens oder von einer „Sicherheitsarchitektur“.
Pöppel: Können Sie Ihre Projekte frei gestalten, sofern Sie die anthropologischen Universalia berücksichtigen, also das, was alle Menschen als schön empfinden?
Henn: Nicht ganz, denn es gilt, auch die kulturellen Spezifika zu berücksichtigen. In China werden immer mehrere Häuser eng aneinander gebaut. In einem vereinzelten Haus würden sich die Menschen nicht wohlfühlen und dort wohl gar nicht erst einziehen. Die Straße als solche ist in China eher ein Unraum, für uns hingegen bedeutet sie auch öffentliches Leben. In Japan wiederum müssen die Gebäude voneinander getrennt stehen, da steckt ursprünglich der Brandschutzgedanke dahinter. Heute ist es zu einer sozialen Tatsache geworden. Weitere Besonderheiten, auf die wir Rücksicht nehmen muss, sind klimatische Bedingungen. In heißen Ländern etwa sind kleine Fenster wegen der Sonneneinstrahlung funktional.
Wagner: Kann man den ästhetischen Sinn trainieren?
Henn: Wenn man früh damit beginnt, und wenn man dies anwendungsbezogen macht. Deshalb sollte es Architektur als Schulfach geben, um an diesem Gegenstand etwas über Farben, Ästhetik und Haptik im Allgemeinen zu lernen. Doch im ganzen Bildungsprozess fehlt die Erkenntnis, dass man das Schöne herstellen kann.
Pöppel: Wie merken Sie, dass ein Entwurf geglückt ist?
Henn: Ich ahne während des Entwickelns, ob der Entwurf etwas Besonderes wird oder nicht. Das Besondere ist dann geglückt, wenn verschiedene Betrachtungsmuster übereinander passen und die Dinge nicht nur aus einer Perspektive, sondern aus mehreren erklärt werden können. Und es ist etwas Besonderes, wenn sich verschiedene Aspekte in einer ähnlichen Ästhetik darstellen, wenn eine Idee vom großen bis zum kleinen Maßstab durchgängig erkennbar ist. Ich spüre, wenn etwas perfekt ist. Dem kann man sich nicht entziehen. Es ist dann da, Dopamin pur. Manchmal zögere ich die Vollendung heraus, um auch das Glücksgefühl hinauszuzögern.
Pöppel: In der Wissenschaft ist man dreimal frustriert oder dreimal beglückt. Zunächst macht man ein Experiment, das ist der größte Rausch, etwas verstanden zu haben. Dann schreibt man es auf, es muss dokumentiert werden. Damit ist man dann einigermaßen zufrieden. Die dritte Stufe ist dann erreicht, wenn andere es rezipieren.
Henn: Das ist in der Architektur ähnlich. Als wir den Auftrag erhielten, für Volkswagen mitten in Dresden eine gläserne Manufaktur zu errichten, erlebten wir den ersten Rauschzustand. Die Idee war zunächst unvorstellbar, aber wir ahnten, dass es irgendwie gehen wird. Der zweite Höhenrausch stellte sich ein, als wir die Lösung dafür fanden, wie das Gebäude den räumlichen Anforderungen entsprechen könnte. Und natürlich ist es beglückend, wenn jetzt, zehn Jahre später, noch immer darüber berichtet wird.
Wenn alle gern hier arbeiten, überträgt sich das auf die Gäste
Ein Gespräch mit Isolde Zondler
So manche Seite dieses Buches ist im Golfrestaurant Beuerberg entstanden. Ein – wie wir finden – magischer Ort, auf einem Hochplateau gelegen, vor 40 Kilometern unverbauter Alpenkulisse. Trotzdem fragen wir uns, warum dieser Ort offenbar besonders kreativitätsanregend ist.
Wagner: Frau Zondler, ich spiele zwar kein Golf, aber ich habe schon häufiger Ernst Pöppel hierher begleitet, er dreht dann eine Runde auf dem Golfplatz, ich bearbeite währenddessen meinen Laptop, und anschließend tragen wir bei einem gemeinsamen Essen unsere geistigen Ergüsse zusammen. Der Ort scheint sich anregend auf die Kreativität auszuwirken. Beobachten Sie das häufiger?
Zondler: Hier werden viele Kontakte geknüpft, Ideen geboren und Geschäftsabschlüsse getätigt, auch wenn ich das natürlich nicht alles im Einzelnen mitbekomme. Auf jeden Fall weilen die Gäste lange bei mir, und sie kommen nicht nur, um Golf zu spielen.
Pöppel: Hier wird das Konzept der Syntopie verwirklicht. Dieser Kunstbegriff besagt, dass unterschiedliche Zeiten und Kulturen an einem Ort zusammengebracht werden. Wenn sehr unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Bereichen oder Kulturen zusammentreffen und einen Rahmen finden, um sich auszutauschen, entsteht zwangsläufig etwas Neues. Deswegen ist das für mich ein kreativer Ort.
Wagner: Dann müssten wir jetzt herausbekommen, worin das Geheimnis der Begegnung besteht. Der Architekt Gunter Henn hat uns erzählt, dass es beim Design von privaten Innenräumen darum geht, ein Nest zu gestalten und Sicherheit zu vermitteln. Und gemütlich ist es hier ja.
Zondler: Wir haben einen zeitlosen, edlen Landhausstil, der vermittelt in der Tat etwas Beständiges, ohne altmodisch zu sein. Die Terrasse ist mit den vielen Blumen natürlich sehr romantisch. Für mich gilt: lieber etwas opulenter als zu nüchtern. In ein cooles, ungemütliches Restaurant würde ich niemals gehen. Ich brauche außerdem ein schönes Licht, wenn möglich auch noch schöne Musik dazu. Vielleicht tragen all die vielen Sinneseindrücke zur Kreativität bei?
Pöppel: Ein kreativer Ort ist sicher ein Gesamtkunstwerk. Auch die Atmosphäre ist entscheidend. Dazu gehört, dass Hausherrin oder Hausherr wirklich präsent sind. Dass sie oder er durch die Räume schreitet, die Gäste willkommen heißt. Man muss den Eindruck haben, dass Patron und Patronin alles im Blick haben und ihnen keine Einzelheit entgeht – und dass sie gerne an diesem Ort sind.
Zondler: Genau so handhaben wir es. Mein Mann und ich gestalten alles so, dass wir und unser Team uns auch selbst wohlfühlen, denn wir verbringen ja die meiste Zeit des Lebens hier. Und wenn alle gerne hier arbeiten, überträgt sich das auf die Gäste. Wir schaffen einen äußeren Rahmen, damit sich die Kreativität anderer entfalten kann, und hierfür setzen wir unsere eigene Kreativität ein. Das ist vielleicht das ganze Geheimnis.
Die Fülle der Wahrnehmung
Wie das Gehirn unsere Sinneswahrnehmungen verändert
Kreativität basiert auf wahrgenommenen Informationen. Sinnesorgane bilden „mittige“ Wahrnehmungen, um damit sensibler für Abweichungen zu sein. Experteist, wer einen inneren Maßstab entwickelt und damit eine hohe Sensibilität hat. Dies ist oft bei Künstlern der Fall, aber manchmal auch bei deren Vätern, wie die folgende Erzählung beweist.
Auguste beim Lesen zuzuhören war eine Qual. Schriftstücke von ihm: eine Katastrophe. „Zu viele Fehler, er muss mehr lernen, mit mehr Disziplin“, meinten seine Lehrer. Doch sein Vater war anderer Meinung. „Der Junge kann nicht richtig lesen und schreiben, aber er kann etwas anderes. Er hat ein gestalterisches Talent.“ Er nahm seinen 14-jährigen Sohn Auguste wieder aus dem Internat, wo er „unter denen leidet, die ihn mit Fremdheit und Rücksichtslosigkeit umgeben“. Stattdessen ermöglichte er ihm etwas anderes: Sein Sohn „lernt in einer kleinen Zeichenschule zuerst den Ton kennen, den er am liebsten nicht wieder aus den Händen ließe: so sehr sagt dieses Material ihm zu.“ Auguste wuchs heran und wurde zu dem weltberühmten Mann, dessen Biografie der Dichter Rainer Maria Rilke, von dem die beiden obigen Zitate stammen, wie folgt begann: „Rodin war einsam vor seinem Ruhme. Und der Ruhm, der kam, hat ihn vielleicht noch einsamer gemacht.“
Doch hier soll es zunächst gar nicht um den französischen Bildhauer Auguste Rodin gehen, sondern um seinen Vater. Der arbeitete als Beamter in der Polizeiverwaltung und bemerkte früh, dass sein Sohn offenbar an einer Störung litt, die heute als Legasthenie bekannt ist, damals aber noch gar nicht erforscht war. Und er spürte Augustes Kunstbesessenheit. Er nahm sowohl die Stärken und als auch die Schwächen seines Sohnes in den Blick, um dann nach einem Weg zu suchen, ihm zu helfen. Vor seinem kreativen Handeln stand also die Wahrnehmung.
Verschiedenste Sinnesorgane geben uns Auskunft über die Welt. Der ursprünglichste Sinn ist das vestibuläre System, das unser Gleichgewicht steuert und uns auf der Welt stehen lässt. Der für uns wichtigste Sinn ist der visuelle, 80 Prozent der sinnesverarbeiteten Neuronen im Gehirn sind mit ihm beschäftigt. Aber alle Sinnesorgane verrichten Dienstleistungen, um uns an die Welt anzubinden und uns Orientierung darin ermöglichen. Bei Tieren ist dies ebenso, aber Menschen ist ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung in stärkerem Maße als anderen Lebewesen bewusst. Sie haben, wie man in der Psychologie sagt, eine „Theory of Mind“, eine Theorie darüber, wie der Geist funktioniert, und damit auch die Fähigkeit, sich in Gefühle, Situationen, Denkweisen und Wahrnehmungen anderer Personen hineinzuversetzen. Mit der Fähigkeit, eine Außenperspektive zu sich selbst zu entwickeln, geht einher, dass wir die Welt nicht nur hinnehmen, sondern sie wahrnehmen. Darin, dass wir uns unserer Wahrnehmungsfähigkeit bewusst werden, liegt der Ursprung von Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, es beginnt eine Art Wahrnehmungskreislauf: Ich nehme wahr, nehme wahr, dass ich wahrnehme, und nehme dann umso intensiver wahr. Auf die Wahrnehmungen erster Stufe reagieren wir zunächst. Die durch Achtsamkeit gesteigerte Wahrnehmung ist jedoch Grundlage für einen noch reichhaltigeren Input an Informationen durch die Sinnesorgane, und diesen können wir kreativ verwenden.
Damit sind wir wieder bei Rodin angelangt. Denn die Achtsamkeit für das Wahrnehmen der Umwelt lässt sich steigern. Künstler zeigen uns ein anderes Bild von der Welt als das von uns flüchtig wahrgenommene. Rodin war in einer besonderen Weise kreativ: Er löste sich vom vorherrschenden überhöhten Schönheitsideal in der Kunst und erhob das Unfertige in der Kunst zum Prinzip. Für diese Sicht auf die Welt nahm er auch Anfeindungen und Rückschläge in Kauf. Aber nicht nur Künstler, sondern Wissenschaftler können die Welt in einer besonderen Weise wahrnehmen, neue Zusammenhänge herstellen und dies kreativ veranschaulichen. Während der Bildhauer in einer Skulptur seine Sicht auf die Welt darstellt, gelingt dem Wissenschaftler dies vielleicht in einer neuen mathematischen Formel. Das dahinterstehende Prinzip ist jedoch dasselbe. Und es gilt auch für den privaten Bereich einer jeden Person, was Tagebucheinträge, die Facebook-Pinwand, Urlaubsfotos oder erzählte Anekdoten beweisen.
Was aber sind die Grundvoraussetzungen der Wahrnehmung? Wie funktioniert sie? Die im westlichen Kontext übliche Vorstellung ist das Prinzip des Bottom-up. Angewandt auf das Sehen besagt es, dass wir Einzelheiten wahrnehmen, die wir dann zu einem Bild komponieren. Wie die einzelnen Elemente aus dem Sehraum herausgefiltert und dann zusammengesetzt werden, entdeckten David Hubel und Torsten Wiesel, wofür sie 1981 den Nobelpreis erhielten. Allerdings konnten bis heute weder Hubel und Wiesel noch andere Neurobiologen erklären, nach welchem Prinzip das „Binding“ – das Zusammensetzen der Einzelheiten zu einem Bild – funktioniert. Es fehlt im Modell ein Element, mit dem die Einzelheiten zu einer Gestalt verschmelzen.
Fast zur gleichen Zeit, im Jahr 1982, wurde im asiatischen Raum ein zum Bottom-up-Prinzip konträres Wahrnehmungsmodell entwickelt, das auf den chinesischen Wissenschaftler Lin Chen zurückgeht. Nach ihm ist der erste Schritt einer Wahrnehmung nicht die lokale Analyse von Details, sondern das Herausfiltern von zunächst großräumigen Faktoren, wie Flächen, Kanten oder Löchern. Vor allem die gleichbleibenden, sich nicht ändernden Gestalten sprechen unser Sehen zuerst an – Lin Chen nennt sie „topologische Invarianten“. Sie bedingen eine Sehrichtung, die von der großen, überblickshaften Wahrnehmung hinab zur Wahrnehmung kleinerer Einzelheiten führt. Das wird auch als Top-down-Prinzip bezeichnet.
Zwei gegensätzliche Prinzipien aus West und Ost, die beide durch viele Experimente belegt worden sind. Welches stimmt? Oder sind in uns Menschen beide wirksam, können wir sie zusammenfügen? Unter welchen Umständen ist es denkbar, dass beide Modelle richtig sind, obwohl sie sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen?