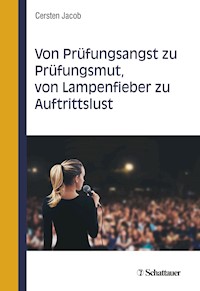
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die besten Methoden für einen klaren Kopf. Prüfungsangst und Lampenfieber plagen viele Menschen. In Schule und Studium hängt vom Prüfungsergebnis die weitere Laufbahn ab – man hat guten Grund zur Nervosität. Im Berufsleben wird Selbstsicherheit vorausgesetzt. Die Situationen, in denen man (sich) gut präsentieren muss, sind wichtige Sprossen auf der Karriereleiter. Dieses Buch bietet nachweislich effiziente Möglichkeiten des Selbstcoachings für ein Höchstmaß an Souveränität in Prüfungs- und Auftrittssituationen. Es setzt bei den psychischen Ursachen von Nervosität und Blackout an und zeigt wirksame Methoden auf, wie man an den Symptomen arbeiten kann: Lernen Sie die richtige Anwendung von Entspannungstechniken, NLP und Klopftechniken, eignen Sie sich die Tools aus den Bereichen Stimm- und Sprechtraining, Körpersprache und Rhetorik an. Ebenso wichtig ist es zu wissen, wie Sie sich am besten vorbereiten können, welche Rolle die Ernährung spielt, wie Sie Schlaflosigkeit vermeiden und welche körpereigenen "Drogen" es gibt. Mit diesem breiten Spektrum an einfach umsetzbaren Methoden und psychologischem Wissen spricht das Buch viele Leidensgenossen an: vom Schüler bis zum Lehrer, vom Studenten zum Professor, vom Teamleiter zum Geschäftsführer, vom Schauspieler zum Opernsänger. Egal wie brenzlig die Auftrittssituation ist – Sie können es schaffen, einen kühlen Kopf zu bewahren und souverän aufzutreten! KEYWORDS: Prüfungsangst, Prüfung Angst, Lampenfieber, Blackout, Auftrittsangst, Auftritt Angst, Präsentationsangst, Präsentation Angst, Angst frei zu reden, Redeangst, Rede Angst, Coaching, Selbstcoaching, Coaching Prüfungsangst, Coaching Lampenfieber, Nervosität, NLP, Entspannung, Entspannungstechniken, Erfolg Prüfung, Erfolg Beruf, Souveränität, Souveränität Beruf, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Schüchternheit, sicheres Auftreten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cersten Jacob
Von Prüfungsangstzu Prüfungsmut,von Lampenfieberzu Auftrittslust
Mit 4 Abbildungen und 10 Tabellen
Cersten Jacob
www.daedalus-institut.de
www.lampenfieber.berlin
Youtube-Kanal: https://bit.ly/2wCVO2L
Die digitalen Zusatzmaterialien haben wir zum Download auf www.klett-cotta.de bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM43094
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis:
Die Medizin unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, immer nur dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches entsprechen können. Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Therapie und der Auswahl sowie Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet. Gleichwohl werden die Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel und Fachinformationen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spezialisten zu konsultieren. Fragliche Unstimmigkeiten sollten bitte im allgemeinen Interesse dem Verlag mitgeteilt werden. Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische oder therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung in elektronischen Systemen.
Schattauer
www.schattauer.de
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagabbildung: © Adobe Stock/ALDECAstudio
Cartoons und Illustrationen: Ronald Markworth, Berlin: www.roncartoons.de
Gesetzt von am-productions GmbH, Wiesloch
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-43094-3
E-Book: ISBN 978-3-608-16930-0
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-26906-2
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Projektleitung: Nadja Urbani
Lektorat: Elke Renz, Stutensee-Spöck
Ich widme dieses BuchHorst und Brigitte.
Mein Dank geht an:
Anna, Annett, Annette, Anita, Christian, Constance, Dieter, Dirk, Donald, Doris, Ellen, Frank, Helmut, Jana, Johanna, Jörg, Karl, Kerstin, Klaus, Lieschen, Malte, Manfred, Manuela, Margitta, Marion, Olaf, Paul, Peter, Ramona, Rita, Rosemarie, Sarah, Silvia, Susanne, Tina, Ute, Werner, Willi, Wolfgang …
Vielen Dank an alle meine Lehrer, besonders:
Achim H., Anton R., Bernd I., Bertolt B., Carl-Hermann R., Cora B.-S., Dr. R., Eva L., Frau M., Fräulein N., Harald W., Harry S., Helga W., Herr L., Herr S., Herr Sch., Horst H., Dr. Ingrid J., Jens H., Jürgen W., Karl Mi., Karl Ma., Klaus M., Prof. Dr. Dr. Manfred S., Martina S.-T., Prof. Ottofritz G., Prof. Dr. Otto D., Ralf S., Reiner A., Thieß S., Volkmar O. …
und Dank an alle mir wichtigen Menschen, deren Namen mir dieser Tage nicht eingefallen sind, die langfristig zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben.
Prolog
Sind Sie auch so einer, der die Vorbereitung einer Präsentation oder das Lernen für eine Prüfung lange vor sich herschiebt? Und dann mit dem Druck des Termins auf den letzten Drücker ganze Tage lang bis in die Nächte hinein lernt oder Powerpoint-Präsentationen oder was auch immer vorbereitet?
Eine der besten Voraussetzungen, um sich gehörigen Druck und Angst aufzubauen. Sie lernen nur in das Kurzzeitgedächtnis und können sich natürlich nicht sicher sein, wenn die Aufregung in der Präsentationssituation dazukommt, dass Sie es auch wirklich sicher hinbekommen. Sie bringen sich durch dieses kurzfristige intensive Vorbereiten in eine Trance, ausgelöst durch Hormone wie Dopamin und Adrenalin, in der Sie hoffen, im entscheidenden Augenblick fit zu sein. Und das gelingt nicht immer und nicht jedem. Das viele Dopamin und Adrenalin bewirkt noch nebenbei, dass Sie nicht schlafen können oder Albträume haben.
Es mag auch viele Male am Ende gut gehen und dann fühlen sich diejenigen, die so arbeiten, bestätigt darin, dass das eine gute Möglichkeit der Arbeitsweise ist. Sie schwören dann darauf und geben diese Art noch als eine ihrer Stärken an. Sie sagen dann, sie bräuchten den Druck, sonst würde ihnen nichts einfallen oder sie könnten sonst nicht vernünftig lernen.
Aber wehe, es geht einmal schief. Und Sie haben einen nicht so guten Tag erwischt zur Präsentation oder Prüfung. Sie sind mit dem linken Bein aufgestanden und der Kaffee ist Ihnen schon beim Frühstück auf Hose, Hemd oder Bluse geschwappt, der Bus ist Ihnen weggefahren oder Ihr Auto stand heute so bescheuert zugeparkt, dass Sie Mühe hatten auszuparken. Das Müllauto stand ausgerechnet heute so lange quer in der Straße, dass Sie eine gefühlte Ewigkeit nicht losfahren konnten und Mutti musste genau heute früh noch anrufen und Ihnen wünschen: „Viel Glück und hoffentlich passiert dir nicht wieder dasselbe wie in der 10. Klasse, als du in dem Gedichtvortrag den Faden verloren hast und nicht mehr weiterwusstest!“ …
Dann stehen die Chancen gut, dass Sie in der entscheidenden Situation nicht so fit sind. Und, obwohl Sie gestern Abend noch ganz genau im Kopf hatten, was Sie sagen wollten und sollten – jetzt ist der Adrenalin-Spiegel so hoch gestiegen, dass Sie einen Blackout haben. Verka…, so ’ne Sch…!
Wenn dann das nächste Mal so eine Präsentations- oder Prüfungssituation kommt, zweifeln Sie schon bei der Vorbereitung an sich selber, müssen immer wieder daran denken, was beim letzten Mal alles schief gelaufen ist und erinnern sich auch zunehmend an Situationen wie die mit dem Gedicht in der 10. Klasse – und jetzt fallen Ihnen auch noch weitere ein und Sie fangen an, eine Angst vor der Angst zu entwickeln. Und schieben die Vorbereitung noch länger auf den allerallerletzten Drücker auf und versetzen sich mental bereits in die Verlierer-Rolle. Müssen sich schon Tage vorher übergeben, haben Durchfall, können nicht mehr richtig essen, schlafen schlecht und am eigentlichen Tag sind Sie völlig erschöpft und durch den Wind und … wieder nichts geworden. Oder aber: knapp geschafft, aber Sie sagen sich: „Das möchte ich nie wieder haben.“ Sie beginnen, sich vor allen ähnlichen auf Sie zukommenden Situationen zu schützen.
Sie könnten Karriere machen im Beruf, aber dazu müssten Sie noch eine Weiterbildung besuchen mit einer Prüfung am Ende. Nee, kommt nicht in Frage. Oder, Sie kommen auf Grund Ihrer fachlichen Qualifikation immer weiter und eines Tages bei dem Projekt, in welchem Ihr Herzblut steckt, sollen ausgerechnet Sie den Business-Plan vorstellen und die Geldgeber überzeugen. Alle sagen: „Wer, wenn nicht du?!“ Und Sie müssen irgendwelche Ausreden erfinden, dass Sie das nicht machen können. Am Ende erntet der, der es letztlich macht, und auf Grund dessen Präsentation die Geldgeber die ersehnten Penunsen freigeben, den Ruhm und wird befördert. Und Sie bleiben für Jahre in der dritten Reihe und jammern allen anderen vor, wie ungerecht die Welt ist und wie schlecht Ihr böser Chef oder, oder, oder…
* Namen, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, wurden geändert. Ebenso wie die Details der beschriebenen Fälle, obwohl diese grundsätzlich auf realen Begebenheiten beruhen.
Inhalt
1 Was ist eigentlich Lampenfieber?
1.1 Nützliches Lampenfieber?
1.2 Behinderndes Lampenfieber, Auftritts-, Podiums- oder Prüfungsangst
1.2.1 Die Symptome
1.2.2 Die zugrundeliegenden Ängste
1.2.3 Situationen, die bei Ihnen Lampenfieber und Prüfungsangst auslösen
2 Was tun gegen hinderndes Lampenfieber und Prüfungsangst?
2.1 Woran kann man womit arbeiten?
2.2 Vorbereitung der Arbeit an den Symptomen
2.2.1 Arbeitsblatt 1: Jetzt-Zustand und Zukunftswunsch
2.2.2 Arbeitsblatt 2: Wahrnehmungen vor oder während dem Ereignis
2.2.3 Arbeitsblatt 3: Ihre Reaktion auf Fragen
3 Die Entwicklung Ihres Auftretens
3.1 Körpersprache und Sprache verändern
3.2 Souveräne Körpersprache
3.3 Die richtige Kleidung
3.4 Hochstatus und Tiefstatus
3.4.1 Status als Präsentator
3.4.2 Status in einer Prüfung
4 Training von Hochstatus
5 Die Stimme
5.1 Stimmtraining lohnt sich
5.2 Stimmübungen für Atmung und Entspannung
5.2.1 Im Liegen tief in den Bauch atmen
5.2.2 Das Buch oder Kissen auf dem Bauch
5.2.3 Der Strohhalm
5.2.4 3-12-6-Übung nach Tony Robbins
5.2.5 Sarnoff-Übung nach Yul Brynner
5.3 Lob der tieferen Stimme
5.4 Zwei Übungen für die richtige Stimmlage
5.4.1 Kauübung mit Summen
5.4.2 Litanei
5.5 Die Bandbreite der Stimme
5.5.1 Aaaah – Der Stoßseufzer
5.5.2 Stimme variieren
5.5.3 Stimmkreis oder Klangglocke
5.6 Deutliches Sprechen
5.6.1 Zeitung lesen 2×2×2×2
5.6.2 Zungenkreisen zur Kräftigung
5.6.3 Lippenlockerung oder Lippenflattern
5.6.4 Demosthenes
5.6.5 Die Korkenübung
5.6.6 „Diese Sprechübung macht sehr viel Spaß“
5.6.7 Zungenbrecher
5.7 Psychologische Stimm- und Sprechbarrieren
6 Mentale Vorbereitung 1
6.1 Kontrollieren der eigenen Gedanken
6.2 Sich selbst akzeptieren
6.3 Sicherheitsaufbau durch gute Beziehungen zu Publikum und Prüfern
6.4 Moment of Excellence
6.4.1 Ankersetzen mithilfe eines „Moment of Excellence“
6.4.2 Kurzanleitung für einen „Moment of Excellence“
6.5 Verzicht auf Negationen: nicht, keine, un-, ent-, -los
7 Entspannungstechniken
7.1 Wozu Entspannungstechniken?
7.2 Die verschiedenen Entspannungsverfahren
7.3 Dehnen und Strecken und Lösen
7.4 Setting für weitere Entspannungstechniken
7.4.1 Zur Haltung
7.4.2 Im Liegen
7.4.3 Im Sitzen 1 – Im Sessel
7.4.4 Im Sitzen 2 – Kutscherhaltung
7.4.5 Störungen
7.5 Autogenes Training
7.6 Progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobson (PME)
7.6.1 Die Langform der PME in 14 Schritten
7.6.2 Die Kurzform der PME mit sieben Muskelgruppen
7.7 Unsere Sinneswahrnehmung, Basis der Konzentrativen Entspannung (KE)
7.8 Anleitung zur Konzentrativen Entspannung
7.9 5-4-3-2-1-Methode
7.10 Entspannung wie im Kino
8 Vorbereitung und optimale Darstellung von Inhalten
8.1 Langfristige inhaltliche Vorbereitung
8.2 Mindmapping
8.3 Powerpoint und andere visuelle Medien
8.4 Visuelle Medien und Ihr Kontakt zum Publikum
8.5 Umgang mit dem Flipchart
8.6 Notizen
9 Strukturen von Vorträgen bei Präsentationen und in Prüfungen
9.1 Die wissenschaftliche Vortragsgliederung
9.2 Die Standpunktformel
9.3 Die Problemlösungsformel
9.4 Die Stegreifrede mit der VGZ-Formel (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft)
9.5 Eine gute Einleitung ist entscheidend
9.6 Ein guter Schluss wirkt lange nach
10 Die Art des Vortrages
10.1 Ablesen
10.2 Der freie Vortrag
10.3 Die Handhaltung
10.4 Haltung am Rednerpult
11 Ein paar Grundlagen der Gesprächsführung
11.1 Aktives Zuhören 1 – Grundform
11.2 Aktives Zuhören 2 – Emotionales Verständnis
11.3 Kontrollierter Dialog oder Spiegelfragen
12 Störungen während des Vortrages
12.1 Gegenfragen
12.2 Das verdrehte Zitat oder Sprichwort
12.3 Aber oder Und
13 Blackout & Co: Pannen während des Vortrages
14 Lernen für den Vortrag und die Prüfung
15 Mentale Vorbereitung 2
15.1 Die komplette Präsentation als Erfolg vorstellen
15.2 Affirmationen, Vorsatzformeln und Autosuggestionen
15.2.1 Prinzipien der Arbeit mit Affirmationen
15.2.2 Beispiel-Formulierungen für Affirmationen in verschiedenen Kontexten
15.3 Perfekt oder optimal
15.3.1 Perfekt
15.3.2 Optimal
15.4 Moment of Excellence in Kombination mit „Copy and Paste“
15.5 Sich seine Stärken klarmachen
15.6 Glaubenssätze
15.6.1 Glaubenssatz-Arbeit zum Selbstmachen
15.6.2 Auflösen durch Affirmationen
15.7 Welcher Sinnestyp sind Sie? – Test
15.8 Submodalitäten-Arbeit
15.9 Glaubenssätze und Submodalitäten
15.10 Die Neuro-Logischen Ebenen nach Robert Dilts
15.11 Innerer Dialog
15.12 Magic Words – eine Zaubertechnik
15.13 Spirituelle Vorbereitung
15.14 Das „Innere Team“ nach Friedemann Schulz von Thun
15.15 Six-Step-Reframing
15.16 NLP (Neurolinguistisches Programmieren) als Sammlung verschiedener Techniken
15.17 Time Line, Change History und eine Mini-Aufstellung
15.18 Wingwave-Coaching
15.18.1 Zur Funktionsweise von EMDR
15.18.2 Muskeltest, Myostatik-Test, O-Ring-Test
15.18.3 Das Winken
15.18.4 Ablauf einer einfachen Wingwave-Sitzung zum Thema Lampenfieber oder Prüfungsangst
15.18.5 Invivo-Coaching
15.18.6 Augenbewegungen selbst stimulieren
15.18.7 Kinästhetische Interventionen
15.18.8 Auditive Interventionen
15.18.9 Erwünschte Inhalte „eingucken“ oder „einklopfen“
15.19 EFT, EP und MET
15.19.1 Funktionsweise von Meridiantechniken für die Psyche
15.19.2 Stärkung des Selbstwertgefühls
15.19.3 Blockade-Auflösung durch Musterunterbrechung
15.19.4 Behandlungspunkte
15.19.5 Psychologische Umkehr neutralisieren
15.20 Mantras
15.21 Talisman
15.22 Übungen aus der Kinesiologie für besseres Lernen
15.23 Rollentraining Dissoziieren und Assoziieren
15.24 Coaching oder Selbstanwendung?
16 Phasen der Präsentation
16.1 Der Einstieg und Beginn
16.2 Mitten im Vortrag
16.3 Der Schluss
17 Proben Sie …!
17.1 Prüfung von Sprache, Ablauf und Optik
17.2 Feedbackregeln
17.3 Sicherheit mit der Technik
18 Richtige Ernährung für Präsentationen und Prüfungen
18.1 Übersicht über die Ernährung für die langfristige Vorbereitung
18.2 Kurz vor der Präsentation
19 Gut schlafen können
19.1 Entspannungstechniken
19.2 Schlaftabletten
19.3 Alkohol
19.4 Kiste bauen
20 Drogen versus Lampenfieber und Prüfungsangst
20.1 Zur Wirkung verschiedener „Stimulanzien“
20.1.1 Alkohol
20.1.2 Cannabis, Haschisch oder Marihuana
20.1.3 Amphetamine
20.1.4 Ritalin (Methylphenidat)
20.1.5 Vigil (Modafinil)
20.1.6 Antidementiva
20.1.7 Vermeidung von Glutamat
20.1.8 Antidepressiva
20.1.9 Betablocker (Beta-Rezeptorenblocker)
20.1.10 Der Betablocker Propranolol
20.2 Körpereigene Drogen durch Lachen, Sport, Singen und Sex
20.2.1 Wie funktioniert Lachyoga?
20.2.2 Singen
20.2.3 Ausdauersport
20.2.4 Sex
21 Checklisten
21.1 Checkliste mittelfristige Vorbereitung
21.2 Checkliste kurzfristige Vorbereitung
21.2.1 Rituale
21.2.2 Small Talk
21.2.3 Bitte beachten vor Prüfungen
21.3 Checkliste während des Vortrags der Prüfung
22 Ihr Plan: Von Prüfungsangst zu Prüfungsmut, von Lampenfieber zu Auftrittslust
23 Literatur
1 Was ist eigentlich Lampenfieber?
Was ist Lampenfieber? Gute Frage. Vielleicht kennen Sie Synonyme für Lampenfieber wie: Auftrittsangst, Podiumsangst und Präsentationsangst und andere.
Und Prüfungsangst – was ist das eigentlich? Prüfungsangst, könnte man ganz einfach sagen, ist die Angst, die lange vor oder während einer Prüfung auftritt, die Prüfung nicht zu bestehen oder deutlich unter seinen Fähigkeiten abzuschneiden. Der Prüfling befürchtet, nicht alle Ressourcen zur Verfügung zu haben, nicht das schreiben oder sagen zu können, was er eigentlich ganz genau weiß. Oder nach Dingen gefragt zu werden, die er prinzipiell weiß, aber genau jetzt gerade kommt ihm keine Inspiration. Oder nach etwas gefragt zu werden, wovon er plötzlich (und irrtümlicherweise) denkt, es noch nie gehört zu haben. Oder doch? Da war doch mal was …
Und dieses ominöse Lampenfieber? Kann man das auch vor einer Prüfung haben?
Und wie erklärt man das überhaupt? Die Interpretationen sind sehr, sehr unterschiedlich, wenn ich prominenten oder weniger prominenten Kandidaten so zuhöre.
Exkurs
Zur Wortherkunft von „Lampenfieber“
Der Begriff Lampenfieber ist in dieser Form im Theateralltag entstanden und daran angelehnt.
Früher hatten Theaterräume noch keine Klimaanlage und die alten Scheinwerfer entwickelten, wenn man auf der Bühne in deren Kegel stand, sehr große Hitze. Sie waren zeitweise mit echtem Kohlebogenfeuer ausgestattet und Spiegeln, die das Licht bündelten. Sie bildeten sozusagen einen Brennpunkt.
Im ganz alten Theater kam noch hinzu, dass am Bühnenrand, also der Rampe, unten eine Leiste mit zusätzlichen Lampen angebracht war, damit keine Schatten, z.B. unter dem Kinn, entstanden. Daher auch der Begriff „Rampenlicht“.
Ich spielte als Schauspielstudent in einer Inszenierung von Schillers „Die Räuber“ mit, im Goethe-Theater in Bad Lauchstedt. Dort ist die denkmalgeschützte Bühnentechnik auch heute noch erhalten und zu bestaunen, dabei auch die Lampen an der Rampe.
Ältere Schauspielerinnen brachten für den Fall, dass dieses „Rampenlicht“ nicht schon eingebaut war, eine Lichtleiste mit. Diese wurde extra vorn an die Rampe gelegt, damit man nicht die Hals- und Gesichtsfalten sah, die mit der Schminke nicht zu kaschieren waren.
Solche Tricks benutzt man heute noch immer professionell bei Film und Fernsehen.
Die schon als Kind europaweit berühmte Multi-Künstlerin Catharina Valente wird gern zitiert mit: „Lampenfieber ist einfach Teil des künstlerischen Erlebnisses. Man sollte es sich nicht abgewöhnen.“ Wohingegen der Sänger Klaus Hofmann über seinen Freund Reinhard Mey bemerkte: „ … der hat ja solche Angst vor dem Moment des Hinausgehens, der kotzt ja fast“ (Mey 2005, S. 256). Und Reinhard Mey selbst in seiner Autobiografie:
„Aber diesen ersten Abend vor Menschen kannst du nicht simulieren, das ist der Sprung ins kalte Wasser. Dieser Moment ängstigt mich so sehr, vor dem hab ich so viel Angst, der beeindruckt mich so sehr, dass es wirklich schon zwei Monate vor einer Tournee anfängt und sich steigert bis zu dem Tag, an dem es losgeht, bis zum Wahnsinn …
Ich hab immer Lampenfieber, aber diese panikartigen Zustände, die so schlimm werden, dass sich die Gedärme umdrehen und mir übel wird, das hab ich nur beim ersten Mal … Ich brauche jetzt nur daran zu denken, dann brummelt es wieder.“
(Mey 2005, S. 207)
Ganz anders reagierte Peter Kraus in einem Interview für den Radiosender Bayern 3, als er gefragt wurde: „Sie haben heute immer noch Lampenfieber?“
„Wenn ich jetzt die Routinenummer abziehen würde, dann hätt ich auch kein Lampenfieber. Wenn ich kein Lampenfieber hab, besteht die Gefahr, dass ich in Routine rutsche. Also, ich erzeuge mir eigentlich ein geringes, keine wirkliche Art Lampenfieber, aber eine Spannung, eine leicht nervöse Spannung: Wird das funktionieren?“
(Peter Kraus in einem Interview in BR3 am 11.10.2009)
Und wiederum ein Gegenbeispiel von dem Schauspieler Sven Martinek, der sicherlich aus diesem gleich genannten Grund nur noch in Fernsehen oder Film seinen Beruf ausübt (z.B. in den Serien „Tierärztin Dr. Mertens“, „SOKO Rhein-Main“ oder „Die Landärztin“):
Martinek: „Im Theater bin ich gestorben. Da ging nichts mehr.“
Katarina Witt (mitleidig): „Oh nee …“
Martinek: „Fürchterlich, das war ganz schlimm.“
Moderatorin: „Und was haben Sie gemacht, Gymnastik auch?“
Martinek: „Nö, ich hab einfach nur Angst gehabt. Ich konnte nix mehr machen. Ich war machtlos. Auf der Bühne hatte ich nur Angst vor dem schwarzen Loch.“
(Sven Martinek im MDR-Riverboat, 25.09.2009)
Und den Vogel schießt schließlich Thomas Gottschalk ab, einer der erfolgreichsten deutschen Showmaster. Ich habe ihn mehrmals in Talkrunden in den 1990ern sagen hören, mit Lampenfieber könne er gar nicht arbeiten. Und sein Umfeld bestätigt, dass er in der Show „Wetten dass?“ im Prinzip genauso gewesen sei wie als Privatperson.
Die Autorin und Musikerin Irmtraud Tarr Krüger formuliert: „Es ist die Angst, sich bloßzustellen, das Gesicht zu verlieren, so dass auf peinliche Art ans Licht kommt, was und wer wir sind“ (Tarr Krüger 1993).
Es besteht also offensichtlich große Uneinigkeit darüber, was eigentlich dieses merkwürdige Lampenfieber ist und welche Wirkung es hat.
Zitiert nach der Brockhaus-Enzyklopädie (1989) ist Lampenfieber ein „innerer Erregungszustand vor öffentlichem Auftreten“ eine „Form der Erwartungsangst.“
Meyers Lexikonredaktion (1987) definiert es als „Zustand von Erregung und Angst, durch den das Leistungsvermögen einer Person gemindert wird und der eintritt, bevor oder wenn sich die Person allein bzw. nicht anonym vor einem Publikum schauspielerisch, verbal, vokal oder instrumental darstellen, eine bewertbare oder zu bewertende Leistung erbringen will oder soll, wodurch die Selbstwertthematik dieser Person stark angeregt werden kann.“
Während manche Autoren zwischen den Begriffen Lampenfieber und Prüfungsangst unterscheiden, sehe ich sie in einem Zusammenhang: Lampenfieber lässt sich in nützliches und behinderndes Lampenfieber aufgliedern. Prüfungsangst ist dabei ein Teil des behindernden Lampenfiebers.
Zusammenfassung
Der Begriff „Lampenfieber“ wird unterschiedlich interpretiert. Für den Einen ist es eine notwendige „Erhöhung der Betriebstemperatur“, um fit zu sein für die Leistung, für den Anderen ein Zustand krankhafter Aufregung und damit ein Hindernis, seine Leistung zu erbringen.
1.1 Nützliches Lampenfieber?
Viele Künstler sagen, sie brauchen Lampenfieber. Was sie mit Lampenfieber meinen, ist eine „Erhöhung der Betriebstemperatur“, die ausgelöst wird durch verschiedene Hormone. Das bekannteste Stresshormon ist bekanntlich Adrenalin. Und so beschreiben viele Performer, dass sie diesen „Adrenalin-Kick“ brauchen. In der Zwischenzeit sind auch weitere wichtige Leit-Hormone allgemein bekannt, die unter anderem zu einer gesteigerten Konzentrationsfähigkeit führen, zum Beispiel Dopamin. Diese bewirken eine erhöhte Aufmerksamkeit, Schnelligkeit in den Gedanken und Reaktionsfähigkeit. Auch tragen sie zu der nötigen Spannung im Körper bei, die die Aufmerksamkeit des Publikums für den Präsentator steigen lässt. Die Körpertemperatur und der Herzschlag erhöhen sich. Viele, die diese „Erhöhung der Betriebstemperatur“ mögen, beschreiben es auch als eine Art Rausch. Und das ist es letztlich auch, ausgelöst durch körpereigene berauschende Substanzen. Kommt dann noch Erfolg dazu, dass der Präsentierende also spürt, dass er bei Zuhörern oder Zuschauern gut ankommt, werden noch weitere berauschende Hormone ausgeschüttet wie z.B. Serotonin, das uns dann zusätzlich sicher fühlen lässt, und Endorphine, die einen „Freudenrausch“ auslösen. Der Nucleus Acumbens im „Belohnungssystem“ unseres Gehirns schüttet eine weitere Droge aus, die das Gefühl der Belohnung und damit den Abhängigkeitsfaktor auslöst. Dies führt manchmal zu einer regelrechten Sucht nach den sprichwörtlichen „Brettern, die die Welt bedeuten“. Menschen, die diese Art von Lampenfieber haben, lieben es, ihr Leben lang auf der Bühne zu stehen. Selbst wenn sie aus verschiedenen Gründen eine Zeit der Bühnenabstinenz pflegen, müssen sie immer wieder auf diese zurückkehren. So erklärt sich auch, dass manche Künstler mehrere Abschiedstourneen absolvieren und dann doch noch ein weiteres Comeback planen. Sie brauchen einfach diesen Kick vorher und den berauschenden Erfolg am Ende. Altmeister Bob Dylan beispielsweise hört gar nicht auf mit seiner Tournee. Er spricht sogar von einer „Never Ending Tour“, auf der er sei. Und er mache nur Platten, um diese dann live auf der Bühne zu präsentieren und damit Werbung für seine Live-Gigs zu haben.
Zusammenfassung
Nützliches Lampenfieber
macht wach,putscht auf,schafft die nötige Spannung in Körper und Geist,setzt Energie frei,macht im Kopf fitter,beschleunigt somit die Denkfähigkeit undstärkt uns für den Auftritt.Dieses Phänomen braucht uns also nicht weiter zu beschäftigen. Wir können es einfach an Anderen genießen, wenn wir wollen. Zugleich ist diese Art von Lampenfieber möglicherweise die von Ihnen angestrebte!
Wer dieses Buch liest, möchte jedoch mit Sicherheit über die behindernde Art des Lampenfiebers etwas wissen.
1.2 Behinderndes Lampenfieber, Auftritts-, Podiums- oder Prüfungsangst
Ich zitierte bereits den Sänger Klaus Hoffmann, der über seinen besten Freund, den Liedermacher Reinhard Mey, drastisch sagte: „… der kotzt ja fast.“
1.2.1 Die Symptome
Die Symptome des behindernden Lampenfiebers und der Ängste vor jeglichen Auftritten sind vielfältig und unangenehm. Dass sie sich gerade auf der körperlichen Ebene stark zeigen, wird am Beispiel von Reinhard Mey sehr deutlich.
Geraume Zeit vor dem anvisierten Ereignis haben viele Menschen
schlaflose Nächte,
erhöhte Nervosität,
Übelkeit bis hin zu Erbrechen,
Schweißausbrüche schon beim Gedanken an den Auftritt oder die Prüfung,
Kopfschmerzen,
erhöhten Puls und Blutdruck beim Gedanken an die zukünftige Situation,
Verdauungsstörungen,
etc.
Kurz vor oder während der Präsentation zeigen sich
Schweißausbrüche,
Erröten im Gesicht,
abwechselndes Heiß- und Kaltwerden am Kopf oder am ganzen Körper,
flache Atmung,
kalte und feuchte Finger,
Stottern,
Harndrang,
Blackout oder das Phänomen des „leeren Kopfs“,
der „Frosch“ im Hals,
zittrige Knie,
Zittern am ganzen Körper,
Herzrasen,
etc.
Viele der Symptome sind so heftig, dass Lampenfieber manchmal als Krankheit empfunden wird. Auch nach offiziellen Definitionen dieses Begriffes halte ich das für statthaft.
Auf der Webseite der Gesundheitsberichterstattung des Bundes ist zum Beispiel zu lesen: „Krankheit ist definiert als Störung des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens“ (vgl. www.gbe-bund.de, abgerufen am 06.05.2014). All dies trifft auf die oben beschriebenen Symptome zu.
Mit dem Gegenteil von Krankheit befasst sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO): „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“.
Wenn Lampenfieber und Prüfungsangst wirklich Krankheiten wären, müssten die Krankenkassen die Therapie übernehmen, was sie aber nicht tun. Im Versicherungsrecht der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird Krankheit definiert als ein „objektiv fassbarer, regelwidriger, anomaler körperlicher oder geistiger Zustand, der die Notwendigkeit einer Heilbehandlung erfordert und zur Arbeitsunfähigkeit führen kann.“
Wann die „Notwendigkeit einer Heilbehandlung“ eintritt, wird hier freilich nicht näher definiert. Festhalten lässt sich jedoch unbestritten, dass Lampenfieber zur Arbeitsunfähigkeit führen kann.
Manche Ärzte oder klinische Psychotherapeuten finden über „Umwege“ Lösungen. Sie bezeichnen dann die Symptome anders und schon kann es zu einer Kassenleistung kommen. Mir ist bekannt, dass zum Beispiel Beta-Blocker verschrieben werden. Näheres dazu in Kapitel 20.1.9 (über Drogen).
Falls Sie Betroffene von Lampenfieber oder Prüfungsangst sind, suchen Sie die für Sie geeignete Hilfe. Bei Ihrer Suche können Sie den Überblick über Beratungs- und Therapie-Instrumente in Kapitel 3.1 gut nutzen. Zunächst aber ist es wichtig, zu verstehen, welchen Sinn solche Ängste haben.
Für Ihre eigene Zukunft kann es sogar günstiger sein, diese Ängste von einem Coach und nicht von einem Therapeuten beseitigen zu lassen. Die privaten Krankenversicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherer lehnen sehr häufig Anträge von Menschen ab, die eine Psychotherapie in Anspruch genommen haben. (Unglaublich ist in diesem Zusammenhang, dass die traumatisierten jungen Menschen der Duisburger Love-Parade, die anschließend die angebotene psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben, heute zum Beispiel nicht verbeamtet werden können, weil sie dazu in eine private Krankenversicherung eintreten müssten und diese sie nicht aufnimmt, weil sie in psychologischer Behandlung waren und deshalb auch die Versicherer ihnen eine Berufsunfähigkeitsversicherung verweigern. Das ist gängige Praxis, wie mir Cora Besser-Siegmund [siehe Literatur] aktuell beschrieb. Da besteht offensichtlich dringender Handlungsbedarf durch den Gesetzgeber. Solange ist in diesen Fällen ein selbstbezahltes Coaching eher zu empfehlen. Nicht immer sind Kassenleistungen die beste Lösung.)
1.2.2 Die zugrundeliegenden Ängste
Wir können bei der Entstehung von Lampenfieber und ähnlichen Ängsten zwischen angeborenen und erlernten Reaktionsmustern unterscheiden.
Viele der oben beschriebenen Reaktionen sind uns in Situationen vor Prüfungen und Präsentationen, egal welcher Art, nicht angeboren.
Angeboren ist uns zum einen, dass wir uns intuitiv vor lebensbedrohlichen Ereignissen schützen müssen und zum anderen die Angst vor Unbekanntem. Die meisten Ängste allerdings sind „erlernt“.
Der Hirnforscher Manfred Spitzer soll es einmal so formuliert haben: „Wir sind die Nachfahren derer, die weggerannt sind als der Säbelzahntiger kam.“ Wer nicht wegrannte, wurde gar nicht so alt, um in die Situation zu kommen, Nachwuchs zu zeugen. Die, die wegrannten oder sich anderweitig schützten, haben es oft geschafft, Nachkommen großzuziehen, weil sie lange genug allen Gefahren trotzten und somit überlebten. Oder sie hatten einfach nur Glück. Diese Überlebenden sind unsere Ahnen. Deren Reaktionsweisen und Handlungsmuster sind in unser Erbgut eingegangen. Deswegen bestehen zum Beispiel die Nachrichten in Radio und Fernsehen vorwiegend aus den negativen Ereignissen in der Welt. Deswegen wird eine negative Erfahrung siebenmal öfter weiter erzählt als eine positive, so ein Leitsatz aus dem Marketing. Wir konzentrieren uns aus archaischen Gründen auf das, was eine Gefahr für unser Leben sein oder zumindest Unannehmlichkeiten mit sich bringen könnte.
Vergeblich würde man aber den an diesen archaischen Ängsten Leidenden entgegnen, dass die Gefahren, die heutzutage von Tieren ausgehen, zumindest in unserer Region fast Null sind. Die wirklich gefährlichen Tiere kann man hinter Gittern oder in Terrarien im Zoo bestaunen. Lampenfieber und Prüfungsangst werden jedoch erlebt, selbst wenn wir keinen steinzeitlichen Gefahren mehr ausgesetzt sind – wie viele Ängste ja eigentlich der realen Gefahr nicht angemessen sind (Platzangst, Höhenangst …). Höchst real ist aber das Leiden der Betroffenen. Deshalb muss man die Ängste der Menschen ernst nehmen und soll sie nicht einfach als Schwäche abtun. Nur mit jemandem, den man ernstnimmt, kann man ernsthaft arbeiten. Diese Betrachtungsweise macht Angst auch zum „Partner“. Wenn man den Partner, den man zum Einlenken oder zu einem anderen Verhalten bringen möchte, als zu bekämpfenden Feind bezeichnet, wird dieser aufrüsten und stärker werden, anstatt sich zu Verhandlungen bereit zu erklären oder das Feld zu räumen.
Man gibt immer dem Teil Macht über sich, den man mit allen Mitteln bekämpft.
Es gab bei unseren Vorfahren in den archaischen Gemeinschaften, den Sippen, die Angst, ausgestoßen zu werden, beispielsweise, weil man der Gemeinschaft möglicherweise nicht mehr nützlich war oder eine Gefahr darstellte. Im Fall der jungsteinzeitlichen Gletschermumie Ötzi ist eine solche Ausstoßung aus der Gemeinschaft eine der möglichen wissenschaftlichen Interpretationen seines Schicksals. Ausgestoßen zu werden bedeutete meist den sicheren Tod. Unsere Vorfahren konnten sich nicht komplett allein mit allem Lebensnotwendigen versorgen und sich ebenso wenig vor allen Gefahren selbst schützen.
Möglicherweise ist diese archaische Angst vor dem Verstoßenwerden ein Mitverursacher im Lampenfieberspiel.
Eine Prüfung bestehen, eine Rede halten müssen, eine Teamsitzung leiten oder in einem Publikumsgespräch Rede und Antwort stehen, das alles ist allerdings nicht wirklich körperlich lebensbedrohend. Und komplett ausgestoßen wird man auch nicht mehr – unser soziales System in Deutschland verhindert das in aller Regel.
Teile unseres Gehirns, speziell im limbischen System, suggerieren uns aber immer noch ein Maß an Gefahr, als müssten wir ständig damit rechnen, dass vor uns ein Säbelzahntiger seine Zähne fletscht. Warum?
Innerhalb der evolutionären Entwicklung über Millionen von Jahren war das Überleben sehr schwierig und alles konnte von einer Sekunde auf die andere vorbei sein. Der kurze Zeitraum, in dem das Leben physisch nur noch wenig bedroht ist, zumindest für die meisten Menschen in den gut entwickelten Industrieländern, besteht seit nicht mehr als hundert oder zweihundert Jahren. Oder sind es nur Jahrzehnte?
Unsere Erbmasse kommt da so schnell nicht mit. Das limbische System reagiert genauso wie all die Millionen Jahre zuvor auf alles, was uns bedrohlich erscheint und Angst macht. Es erteilt Anweisungen, Aktivitäts- und Stresshormone in Situationen auszuschütten, in denen überhaupt keine Lebensgefahr besteht, und der Körper vieler Menschen reagiert, als wäre es lebensbedrohlich, in einer Prüfung sein Wissen preiszugeben, eine Rede zu halten oder auf einer Theaterbühne oder wo auch immer im Mittelpunkt zu stehen.
Interessant finde ich die Statistik (Abb. 1), die in einer Apotheken-Umschau aus dem Jahre 2001 gedruckt wurde, die generellen Ängste von Männern und Frauen betreffend. Danach haben Frauen generell mehr Ängste – oder haben Männer Hemmungen, ihre Ängste zuzugeben? Jedenfalls besteht bei Frauen die größte Angst vor bestimmten Tieren, z.B. Spinnen, bei Männern ist die massivste Angst, vor vielen Menschen reden zu müssen.
Abb.1 Generelle Ängste bei Männern und Frauen. (In Anlehnung an: Püttjer/Schnierda 2002, S. 22.)
Die Mindmap (Abb. 2) zu den Hauptaspekten von Lampenfieber und Prüfungsangst stellt diese Phänomene in einen größeren Zusammenhang. Werfen Sie einen näheren Blick auf den Ast zum Thema Ängste.
Selbst wenn wir keine Angst vor wilden Tieren mehr haben, gibt es andere Ängste, die uns beschäftigen: Angst davor ausgelacht zu werden, sich schämen zu müssen, Angst vor Autoritätsverlust, vor Mobbing, Enttäuschung über sich selbst und Andere nach einer verpatzten Prüfung, Angst, Freunde zu verlieren, nicht mehr ernst genommen zu werden, einen Karriere-Knick zu erleiden, aber auch, sich überhaupt zu blamieren und Anderen und sich selbst im Spiegel nicht mehr in die Augen schauen zu können.
Andererseits ist auch das wieder nur ein Teil der Wahrheit. Wissenschaftler, Gehirnforscher und Psychotherapeuten sagen, Menschen kommen nicht mit diesen Ängsten auf die Welt, sondern sie erlernen sie im Laufe ihres Lebens. Wir haben zum Beispiel prägende Erlebnisse, die uns Angst machen. Manche meinen, dies könne schon im Mutterleib stattfinden, wenn die Mutter einschneidende Erlebnisse hat. Oder direkt während des Geburtsvorganges.
Darüber hinaus können Ängste, die in unseren direkten Vorfahren entstanden sind, quasi generationenübergreifend weitergegeben werden, und zwar einerseits durch die Atmosphäre des Zusammenlebens und der Erziehung, im Rahmen ausgesprochener wie auch unausgesprochener Botschaften, andererseits vielleicht sogar, nach neuesten Erkenntnissen, im Erbgut. Solche transgenerationalen Ängste können dann durch persönliche Erfahrungen verstärkt werden.
Abb.2 Die Hauptaspekte von Lampenfieber.
Wovor bestehen Ängste bei Lampenfieber? Zum Beispiel
vor „wilden Tieren“, dies meint auf aktuelle Situationen bezogen: Publikum, Prüfer,
vor den Eltern,
vor Lehrern,
vor wichtigen anderen Bezugspersonen,
vor Autoritäten,
vor der Bloßstellung vor Anderen,
davor, ein „falsches Bild“ von sich abzugeben,
von Anderen gemieden zu werden,
vor der Meinung der Anderen über Einen selbst,
vor Nichterfüllung der eigenen Erwartungen,
vor Nichterfüllung der Erwartungen Anderer.
Wie biografische Erlebnisse Ängste prägen, erläutern die folgenden zwei Beispiele.
Fallbeispiel
Der Klassiker: Das Weihnachtsgedicht
Man stelle sich vor, ein fünf- oder sechsjähriges Kind hat die gesamte Adventszeit lang das Gedicht „Lieber guter Weihnachtsmann …“ oder ein anderes gelernt, um es am Heiligen Abend dem Weihnachtsmann vorzutragen. Ich selbst habe viele Male auf Weihnachtsfeiern den Weihnachtmann „gegeben“ und weiß, in welchen Stress dies manche Kinder bringen kann. Die Mütter und Väter machen dem Kind in bester Absicht noch zusätzlichen Druck – vielleicht sogar mit der Drohung, dass es keine Weihnachtsgeschenke gibt, wenn diese Aufgabe nicht erfüllt wird. Schon ist der Boden für einen Blackout bereitet. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass das Kind ganz nah an den Weihnachtsmann heran muss, der sich extra in die Hocke begibt, auf die Ebene des Kindes. Und der riecht dann auch noch irgendwie ungewohnt, vielleicht nach Schweiß (solche Weihnachtsfeiern sind für den Weihnachtsmann im dicken Kostüm kein Zuckerschlecken) oder, wenns hart kommt, nach Alkohol.
Das Kind, das vorher schon stark unter Stress stand, weiß jetzt gar nichts mehr. Es steht vor oder sitzt auf dem Schoß des merkwürdig riechenden, irgendwie außerirdisch erscheinenden Mannes mit seinem roten Mantel und vielleicht sogar einer Weihnachtsmannmaske und … Blackout.
Das Kind bekommt trotz verpatzten Gedichts sein Geschenk. Aber auch die Vorhaltungen hinterher: „Warum hast du dem Weihnachtsmann das Gedicht denn nicht aufgesagt? Du konntest das doch so gut!“
Dies wird mehrfach wiederholt und im darauf folgenden Jahr neu aufgelegt. Fühlt sich solch ein Kind später als Erwachsener wohl, wenn es darum geht, eine Präsentation zu halten oder sein Wissen in einer Prüfung preiszugeben?
Im Coaching testen wir am Anfang mittels des Muskeltests (vgl. Kap. 15.18.2) die Gefühle, wenn es um Lampenfieber und Prüfungsangst geht. Bei einer Klientin testete dieses Verfahren bei dem negativen Gefühl „Ekel“ das Ergebnis „schwach“, was hier ein starkes Ekelgefühl bedeutet. Diese Frau hatte genau solch eine Situation in der Kindheit erlebt – und empfand heute, als Chefin einer ganzen Abteilung, immer Ekel, wenn sie nur eine kleine Ansprache zu halten hatte.
Fallbeispiel
Der Amateurmusiker
Fred* ist Sänger und Gitarrist einer Band, die 1970er- und 1980er-Jahre-Musik spielt. (Namen, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, sind geändert. Ebenso wie die Details der beschriebenen Fälle, obwohl diese grundsätzlich auf realen Begebenheiten beruhen.)
Fred kam zu mir mit dem Problem, dass er immer kalte, feuchte Hände und eine zittrige Stimme bekomme, wenn der Auftritt losgehen solle. Also genau das, was er als Frontmann einer Band nicht gebrauchen könne. Nach fünf Minuten sei das Problem dann wieder verschwunden.
Das „schwach“ getestete, also verantwortliche Gefühl war Scham. Wir ermittelten, dass folgende Situation aus seinem siebten Lebensjahr der Auslöser war:
Eines Tages in der Schule musste Fred auf die Toilette, ein „größeres Geschäft“ machen. Aus irgendeinem Grund waren (wahrscheinlich vom Hausmeister) alle Kabinen zugeschlossen. In seiner Not benutzte Fred nun die „Pinkelrinne“. Letztlich kam heraus, dass er der Verursacher für die entstandene Verschmutzung war. Plötzlich stand er im Fokus der Lehrer und Mitschüler. Die Peinlichkeit war schier nicht zu ertragen. Allein kann ein Kind im Alter von sieben Jahren eine solche Situation nicht als richtig oder falsch bewerten. Es entwickelt ein Gefühl von Scham. Hätte Mutti, als sie davon erfuhr, gesagt: „Junge, war doch in Ordnung. Gut, dass du nicht in die Hosen gemacht hast“, dann wäre die verinnerlichte Bewertung sehr wahrscheinlich anders ausgefallen und das Ereignis hätte keine bleibenden Spuren hinterlassen. Aber das tat Mutti offensichtlich nicht. Muttis wie auch Vatis haben in solchen Fällen eine große Verantwortung – und keine Mutti, kein Vati macht am Ende alles richtig. Leider …
Wir bearbeiteten das Problem mit der Wingwave-Technik (vgl. Kap. 15.18). Nach einem Jahr habe ich Fred telefonisch kontaktiert und er versicherte mir, die Symptome seien nie wieder aufgetreten.
Wir sehen, wie scheinbar banal die Erfahrungen seien können, die Angstphänomene auslösen. Lernen bedeutet in diesem Zusammenhang, eine negativ prägende Erfahrung zu machen und dadurch eine Kettenreaktion unangenehmer Art zu verinnerlichen. Unbehandelt bleibt uns diese Reaktionsweise oft ein Leben lang erhalten. Eine neue Situation muss nur Ähnlichkeiten mit der Prägungssituation aufweisen und schon geht die Kettenreaktion los. Dafür sorgt unser limbisches System, das uns vor weiterer unangenehmer Erfahrung schützen will. Hinzu kommt noch eine selbsterfüllende Prophezeiung, ein Mechanismus aus Erwartung und unbewusst beeinflussendem Verhalten, welcher Situationen immer wieder genau so ablaufen lässt. Die Betroffenen sagen dann schon vorher: „Es wird wieder nichts“. Und behalten leider wieder und wieder recht.
Zusammenfassung
Lampenfieber kann verhindern, dass Menschen in Prüfungs- oder Präsentationssituationen in der Lage sind, ihre optimalen Leistungen zu erbringen. Es kann sich wie eine Krankheit anfühlen und hat Ursachen in einer Prägungssituation im zurückliegenden Leben.
1.2.3 Situationen, die bei Ihnen Lampenfieber und Prüfungsangst auslösen
Welche Situationen bereiten Ihnen Probleme? In welchen Situationen möchten Sie frei, ruhig und konzentriert sein?
Teamsitzungen
Projekt- oder Produktpräsentationen
Vorträge zu Fachthemen
Vorträge mit Einsatz technischer Geräte
auf einer Bühne, einem Podest, hinter einem Rednerpult stehen
wenn alle auf Sie schauen, Sie im Mittelpunkt stehen
im „Rampenlicht“ stehen
in ein Mikrofon sprechen müssen
ein Seminar halten oder eine Veranstaltung moderieren
am Telefon oder im Radio ein Interview geben
in einem Fernsehstudio Rede und Antwort stehen
Auftraggebern Projekte erklären
schriftliche Prüfungen
mündliche Prüfungen
praktische Prüfungen mit Vorführung einer Handlungsabfolge
Kontrolle durch Vorgesetzte oder Gremien
Abschlusstest einer Weiterbildung
…
Markieren Sie sich die entsprechenden Situationen oder ergänzen Sie eine Sie betreffende Situation entweder hier ins Buch oder auf ein separates Notizblatt, in ein Notizbuch, einen Computer oder Smartphone, das Sie durch dieses Buch hindurch als Begleiter dabeihaben.
Was sind Ihre Ziele für diese Situationen?
Bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, bitte ich Sie, sich Gedanken zu machen, was Ihre Ziele in Bezug auf Ihr Lampenfieber, Ihre Auftritts- und Prüfungsangst sind. Was genau wollen Sie erreichen? Was wollen Sie nicht mehr haben und wie sollen Ihr Verhalten und Ihr körperlicher und mentaler Zustand stattdessen in Zukunft sein?
Malen Sie sich eine Skala von eins bis zehn aus für die Intensität des belastenden Gefühls von Lampenfieber oder Prüfungsangst. Null heißt, dass Sie es gar nicht wahrnehmen, zehn bedeutet, Sie fühlen sich, als ob Sie daran sterben müssten. Überlegen Sie sich, welcher Wert im Augenblick auf Sie zutrifft. Wenn Sie wirklich die Zehn nehmen, dann sollten Sie bei der nächsten Gelegenheit tatsächlich tot umfallen, sonst wars nicht die Zehn. (Mein salopper Kommentar zur Wahrscheinlichkeit des Maximalwerts.)
Schreiben Sie nun Ihre Auslöser für Lampenfieber und Prüfungsangst auf.
Machen Sie sich am besten während der Lektüre des Buches Notizen für die Entwicklung Ihres persönlichen Plans vom Lampenfieber zur Auftrittslust oder von der Prüfungsangst zum Prüfungsmut. Suchen Sie einen für Sie passenden Titel für diesen Plan, zum Beispiel:
„Mein Weg vom Lampenfieber zur Auftrittslust“ oder
„Mein Plan: weg von der Prüfungsangst, hin zu Prüfungsmut“.
Oder welche Formulierung sich für Sie gut anfühlt, anhört oder aussieht.
Welche Schritte sind die richtigen und die wichtigen für Sie? Diese können für jeden anders aussehen. Während der Lektüre sollten Sie diesen Plan des Öfteren bearbeiten, verändern und ergänzen wie immer Sie es für richtig halten. Zum Ende des Buches hin werde ich Sie nochmals daran erinnern.
2 Was tun gegen hinderndes Lampenfieber und Prüfungsangst?
Es gibt zwei Herangehensweisen an ein Problem: Entweder man kümmert sich um die Ursachen und verhindert so für die Zukunft, dass das Problem wieder auftritt. Oder man kümmert sich um die Symptome und versucht diese zu lindern.
Ein guter Arzt arbeitet natürlich an beidem.
Mein Freund Bernd* hat einen Sohn, der als Kleinkind an einem sogenannten endogenen Ekzem litt. Das sah so aus, dass die Haut des Kindes an vielen Stellen sehr rau war. Festzustellen war, dass das Ekzem manchmal stärker war und manchmal schwächer. Dies schien mit der Nahrung zusammenzuhängen, was aber nicht ausreichend belegt werden konnte. Die Eltern nahmen das an und beobachteten die Reaktionen des Kindes penibel. Das führte manchmal auch zu hysterischen Reaktionen ihrerseits. Einmal war ich zum Essen eingeladen, es gab Fisch. Das Kind aß von dem Fisch und bekam innerhalb von zehn Minuten roten Ausschlag am Kopf. Natürlich wurde es in nächster Zukunft nicht wieder mit Fisch konfrontiert. Die konsultierten Ärzte tappten im Dunkeln, was die Ursache für das endogene Ekzem war, und erklärten Reaktionen wie die auf den Fisch für allergisch. Die Therapie, die von den Ärzten in diesem konkreten Fall bevorzugt wurde, bestand darin, dass auf die rauen Hautstellen Salbe aufgetragen wurde und die Nahrungsmittel, die das Kind nicht vertrug, vermieden wurden. Dies waren vor dreißig Jahren in der damaligen DDR die Möglichkeiten, die der spezielle Kinderarzt sah – es gibt heute sicherlich andere, mehr und bessere.
Beide genannten Therapieansätze bekämpften nicht die wirklichen Ursachen, weil man die ja nicht kannte. Es konnte nur an den Symptomen therapiert werden. Wenn man die Ursache für die allergische Reaktion hätte beseitigen können, hätte das Kind ja wieder die entsprechenden Nahrungsmittel vertragen.
Es ist sehr häufig so, dass lediglich an den Symptomen gearbeitet wird, weil die Ursachen unbekannt sind. Genauso ist es bei Lampenfieber und Prüfungsangst. In den meisten Seminaren und Büchern zu diesen Themen werden Tipps gegeben und Tools vermittelt, wie man die Symptome bekämpfen kann. Dazu zählen die vielen Rhetorikratgeber.
Natürlich ist es nützlich, an der Atmung zu arbeiten, Entspannungstechniken zu erlernen und viele Dinge zu tun, die in diesem Buch vorkommen. Aber es hilft vielen Leuten nicht wirklich, wenn die Ursachen nicht erkannt und bearbeitet, sprich beseitigt oder in dem Fall besser gesagt „neutralisiert“ werden.
Es ist also gescheiter, sich erst einmal um die Ursachen zu kümmern. Und daran scheitern viele. Erstaunlicherweise gehört zum Leiden an psychischen Problemen leider oft die Angst, sich den Ursachen wirklich zu stellen. Dem Mitbegründer der Gestalttherapie Fritz Perls wird der Satz zugeschrieben: „Menschen sind oft bereit alles zu tun, außer das, was ihnen hilft.“
Auch existiert immer noch eine verbreitete Scheu, sich wegen psychischer Einschränkungen professionelle Hilfe zu holen. Viele befürchten, verrückt zu sein oder von Anderen dafür gehalten zu werden, wenn sie zu einem Psychologen gehen.
Zum Glück gibt es in der jetzigen Zeit das Instrument des Coaching. Das bieten inzwischen die verschiedensten „Berater“ an. Viele jedoch, die sich Coaches nennen, können gar nicht wirklich helfen. Sehr häufig haben sie zwar umfangreiche Lebens- und Berufserfahrung, was aus meiner Sicht auch durchaus hilfreich, allein aber nicht ausreichend ist. Beide Begriffe übrigens, sowohl Coach als auch Psychologe, sind nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen. Anders ist das beim Arzt, Diplom-Psychologen oder Heilpraktiker, die alle staatlich geprüft sein müssen. Nicht so jedoch der Coach oder Unternehmensberater oder Consultant. Und deshalb gibt es viele, die nicht gut „coachen“ und damit die Begriffe Coach oder Coaching in Verruf bringen. So machen sich Teile der Öffentlichkeit oft zu Recht lustig über den Coaching-Boom. Irgendwann braucht man dann für die gleichen Beratungen wieder ein neues Modewort. Und das wird es auch geben. Zum Beispiel als eine Art Anti-Coaching: „Mach-deine-eigenen-Erfahrungen“-Bewegung: „Erfinde das Rad lieber neu, anstatt altmodisches Coaching zu beanspruchen. Oder so.
Aber zurück zur Angst der Menschen vor professioneller Hilfe. Oft haben Menschen davon gehört, dass die Arbeit an den Ursachen seelisch sehr anstrengend, schmerzhaft und langwierig sei. Das kann auch genauso sein, wenn man die entsprechenden Verfahren anwendet. Es kann aber auch angenehm und relativ bequem sein und schnell gehen.
Ich vergleiche dies gern mit der Entwicklung von Autos. 1886, als das erste Auto fuhr, und in der Zeit danach war Autofahren ein Abenteuer und ein Riesen-Luxus zugleich. Die Überwindung einer bestimmten Distanz war zwar schneller als vorher, dennoch langwierig und oft unbequem aber aufregend. Heute gibt es sehr bequeme Autos mit viel Komfort, die für viele Menschen erschwinglich sind und schnell von A nach B bringen. Das war genau der Traum von Henry Ford.
Die Aufregung hält sich heutzutage beim „normalen“ Autofahren, wenn alle sich an die Regeln halten, in Maßen.
Ähnlich verhält es sich mit den psychotherapeutischen Verfahren. Die Psychoanalyse nach Freud ist bis heute meist eine tiefgreifende, mitunter schmerzhafte und langwierige Prozedur. Ich spreche an dieser Stelle auch aus eigener Erfahrung. Neuere psychotherapeutische Verfahren können viel schneller zu den gewünschten Ergebnissen führen, setzen sich aber schwer durch in unserer Kultur. Das hat mit den gesetzlichen Wegen der Zulassung therapeutischer Verfahren zu tun, damit diese durch Krankenkassen finanzierbar werden. Solche Anerkennungsprozeduren sind sehr langwierig und vielfach nicht mehr ganz zeitgemäß.
Erstaunlicherweise entfaltet ein erst Mitte der 1990er Jahre veröffentlichtes Verfahren eine große Breitenwirkung. Es heißt Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR, und man könnte es, im Bild des Autovergleichs bleibend, schon mit den bequemen Autos der 1990er und 2000er vergleichen, die man auch heute noch gut fahren kann. Inzwischen ist auch hier die Entwicklung weitergegangen und man hat das EMDR mit anderen gut funktionierenden Elementen, die dem Neuro-Linguistischen Programmieren NLP und der Kinesiologie entstammen, gekoppelt. Dieses Verfahren für das Coaching heißt Wingwave und wird in diesem Buch noch besprochen werden. Speziell an der Sporthochschule Köln sind Wissenschaftler und Studenten dabei, fundierte Beweise über die Wirksamkeit zu erbringen. Wingwave ist ein Coaching-Instrument für die 2000er. Wenn es sich so weiterentwickelt, wie ich es derzeit beobachte, wird daraus auch ein „Auto“ für die Zukunft.
Wir werden uns auch mit einigen anderen zeitgemäßen „Autos zum Selbstfahren“ beschäftigen, um nochmals das Sinnbild zu nutzen. Denn für Wingwave brauchen Sie am besten einen Chauffeur, sprich ausgebildeten Coach. Mit einer „PS-reduzierten Version“ können Sie auch ein bisschen „ohne Führerschein fahren“.
Ein anderes in den letzten Jahren bekannt gewordenes Verfahren ist das auf den Erkenntnissen der alten chinesischen Medizin basierende EFT (Emotional Freedom Techniques, deutsch Technik(en) der Emotionalen Freiheit), EP (Energetische Psychologie) oder MET (Meridian-Energie-Techniken). Es handelt sich um Klopftechniken entlang der Meridiane gegen Ängste; diese Verfahren sind zugleich alt (mehr als 2000 Jahre) und neu – und bequem.
Auch die europäische Schulmedizin und Pharmakologie hat sich mit dem Thema der Traumabewältigung und der Beseitigung von Problemen wie Prüfungsangst und Lampenfieber sehr intensiv beschäftigt und auch dort gibt es vielversprechende Ansätze. Mehr dazu in Kapitel 20.1.10.
Zusammenfassung
Der Komplex Lampenfieber und Prüfungsangst hat Symptome und Ursachen. In Rhetorik-Seminaren wird meist nur an Symptomen laboriert. Die Ursachen können aber mit modernen Coaching- und Psychotherapie-Verfahren sehr schnell beseitigt werden.
2.1 Woran kann man womit arbeiten?
Wie schon erwähnt, können wir an zwei Komplexen arbeiten: Symptomen und Ursachen. Am nützlichsten ist es, wir arbeiten an beidem:
an den Ursachen, um das Problem an der Wurzel zu packen und für die Zukunft möglichst für immer zu beseitigen,
an den Symptomen, um Handwerkszeug zu haben gegen die übersteigerte Aufregung in Präsentations- oder Prüfungskontexten.
Ich habe in den 1980er Jahren Schauspiel studiert, weil mir die Schauspielerei Spaß machte und mir von meiner Umgebung bescheinigt wurde, dass ich Talent hätte. Vor meiner Ausbildung spielte ich im Amateurtheater „aus dem Bauch heraus“, wie die Profis sagen. Auf der Schauspielschule musste ich dann lernen, dass es auch bei der Schauspielerei Handwerkszeug gibt, genauso wie in anderen Berufen. Dazu gehört, wie man mit sogenannten Untertexten, auch Subtexten genannt, mehr ausdrückt als im eigentlichen Rollentext steht. Aber auch, wie man sich auf der Bühne bewegt, wie man „komische Brüche“ spielt und dergleichen mehr.
In den meisten Büchern und Seminaren zum Thema Rhetorik, in welchen das Thema Lampenfieber vorkommt, gibt es Tipps und Techniken, um an den „Symptomen“ zu arbeiten. Genau genommen also, um „Handwerkszeug“ zu lernen, wie man mit seiner Unsicherheit und Aufregung besser umgeht und seinen Inhalt so sicher wie möglich und überzeugend „rüberbringt“. Wie Sie inhaltlich Argumentationen aufbauen oder Informationen vermitteln. Wie Sie mit Ihrer Körpersprache umgehen sollten und mit Ihrer Stimme.
Wer gutes Handwerkszeug besitzt, kann seine Arbeit gut machen. Das weiß jeder Techniker. Und Handwerkszeug (Werkzeuge) heißt im Englischen „Tools“. Wenn man von guten Tools erfahren und sie erstmals ausprobiert hat, kann man sie häufig noch nicht sofort gut anwenden und ganz selbstverständlich damit umgehen. Deshalb braucht es Training.
Kennen Sie folgenden Witz, den ich in einer seiner vielen Versionen in einer Kinowerbung sah? In New York fragt eine ältere Frau, mit geschientem Bein im Rollstuhl sitzend, mit heiserer Stimme einen jungen New Yorker: „Junger Mann, wie komme ich am besten zur Carnegie-Hall?“ Der Mann erwidert: „Üben, Madam, üben.“
Für jeden Musiker, Tänzer oder Sportler ist es selbstverständlich zu üben oder zu trainieren. Nur erwarten die meisten Seminarteilnehmer an Rhetorik-Seminaren, Stimm- und Sprechtrainings und anderen Kursen, dass sie nach absolviertem Seminar alles perfekt können, ansonsten taugte das Seminar nichts. Bei sehr talentierten Teilnehmern mag es sein, dass sie einiges umsetzen können. Die meisten müssen allerdings nach solchen Kursen nach möglichst vielen Übungsmöglichkeiten suchen, damit sie Sicherheit bekommen und nicht vieles wieder in Vergessenheit gerät und somit nie zur praktischen Anwendung kommt.
Eine wissenschaftliche Forschung hat hervorgebracht, dass man nach ca. 10.000 Übungsstunden eine Fähigkeit virtuos beherrscht.
Auch in diesem Buch werden wir uns zunächst mit Tools beschäftigen, die Sie auch in Seminaren lernen können:
Was will ich inhaltlich „rüberbringen“?
Was ist die beste Form für meinen Inhalt?
Wie kann ich gut argumentieren?
Welche rhetorischen Mittel kann ich anwenden?
Wie gehe ich am besten mit meiner Stimme um?
Spreche ich zu laut oder zu leise?
Ist meine Artikulation gut genug?
Welches Sprechtempo ist das Beste?
Welche Sprechübungen sind gut für mich?
Wie muss ich mich körpersprachlich verhalten?
Wie nehme ich einen festen Standpunkt ein?
Gestikulieren oder nicht gestikulieren?
Wie gehe ich mit Medien um?
Wie gestalte ich am besten Flipcharts?
Richtiges Verhalten an Tafel oder Whiteboard?
Gestaltung von Powerpoint-Folien?
Umgang mit dem Beamer oder Overhead-Projektor?
Wie gehe ich mit Störungen, Zwischenrufen, Zwischenfragen, Einwänden um?
Was mache ich, wenn ich einen Blackout habe?
Wie bereite ich mich langfristig mental vor?
Welche Entspannungstechniken kann ich nutzen?
usw. usw.
Wer verschiedene Seminare zu diesen Themen besucht, wird gut und sicher sein Wissen vortragen können, sagen konventionelle Rhetorik-Dozenten und -Trainer.
Um das Problem an der Wurzel zu packen, damit es endgültig der Vergangenheit angehört, gibt es verschiedene Ansätze sowohl im Bereich der Psychotherapie als auch des Coachings. Mit etwas Geduld und sorgfältiger Selbsteinschätzung werden Sie herausfinden, welche Hilfe für Ihre individuelle Situation die angemessene ist. Dazu einige Informationen zu den Rahmenbedingungen. Mit der Therapie ist das in Deutschland so eine Sache. Therapie setzt das Vorhandensein von Krankheit voraus. Und Krankheiten dürfen nur von staatlich geprüften Personen behandelt werden.
Psychotherapie als heilkundliche Tätigkeit ist in Deutschland nach dem Psychotherapeutengesetz den Ärzten, psychologischen Psychotherapeuten und vor dem Gesundheitsamt überprüften Heilpraktikern vorbehalten. Und auch diesen nur in ihrer ärztlichen Niederlassung beziehungsweise festgelegten Praxis, denn „das Ausüben der Heilkunde im Umherziehen ist verboten“ (vgl. Heilpraktikergesetz).
Coaching als Beratungsleistung im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe kann bei Lampenfieber und Prüfungsangst ebenfalls wirksam sein.
Verfahren, die psychische Erkrankungen behandeln und nur von zugelassenen Therapeuten durchgeführt werden dürfen, sind z.B.:
Psychoanalyse nach Freud oder C.G. Jung,
Gesprächstherapie nach Carl Rogers,
Verhaltenstherapie,
Hypnosetherapie, Tiefenhypnose,
Gestalttherapie nach Fritz Perls.
Verfahren, die als Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe auch von ausgebildeten Coaches angewandt werden dürfen, sind z.B.:
Neurolinguistisches Programmieren mit den Elementen
Time-Line-Arbeit
Arbeit mit inneren Teilen
Moment of Excellence
New Behaviour Generator
Swish
und anderen NLP-Formaten,
Wingwave, bestehend aus
Augenbewegungen aus dem EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprozessing)
Muskeltest (auch Myostatiktest oder O-Ring-Test genannt) aus der Kinesiologie
NLP-Bestandteilen,
Hypnose.
Das vermehrte Vorkommen von Anglizismen in der Aufzählung bitte ich zu entschuldigen. Die Verfahren stammen meist aus dem englischsprachigen Raum und bringen entsprechende Bezeichnungen mit.
Wir werden uns zuerst mit Tools beschäftigen, wie man seine Ausdrucksfähigkeiten verbessern kann, also mit der Arbeit an Symptomen, und dann mit den Verfahren zur Ursachenbeseitigung von Lampenfieber und Prüfungsangst. Wenn die Reihenfolge der Themen für Sie nicht passt, dann wechseln Sie doch getrost zu den Kapiteln, die Sie jetzt mehr interessieren. Ohnehin profitieren Sie von einem Sachbuch am meisten, indem Sie die Art der Lektüre selbst bestimmen.
Und die Anderen, die das Lesen Kapitel für Kapitel gewohnt sind und den Überblick über das Handwerkszeug für gute Vorträge bekommen möchten, treffen sich mit mir eben beim folgenden Abschnitt wieder.
Zusammenfassung
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, sowohl an den Symptomen als auch an den Ursachen zu arbeiten. Diese reichen von Rhetorik- und Präsentationsseminaren über Coachings bis hin zu psychotherapeutischen Verfahren.
2.2 Vorbereitung der Arbeit an den Symptomen
Bevor wir an die konkrete Arbeit für die sichere Vorbereitung eines Auftritts oder einer Prüfung gehen, an dieser Stelle Vorschläge für Arbeitsblätter, an welchen Sie während der Lektüre dieses Buches stetig weiterarbeiten können.
In den ersten beiden Arbeitsblättern geht es um die Auflistung der Symptome, die Sie von sich kennen, wenn es auf ein Ereignis zugeht. Mancher Punkt mag Ihnen zuerst merkwürdig erscheinen, erklärt sich aber später im Buch.
2.2.1 Arbeitsblatt 1: Jetzt-Zustand und Zukunftswunsch
Auf der linken Seite bitte ich Sie aufzuschreiben, wie der Ist-Zustand ist, den Sie von sich kennen. Und auf der rechten Seite beschreiben Sie Ihren Wunsch-Zustand.
Dabei sollten Sie Wert darauf legen, nicht zu allgemeine Formulierungen zu verwenden, sondern solche, mit denen Ihr Unterbewusstsein auch etwas anfangen kann.
Zum Beispiel wäre beim Punkt „Wunsch für die Zukunft“ der Satz „Ich möchte mich gut fühlen“ zu allgemein. Besser ist z.B.: „Ich möchte mich so ruhig fühlen, als ob ich einem Kind etwas geduldig erkläre“. Oder: „Ich möchte mich fühlen, als wenn ich mit guten Freunden spreche“. Formulieren Sie so konkret wie es geht und möglichst so, dass Sie das Gefühl, das Sie haben möchten, aus eigener Erfahrung kennen.
Beispiele:
Auf einer Skala von -10 bis +10 bestimmen Sie den Wert der Befindlichkeiten für die verschiedenen Aussagen sowohl für jetzt als auch für den Wunsch für die Zukunft.
Während der Lektüre des Buches können Sie sich diese Tabelle erneut vornehmen und sie verändern. Deshalb empfiehlt es sich, wenn Sie mit Papier arbeiten, einen Bleistift und Radiergummi zu benutzen. Wenn Sie immer wieder vergleichen möchten, was sich verändert hat, dann heben Sie die erste Tabelle auf und halten Sie Korrekturen in einer zweiten fest.
Auch können Sie sich ein Textdokument dazu im Computer schaffen.
2.2.2 Arbeitsblatt 2: Wahrnehmungen vor oder während dem Ereignis
Die folgende Tabelle beschreibt konkrete Wahrnehmungen vor oder während einer Prüfung oder Präsentation. Sie dient später auch der Vorbereitung der Arbeit mit den sogenannten „Submodalitäten“ (vgl. Kap. 15.8, 15.9).





























