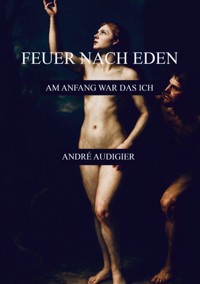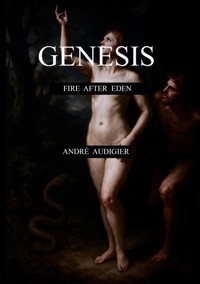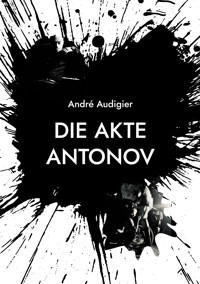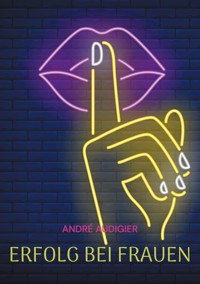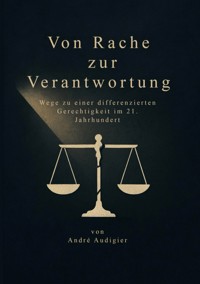
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Strafe beruhigt die Ordnung - aber heilt sie das Unrecht?" Von Rache zur Verantwortung ist ein philosophisch fundiertes, schonungslos ehrliches und zugleich engagiertes Plädoyer für ein neues Verständnis von Gerechtigkeit. Der Autor legt die historischen, psychologischen und ethischen Grundpfeiler unseres Strafsystems offen - und zeigt, warum Vergeltung als zentrales Prinzip nicht nur überholt, sondern gefährlich ist. Zwischen sakraler Schuldlogik, säkularer Machtausübung und modernen Kontrollmechanismen entlarvt er die Selbstberuhigungsstrategien einer Gesellschaft, die Strafe mit Wiedergutmachung verwechselt - und Kontrolle mit Gerechtigkeit. In einer Zeit zunehmender Polarisierung, institutioneller Immunisierung und gescheiterter Resozialisierungsversprechen entwirft dieses Buch eine andere Vision: Verantwortung statt Rache, Beziehung statt Ausschluss. Zwischen Foucault und Arendt, Beccaria und Levinas entsteht ein Panorama, das unbequem ist, aber notwendig - für alle, die Gerechtigkeit nicht nur als System, sondern als Haltung begreifen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 35
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I. Grundlagen und Herausforderungen moderner Gerechtigkeit
1. Vorwort Die Dialektik von Fortschritt und Stagnation
2. Die Architektur der modernen Gerechtigkeit
3. Die Selbstberuhigung der Ordnung Wenn das Recht sich selbst immunisiert
4. Zwischen Beccaria und Levinas Das Ideal der Verhältnismäßigkeit – und seine Leerstelle
5. Täter, Opfer, Staat Drei Stimmen – und ein verschütteter Dialog
6. Der blinde Fleck der Institution Wenn Systeme sich selbst belohnen
7. Gerechtigkeit als soziale Praxis
8. Ein neues Verständnis von Schuld
9. Zwischen Macht und Menschlichkeit
II. Philosophisch-anthropologische Reflexionen: Strafe, Macht und Verantwortung
10. Warum wir über Strafe und Leid grundlegend neu nachdenken müssen
11. Die Grenzen der Vergeltung
12. Das doppelte Leid Täter*innen, Opfer und Gesellschaft
13. Aufbruch zu einem neuen Gerechtigkeitsverständnis
III. Historische Tiefenschärfe: Eine Genealogie der Strafe
14. Von der Gerechtigkeit zur Entmenschlichung
15. Die Ursprünge: Vergeltung und sakrale Ordnung
16. Aufklärung, Menschenrechte – und der Schein des Fortschritts
17. Perversion der Justiz – einst und jetzt
18. Die gegenwärtige Realität Entmenschlichung unter dem Deckmantel der Ordnung
IV. Strafe im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis
19. Zwischen Vergeltung, Abschreckung und Resozialisierung
20. Vergeltung: die Forderung nach Gerechtigkeit
21. Abschreckung: Prävention durch Furcht?
22. Resozialisierung: der humanistische Ansatz
23. Das Spannungsfeld: Schutz der Gesellschaft versus individuelle Freiheit
24. Ethik der Strafe Mehrdimensional und dynamisch
25. Philosophische Reflexion Hannah Arendt und das Verhältnis von Strafe und Macht
26. Fazit Strafe als komplexes ethisches Spannungsfeld
V. Perspektiven und Visionen für eine gerechte Zukunft
27. Jenseits der Strafe Wege zu einer gerechten und humanen Gesellschaft
28. Restorative Justice Wiederherstellung statt Vergeltung
29. Empathie und Verantwortung Der ethische Kern der Rehabilitation
30. Gesellschaftlicher Wandel Prävention durch Bildung und soziale Gerechtigkeit
31. Strafe als politisches und gesellschaftliches Instrument
32. Das Ideal der Gerechtigkeit Versöhnung statt Vergeltung
33. Ausblick Die Zukunft der Strafpraxis
VI. Zusammenfassung und Appell
34. Zusammenfassung und Appell Für eine gerechte und menschenwürdige Zukunft
35. Philosophische Vielfalt als Schatz der Weisheit
36. Ein globaler Appell an Politik und Gesellschaft
37. Abschließende Gedanken
I. Grundlagen und Herausforderungen moderner Gerechtigkeit
Vorwort
Die Dialektik von Fortschritt und Stagnation
In der Geschichte der Menschheit vollzieht sich ein paradoxes Schauspiel: Während in der Medizin Krankheiten geheilt werden, die früheren Generationen das Leben kosteten, während Kommunikationstechnologien entwickelt werden, die Kontinente verbinden, und während die Menschheit beginnt, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln, verharrt das Nachdenken über Gerechtigkeit häufig in jahrtausendealten Reflexen der Vergeltung.
Doch dieses Bild wäre unvollständig ohne eine entscheidende Nuancierung: Gerade Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte auf dem Weg zu einem humaneren Strafrechtssystem gemacht. Das Grundgesetz mit seinem unantastbaren ersten Artikel, die Betonung der Resozialisierung als Verfassungsauftrag, die Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 1949, innovative Konzepte wie der Täter-Opfer-Ausgleich oder die therapeutischen Gemeinschaften im Strafvollzug – all dies zeigt, dass Wandel möglich ist. Im internationalen Vergleich steht Deutschland mit seinem differenzierten Sanktionensystem, seiner richterlichen Unabhängigkeit und seinen rechtsstaatlichen Garantien an der Spitze progressiver Justizreformen.
Dennoch – oder gerade deshalb – drängt sich eine kritische Reflexion auf: Welche ethischen Maßstäbe können die bereits erreichten Standards weiter verfeinern? Wie ist mit den Grenzen humaner Strafpraxis umzugehen, wenn Resozialisierung scheitert oder Täter therapeutische Einsicht verweigern? Und wie können die berechtigten Ansprüche auf Sicherheit mit den Idealen der Menschenwürde in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden?
Solche Fragen führen nicht zu simplen Antworten, sondern verlangen nach einer differenzierten Ethik der Verantwortung, die sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen menschlicher Wandlungsfähigkeit ernst nimmt.
Die Architektur moderner Gerechtigkeit
Das deutsche Strafrechtssystem hat in den vergangenen Jahrzehnten Reformen vollzogen, die international als wegweisend gelten. Die Einführung der Bewährungsstrafe als Regelfall bei Ersttätern, die Entwicklung therapeutischer Ansätze im Maßregelvollzug, die Professionalisierung der Bewährungshilfe, die Etablierung von Konfliktschlichtungsverfahren – daran wird sichtbar, dass Reform nicht nur denkbar, sondern realisierbar ist.