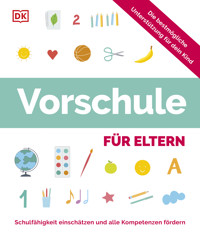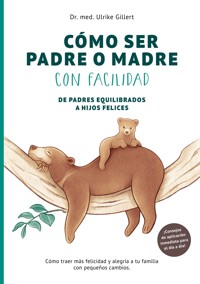Vorschule
FÜR ELTERN
S[]
Schulfähigkeit einschätzen und alle Kompetenzen fördern
Die bestmögliche
Unterstützung für dein Kind
Vorschule
Schulfähigkeit einschätzen
und alle Kompetenzen fördern
FÜR ELTERN
Dorling Kindersley Verlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München
Ein Unternehmen der Penguin Random House Group
Alle Rechte vorbehalten
© 2025
Deutsche digitale Ausgabe, 2025
Dorling Kindersley Verlag GmbH
Jegliche – auch auszugsweise – Verwertung, Wiedergabe, Ver-
vielfältigung oder Speicherung, ob elektronisch, mechanisch, durch
Fotokopie oder Aufzeichnung, bedarf der vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen,
insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen
gemäß § 44b UrhG (Text und Data Mining) zu gewinnen,
ist untersagt.
Texte Kerstin Beug, Ulrike Gillert
Lektorat Birgit Reit
Herstellungskoordination Claudia Rode
Herstellung Stefanie Staat
Projektbetreuung Dr. Kerstin Schlieker
Satz und Layout Anna Ponton
Für den DK Verlag:
eISBN 9783831084517
59022830322423201
www.dk-verlag.de
historischen Fakten entspricht; stellenweise wird aus Platzgründen
oder Gründen der besseren Lesbarkeit jedoch das generische
Maskulinum verwendet.
Der DK Verlag erkennt alle geschlechtlichen Identitäten an.
Nach Möglichkeit wird im Buch eine gendergerechte Sprache
berücksichtigt, sofern dies inhaltlich sinnvoll ist bzw. den
Ein Hinweis zu geschlechtlichen Identitäten
DIE AUTORINNEN
Dr. med. Ulrike Gillert, geb. 1964, ist seit 1991 als Kinder- und Jugendärztin und seit 2007 als Psycho-
und Traumatherapeutin tätig. In ihrer Praxis in Berlin begleitet sie jährlich in über 8.000 Konsultationen große
und kleine Patienten und bietet Eltern sowie ihren Kindern umfassende Unterstützung in allen Phasen der
kindlichen Entwicklung – von der Geburt bis ins junge Erwachsenenalter. Als Mutter von drei inzwischen
erwachsenen Kindern kennt sie nicht nur die fachlichen, sondern auch die praktischen Herausforderungen
der Erziehung und Familienführung. Ihre Ausbildung zur Seminarleiterin hat sie bei dem dänischen Fami-
lientherapeuten Jesper Juul persönlich abgeschlossen. Sie lernte außerdem u. a. von Marshall Rosenberg,
Gerald Hüther, Thich Nhat Hanh, Maria Aarts, Karl-Heinz Brisch uva.. Ihr fundiertes Wissen und ihre Erfahrung
fließen in ihre Arbeit als Gründerin der Dr. Gillert Akademie ein, die Eltern mit praxisnahen Coachings und
Weiterbildungen zur bedürfnisorientierten Elternschaft unterstützt.
Kerstin Beug, geb. 1969, ist bei einem Diakonischen Träger in München als Bereichsleitung für 11 Kitas und
Leiterin der Schulbezogenen Jugendsozialarbeit tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin arbeitete sie über
dreißig Jahre in Bildungsreinrichtungen für Kinder von 0 – 6 Jahren, davon 25 Jahre als Einrichtungsleitung
mit dem Schwerpunkt der Vorschulischen Bildungsförderung. Sie studierte berufsbegleitend Soziale Arbeit
und erwarb hierin den Bachelor (B.A.). Seit mehreren Jahren arbeitet sie in der Ausbildung für Ergänzungs-
kräfte in Kitas und der Fortbildung für pädagogisches Personal zu Themen, die sich auf die Altersgruppe von
0–10 Jahren beziehen.
Vorwort
Unglaublich, wie schnell diese Jahre vergangen sind: Gerade eben erst ist dein Kind
geboren worden und jetzt denkst du schon über die Schule nach. Um dich und
dein Kind in den Jahren vor der Einschulung unterstützen zu können, ist dieses
Buch entstanden. Sicherlich willst du, dass dein Kind einen guten Schulstart erlebt,
und fragst dich: Wie kann ich mein Kind bestmöglich vorbereiten? Was ist, wenn es
sprachlich noch nicht so weit ist? Sollte es schon ein bisschen lesen können oder
langweilt es sich dann in der Schule? Was sollte ich üben? Darf ich meinem Kind
schon rechnen beibringen, wenn es sich gerade dafür interessiert? Ist mein Kind
überhaupt schon schulreif? Was ist, wenn mein Kind zwar schlau ist, sich aber nicht
konzentrieren kann? Langweilt es sich, wenn ich es noch ein Jahr länger in der Kita
lasse? Diese und viele andere Fragen treiben Eltern um und dieses Buch beleuchtet
sie auf vielfältige Weise.
Die Jahre zwischen dem dritten Geburtstag und der Einschulung – egal, ob sie mit
sechs oder sieben Jahren stattfindet – sind eine wunderbare Zeit, in der wir die Welt
mit unseren Kindern neu erkunden. Wir können diese Zeit oft noch entspannter
genießen, wenn wir mehr darüber wissen, wie wir unsere Kinder so fördern kön-
nen, dass sie zur Einschulung alle wichtigen Fähigkeiten haben, um in dem neuen
Lebensabschnitt Schule gut klarzukommen, ja, ihn vielleicht auch mit Freude und
gutem Selbstbewusstsein erleben zu können. Hier hilft Wissen darüber, wie unser
Gehirn funktioniert, wie wir spielerisch bestimmte Fähigkeiten wie beispielsweise
die Stifthaltung oder die Empathiefähigkeit fördern können. Eltern treibt auch um,
wie viel Medienzeit ihre Kinder haben sollten und welche körperlichen und moto-
rischen Voraussetzungen für den Schulstart wichtig sind. Was ist, wenn mein Kind
ein Handicap hat oder in der Entwicklung zurück ist? Muss es vor der Einschulung
vielleicht noch Förderung erhalten, beispielsweise eine Logopädie oder eine Ergo-
therapie? Auch auf diese Fragen findest du hier Antworten.
Die meisten Kinder fiebern der Schule entgegen. Darauf vorbereitet zu sein, hilft.
Denn mit dem ersten Schultag ändert sich eine ganze Menge. Der Tagesablauf
wird durch die Schule geprägt. Das beginnt mit dem Aufstehen am Morgen und
endet mit dem rechtzeitigen Zubettgehen am Abend. Während bisher die Familie
die größte Rolle gespielt hat, werden nun Freunde noch wichtiger. Welche sozial-
emotionalen Fähigkeiten braucht mein Kind, um gute Freundschaften zu schließen?
Was ist mit der Anstrengungsbereitschaft und dem Durchhaltevermögen meines
Kindes, auch in herausfordernden Situationen? Kann ich meinem Kind helfen, diese
Fähigkeiten zu trainieren? Auch die Atmosphäre in der Familie hat einen großen
Einfluss darauf, ob ein Kind sich normal entwickeln und gut lernen kann oder
vielleicht Angst haben muss, etwas »falsch« zu machen. Welche Schulausrüstung
braucht mein Kind?
Das vorliegende Buch bietet eine Fülle an Spielideen, Anregungen, Perspektivwech-
seln, Fördermöglichkeiten und Hintergrundwissen. Es soll dir und deiner Familie
die größtmögliche Freude mit und an deinem Kind in der Vorschulzeit ermöglichen
und euch die Grundlagen von Allgemeinbildung, gutem zwischenmenschlichen
Miteinander und vielfältigen Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln. Jeder Aspekt
wird durch Üben besser und führt zu einem besseren Selbstwertgefühl und Selbst-
vertrauen deines Kindes. Auch das Sprechen über Gefühle kann man lernen und
verstehen, dass Menschen unterschiedliche Empfindungen und Grenzen haben.
Wie kann ich meine Grenzen so setzen, dass die kindliche Seele dabei nicht verletzt
wird? Ebenso lernen wir das soziale Miteinander in den ersten Lebensjahren. Es
bildet die Basis für das gesamte weitere Leben. Dabei spielen wir Eltern als Vorbilder
die wichtigste Rolle.
Wir hoffen, dir, liebe Mama und dir, lieber Papa, mit diesem Buch ein an der Praxis
orientiertes Hilfsmittel an die Hand zu geben, das dir bewusst macht, was alles
dazu gehört, dass dein Kind sich in einer guten Atmosphäre entwickeln, sich selbst
ausprobieren und die Fähigkeiten erwerben kann, die es dann zur Einschulung
braucht. Ein Kind entwickelt sich am besten, wenn jeder in der Familie er oder sie
selbst sein darf und die Atmosphäre entspannt ist. Wir haben daher zusammenge-
tragen, was dich befähigt, dich gut um dich selbst und euch als Familie zu kümmern
und deinem Kind Rückenwind zu geben.
Wir wünschen dir, dass die Vorschulzeit auf diese Weise zu einer großartigen Zeit
des gemeinsamen Entdeckens unserer wunderschönen Erde und unseres gemein-
samen Aufeinander-Bezogen-Seins werden lässt.
Ulrike Gillert und Kerstin Beug
Inhalt
Vorwort
Die Themen im Überblick
Die allgemeine Entwicklung
von Kindern
Die ersten sechs Lebensjahre
Was bedeutet »schulreif«?
Vorschulbegleitung fängt früh an
Das Spiel des Kindes
Planung und Freizeit
Familiäres und soziales Umfeld
Wie wir als Eltern gut für uns sorgen
Wie wir als Paar gut für uns sorgen
KÖRPERLICHE
1 ENTWICKLUNG
Unser Gehirn – Wunderwerk der Natur
Der »Gehirnfahrstuhl«
So lernt unser Gehirn
Warum Bewegung so wichtig ist
Praktische Alltagsübungen zur Bewegung
Spiele und Ideen zur Bewegung
Grobmotorik
Praktische Alltagsübungen zur Grobmotorik
Feinmotorik
Die Stifthaltung
Spiele und Ideen zur Feinmotorik
Rechts-/Linkshändigkeit
32
34
36
40
42
44
46
48
50
52
54
58
6
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
GEISTIGE
2 ENTWICKLUNG
Geist und Verstand
Die Welt aus der Sicht des Kindes
Allgemeinbildung
Wie lernen Kinder?
Neugierde und Merkfähigkeit
Motivation
Die kindliche Sprachentwicklung
Mehrsprachigkeit
Miteinander sprechen
Sprache im Alltag
Konzentration
Konzentration trainieren
Alle Sinne fördern
3
62
64
66
70
74
76
78
80
82
84
86
88
90
EMOTIONALE UND
SOZIALE ENTWICKLUNG
Die kindliche Identität
Selbstvertrauen
Gefühle
Der Umgang mit Gefühlen
Umgang miteinander
Ich in meiner Umwelt
Soziales Verhalten lernen
Rollenspiele
Empathie und Selbstempathie
Frustrationstoleranz
Sozialkompetenz
Achtsamkeit
Rituale
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
118
120
4
ÄRZTLICHE
VORSORGE UND
AUFFÄLLIGKEITEN
Vorsorgeuntersuchungen
Die Schuleingangsuntersuchung
Verhaltensauffälligkeiten
ADHS
Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung
Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungs-
störung
5
KENNTNISSE UND
FÄHIGKEITEN VOR
SCHULBEGINN
Was sollte ein Vorschulkind
mitbringen?
Was gehört noch dazu?
Den Alltag bewältigen
Digitale Medien
Die Schulausrüstung
Leseförderung im Vorschulalter
Zahlen, Mengen und Gewichte
Umgang mit Krisen
140
144
146
150
152
156
158
160
ANHANG
124
126
128
132
134
136
Häufige Fragen mit Antworten
Register
Dank, Bildnachweis und Quellen
164
166
168
10
Die Themen im Überblick
Praktische
Alltagsübungen
Grobmotorik
Feinmotorik
Unser
Gehirn
Praktische Alltagsübungen
Spiele und Ideen
Bewegung
Spiele und Ideen
Die Stifthaltung
Körperliche
Entwicklung
Sprach-
entwicklung
Sprache
im Alltag
Mehr-
sprachigkeit
Sprache
Allgemeinbildung
Wie lernen Kinder?
Motivation
Konzentration
Konzentration
trainieren
Neugierde und
Merkfähigkeit
Entwicklung
Geistige
Soziales Verhalten
lernen
Umgang
miteinander
Rollenspiele
Gefühle
Rituale
Achtsamkeit
soziale Entwicklung
Emotionale und
Bereit für
die Schule!
DIE THEMEN IM ÜBERBLICK
11
Vorsorge-
untersuchungen
Schuleingangsuntersuchung
Verhaltensauffälligkeiten
Autismus
ADHS
Ärztliche Vorsorge
und Auffälligkeiten
Auffälligkeiten in der
Sprachentwicklung
Auditive Verarbeitungs-
und Wahrnehmungsstörung
Kenntnisse und
Fähigkeiten
Die Basiskompetenzen
Den Alltag bewältigen
vor Schulbeginn
Leseförderung
Digitale Medien
Umgang mit Krisen
Kindliche Identität
Die Schulausrüstung
Sozialkompetenz
Frustrationstoleranz
12
Die allgemeine Ent-
wicklung von Kindern
Kinder sind unterschiedlich und entwickeln
sich unterschiedlich.
Alle Eltern, die zwei oder mehr Kinder oder Geschwister haben,
wissen das: »Die Große hat immer zwölf Stunden durchgeschlafen,
mochte nie Brei, konnte erst mit drei Jahren sprechen, war moto-
risch viel geschickter als andere, war schon mit anderthalb Jahren
trocken …«
Gibt es eine Entwicklungsnorm?
Ja, die Entwicklungsschritte laufen regelhaft in der gleichen Reihenfolge ab.
Wann aber diese Schritte gemacht werden, hängt von zahlreichen Faktoren ab
und kann von Kind zu Kind, sogar bei eineiigen Zwillingen, sehr unterschiedlich
sein. Körperliche Faktoren wie beispielsweise lange oder kurze Arme und Beine
oder verschieden aufgebaute Gehirne bilden eine »Grundausstattung«, die dazu
führt, dass das eine Kind schnell rennen kann, das nächste mit den Händen ge -
schickt ist und für wieder ein anderes Mathe leicht und das Malen, Schreiben
oder Lesen eher schwierig ist. Normvorstellungen sind in den meisten Fällen Fehl-
erwartungen. Als Eltern können wir es uns und unseren Kindern sehr viel leichter
machen, wenn wir die Kinder so akzeptieren, wie sie sind.
SIEHE AUCH
Die ersten sechs Lebensjahre
Vorschulbegleitung fängt früh an 18–19
Familiäres und soziales Umfeld
Geist und Verstand
Die kindliche Identität
Rituale
14–15 ›
›
24–25 ›
62–63 ›
94–95 ›
120–121 ›
INTERESSANT
Neigungen fördern
Unsere Kinder besonders in den Dingen
zu unterstützen, die sie gut können,
und ihnen Aufmerksamkeit zu geben,
fördert ihren Selbstwert. Mit einem
guten Selbstwertgefühl können wir
dann entspannter, ohne Druck und mit
Spaß und Humor mit ihnen üben, wenn
ihnen das Schaukeln, Lesen, die Stifthal-
tung oder etwas anderes schwerfällt.
Entwicklungsfenster bei Babys und Kleinkindern
Buchstaben erkennen und
den eigenen Namen schreiben
(4–6 Jahre)
Sprechen: Ein-Wort-Sätze,
»Mama«, »Papa«
(11–18 Monate)
Freies Laufen (9–18 Monate)
Laufrad oder Roller
fahren (2–4 Jahre)
… 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Monate
2
Jahre
Sprechen: Zwei-Wort-Sätze
(18–24 Monate)
Fahrrad fahren (3–6 Jahre)
3
4
5
6
DIE ALLGEMEINE ENT WICKLUNG VON KINDERN
Vier Faktoren, die zu einer unter-
schiedlichen Entwicklung führen:
13
Ȇbung macht
den Meister.«
Wieder andere Kinder sind sprachlich oder
musikalisch sehr begabt. Die genetischen
erleichtert es dem einen Kind, zu
rechnen, dem anderen zu sprinten.
1. Die Veranlagung
Die genetische Ausstattung
verschaltet ist, oder ein Kind erbt das absolute Gehör
der Mutter oder des Großvaters.
Menschen aus Kenia und Äthiopien können z. B.
leichter schnell laufen. In anderen Familien zeigt sich
eine mathematische Begabung, weil das Gehirn anders
tomie auf verschiedene Weise Krabbeln, Laufen
und alle anderen motorischen Fähigkeiten lernen.
Unterschiede führen dazu, dass ein Kind lange,
das andere kurze Extremitäten hat, sodass die
beiden aufgrund ihrer unterschiedlichen Ana-
2.
Die Umwelt
Die Eltern und alle,
die etwas mit dem Kind zu
tun haben, fördern es auf unter-
schiedliche Weise.
Förderndes Beispiel: In der Familie
Mozart nahm Musik einen großen Stellen-
wert ein. Amadeus hörte seit seiner Geburt
sehr viel Musik und wurde schon früh in diese
Welt eingeführt. Er hatte vielseitige musikalische
Herausforderungen und wurde von mehreren Fami-
lienmitgliedern gefördert.
Beispiel, das zu verzögerter Entwicklung führt:
Eine Mutter, deren Kind während der Vorsorge mit sechs
Monaten gar nicht lautierte, aber gut hörte, fragte ich, ob
sie mit dem Kind spreche. Sie antwortete mir: »Nein, meine
Tochter versteht ja noch nichts.« Dieses Kind wurde also in
Bezug auf Sprache bis dahin überhaupt nicht gefördert und
gefordert.
3. Zeit zum Üben
Von Milton Erickson wird erzählt, dass er durch seine
einjährige Kinderlähmung sehr viel Zeit zum Beobach-
ten hatte. Die vielen Stunden Übung im Beobachten
von Menschen ermöglichten es ihm etwa, an der Stirn
zu erkennen, dass eine Frau schwanger war, noch
bevor diese selbst es wusste. Seine Fähigkeiten
nutzte er später in seinem Beruf als Psychothera-
peut. Entsprechend entwickeln auch Gehörlose
ihr Sehvermögen deutlich stärker, ebenso
wie Blinde ihr Hörvermögen. Fähigkeiten
wie Malen, Fahrradfahren, Schwimmen,
Ein fühlung in andere, Singen, Klettern,
Balancieren usw. müssen zum Teil
viele Jahre lang geübt werden,
bevor wir sie gut und sicher
beherrschen.
4. Die Grundbedürfnisse eines Kindes müssen
erfüllt sein.
Dieser Punkt wird oft vergessen, ist aber die Voraus-
setzung für jegliches Lernen. Grundbedürfnisse sind:
Gesundheit, Liebe, Zuneigung, ausreichend Essen,
Trinken, Schlaf, Geborgenheit und Sicherheit, d. h.
Gewaltfreiheit in der Familie und außerhalb, also
Frieden. Sind diese Dinge nicht gegeben, ist das
Kind vor allem mit ihnen beschäftigt. Kranke,
müde, hungrige, durstige Kinder oder Kinder,
die Angst haben, können nicht gut – ja, zum
Teil gar nicht – lernen.
14
Die ersten
sechs Lebensjahre
Prägende Erfahrungen für ein ganzes Leben
Wie unsere Kinder in den ersten sechs Lebensjahren aufwachsen
und was wir ihnen in dieser Zeit vorleben, bildet die Grundlage
für ihr weiteres Leben.
Frühe Prägung
Von der Evolution ist es so eingerichtet, dass das, was wir am Anfang unseres Lebens
erleben und lernen, ungefiltert und unbewertet von Lebenserfahrungen als »gut
und richtig« auf der »Festplatte« unseres Gehirns eingraviert wird. Das ist so, weil die
Kinder, die am Nordpol, in der Wüste, in einem Dschungel oder in einer Großstadt
aufwachsen, grundlegend unterschiedliche Umgebungen und Lebensbedingungen
haben und entsprechend sehr unterschiedliche Dinge lernen müssen.
Chance oder Hindernis?
Diese ersten Lebensjahre sind also eine riesige Chance, können aber bei schwieri-
gen Bedingungen auch zu großen Belastungen und Schwierigkeiten für das Kind
führen – manchmal für das ganze Leben. In jedem Fall sind diese sechs Jahre eine
große Verantwortung für alle, die etwas mit Kindern zu tun haben. Ungewollt werden
uns einige der wichtigsten Dinge im Leben oft weder zu Hause noch in der Kita oder
anderen Bildungseinrichtungen beigebracht: Wie wir glücklich werden und wie wir
gut mit uns selbst und unserem jeweiligen Gegenüber umgehen, sodass es allen gut
geht (siehe S. 28–29). Im Elternhaus und in der Kita machen Kinder in dieser Hinsicht
erste Erfahrungen, doch das allein reicht oft nicht aus. Daher ist es sinnvoll, dass ein
Kind neben den Hauptbezugspersonen auch viel Kontakt zu anderen hat (Großeltern,
übrige Familie, Freunde). So lernt es eine größere Vielfalt kennen, denn alle gehen mit
ähnlichen Situationen unterschiedlich um.
INTERESSANT
Der Begriff »Flow«
Der Begriff »Flow« wurde von Mihály Csíkszentmihály geprägt.
Er beschreibt Flow als einen Zustand völliger Hingabe und
Fokussierung auf eine Sache oder Tätigkeit. Wir fühlen uns
dadurch kompetent und erfolgreich. Das geht so weit, dass
wir sogar das Zeitgefühl verlieren und körperliche Bedürfnisse
wie z. B. Hunger, Durst, Harndrang oder Müdigkeit nur noch
eingeschränkt wahrnehmen. In diesem Zustand, wenn wir z. B.
ein Bild malen, Musik machen oder hören, einen Text schreiben
oder spielen, fühlen wir uns vollkommen glücklich. Wenn ein
Kind im Flow ist, lernt es am besten.
SIEHE AUCH
‹ 12–13 Die allgemeine Entwicklung
von Kindern
Das Spiel des Kindes
Planung und Freizeit
Familiäres und soziales Umfeld
Selbstvertrauen
20–21 › 22–23 › 24–25 › 96–97 ›
Dann kann ich ungestört die Welt
erkunden und tun, wonach ich mich
fühle. Ich kann in der Buddelkiste
Sand durch die Finger rinnen
lassen, Käfer beobachten oder
selbst gebaute Boote schwimmen
lassen. Für mich sind das sinnvolle
Tätigkeiten.
Durch Kuscheln fühle
ich mich ohne Worte
geliebt. Dabei erhole
ich mich und tanke auf.
Die Verbindung mit der Natur
stärkt alles in mir. Durch Beob-
achten und Erleben des Wer-
dens und Vergehens, z. B. durch
eigenes Anbauen von Blumen,
Obst oder Gemüse, lerne ich
sehr viel über die Welt.
Ich möchte besser werden
im Laufen, Springen, Klet-
tern, Fahrradfahren, Schwim-
men … Wie viel Bewegung
ich brauche, kannst du dir
kaum vorstellen.
Um ein Kind zu erziehen
braucht es ein ganzes Dorf.
Afrikanisches Sprichwort
DIE ERSTEN SECHS LEBENSJAHRE
Bitte gestalte Aufgaben für
mich so, dass ich sie schaffe
und zu den Schlussfolgerun-
gen komme: »Ich kann das«,
»Ich kann es lernen« oder »Ich
kann es schaffen, auch wenn
es anstrengend ist«.
Dies ist für mich auch wichtig,
wenn ich deinen Erwartungen
oder denen anderer Personen
nicht entspreche.
Bitte lass mich etwas ohne
Unterbrechung machen, egal
was, wenn es möglich ist.
15
Gib mir dafür Zeit und bei
Bedarf das Material, das ich
brauche.
Ich mag es,
wenn du für
mich eine
»Erfolgs-
atmosphäre«
erzeugst.
Ich liebe meine
Forscherzeit.
Ich möchte
akzeptiert
und ange-
nommen
sein, so, wie
ich bin.
Ich komme gern
in den Flow.
Ich liebe es,
kreativ zu sein.
Da geht es mir am
besten, ich fühle mich
wohl und zu Hause. Lass
mich dort sein. Gestern,
morgen oder später
stressen dich und mich.
Kuscheln und
Pausen liebe ich.
Ich liebe es, Zeit
in der Natur zu
verbringen.
Ich will in Bewe-
gung sein und
meinen Körper
ausprobieren.
Was macht das Leben
lebenswert?
Was macht Kinder
glücklich?
Aus der Sicht eines Vorschulkindes
könnte sich das so anhören:
Ich bin von Natur
aus im Hier und
Jetzt.
Ich fühle mich wohl, wenn
du mich mit Neuem kon-
frontierst und mir dein
Vertrauen schenkst.
Ich möchte
mit dir in
Beziehung
sein.
Ich möchte
eigene kind-
liche Projekte
machen können.
Ich möchte
spielen und
so erfahren,
wie das Leben
funktioniert.
Ich möchte
gern sorgen-
frei sein.
Dadurch lerne ich, mit
verschiedenen Situa-
tionen immer besser
umzugehen.
Ich will sie planen, durch-
führen und mit so wenig
Hilfe wie möglich – aber so
viel wie nötig – zum erfolg-
reichen Abschluss bringen.
EinszueinsZeit mit beiden Eltern,
einzeln oder zusammen, Zeit mit
Geschwistern oder Freunden, Zeit mit
Großeltern oder anderen Verwandten,
tut mir sehr gut und hilft mir, ein
gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln.
In Rollenspielen wie VaterMutterKind, Kita, Schule
oder Arzt fühle ich mich wie die Mama, Superman oder
eine Filmfigur, mal mächtig und mal unterlegen und
verstehe so, was um mich herum vorgeht. Es kann aber
auch kreatives Bauen mit Lego® oder anderen Steinen
oder Materialien sein, ebenso wie Regelspiele.
Ich will keine Nachrichten hören oder sehen müssen
und eure Ängste und Sorgen nicht erfahren. Wenn
ich weiß, dass ihr euch um diese schwierigen The-
men kümmert, muss ich eure Sorgen nicht tragen.
Wenn ihr es nicht tut, versuche ich automatisch,
eure Lasten zu tragen und eure Probleme zu lösen.
Dafür bin ich aber zu klein.
16
Was bedeutet
»schulreif«?
Schulreife – Schulfähigkeit – Schulbereitschaft
Die meisten Kinder besuchen spätestens ab dem dritten Lebensjahr
bis zum Schuleintritt einen Regelkindergarten und nehmen im letz-
ten Kindergartenjahr am Vorschulprogramm der Einrichtung teil.
Die Kindergartenzeit
Im ersten Kindergartenjahr sind die Dreijährigen noch die »Kleinen«. Sie werden von
den großen Kindergartenkindern liebevoll aufgenommen und behütet. Vom päda-
gogischen Personal werden sie intensiv begleitet, denn viele von ihnen erleben den
ersten großen Schritt aus dem Elternhaus und damit einen wichtigen Übergang.
Im zweiten Kindergartenjahr, zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr, stecken
die Kinder meist in einer Art Sandwichposition. Sie gehören jetzt nicht mehr zu den
»Kleinen«, sind aber auch noch nicht so groß wie die Vorschulkinder. In diesem Ent-
wicklungsfenster durchleben die Kinder die sogenannte »magische Phase«. Alles,
woran das Kind denkt und was es sich wünscht, wird von ihm tatsächlich für möglich
gehalten. Dies können schöne Dinge sein, aber auch sehr schreckliche, wie beispiels-
weise Monster, die ins Zimmer eindringen. Wer denkt da schon an die Schule? Doch
dann befinden sich die Kinder plötzlich im letzten Jahr vor der Einschulung und die
Eltern stellen sich die Frage: Ist mein Kind schulreif?
SIEHE AUCH
Vorschulbegleitung fängt früh an 18–19
Grobmotorik
Feinmotorik
Allgemeinbildung
Motivation
Konzentration
Soziales Verhalten lernen
›
46–47 ›
50–51 ›
66–69 ›
76–77 ›
86–87 ›
Die Schuleingangsuntersuchung 126–127
106–107 ›
›
Am häufigsten finden
wir heute den Begriff
Schulfähigkeit.
HINWEISE UND TIPPS
In diesem Buch wird die Bezeichnung
Kita sowohl für den Kindergarten
als auch für alle anderen Bildungs-
einrichtungen für Kinder im Alter
von 1–6 Jahren verwendet.
Schulreife
Schulfähigkeit
»Schulreife« ist ein sehr veralteter
Begriff aus den Jahren zwischen
etwa 1950 und 1970. In diesem
Kontext hatte man noch nicht alle
Fähigkeiten, Kompetenzen und
individuellen Eigenschaften der
Kinder im Blick. Man ging davon
aus, dass jedes Kind während seines
Reifungsprozesses alle Fähigkeiten
und Fertigkeiten erwerben würde,
die zur Bewältigung der schulischen
Anforderungen notwendig waren.
Von der »Schulfähigkeit« begann
man etwa um 1970 zu sprechen.
Zunächst standen weiterhin die
kognitiven Fähigkeiten und Fertig-
keiten für einen erfolgreichen
Schulbesuch im Fokus, die ein Kind
unter anderem durch Förderung
erwerben sollte. Heute wird Schul-
fähigkeit dagegen ganzheitlich
betrachtet, und am Prozess ihrer
Erlangung sind neben dem Kind
auch Eltern, Kindergarten und die
Schule beteiligt.
Schulbereitschaft
Die »Schulbereitschaft« ist heute
ein ebenso gängiger Begriff, da er
die sozialen und motivationalen
Kompetenzen als eine wichtige
Voraussetzung zusätzlich in den
Fokus rückt. Ein Kind soll nicht nur
ein bestimmtes kognitives und
motorisches Niveau erreicht haben,
sondern auch Konzentrationsfä-
higkeit und Leistungsbereitschaft
mitbringen und sich in die Klassen-
gemeinschaft einfügen können.
WAS BEDEUTE T »SCHULREIF« ?
Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Einschulung?
Die einzelnen Bundesländer unterliegen verschiedenen Richtlinien. Erfreulicherweise
ist derzeit wieder eine Zurückstufung des Einschulungsstichtags zu beobachten.
Wenn ein Kind im Sommer sechs Jahre alt wird, können die Eltern in einigen Bundes-
ländern entscheiden, ob es noch ein weiteres Jahr den Kindergarten besuchen oder
bereits im Herbst eingeschult werden soll.
Bei Unsicherheit empfiehlt sich stets eine Rücksprache mit den Fachkräften der Kita,
der Kinderärztin oder dem Kinderarzt oder verschiedenen Beratungsstellen. Diese
Entscheidung sollte niemals voreilig oder aus pragmatischen Gründen getroffen
werden, etwa weil das Geschwisterkind bereits in der Schule ist und daher die Ab -
läufe zu Hause einfacher werden oder weil auch die Freunde eingeschult werden.
Dies mag zwar kurzfristig den Übergang erleichtern, aber in der Regel wenden sich
Kinder sehr schnell neuen Freunden zu.
Der Sorge, dass sich ein Kind möglicherweise langweilt, wenn es ein zweites Vor-
schuljahr im Kindergarten absolvieren soll, könnte z. B. mit dem Erlernen eines
Musikinstruments oder einer zusätzlichen Sportart begegnet werden.
Bedenkenswert ist hier vor allem, dass sehr junge Kinder gegenüber den ältesten
Kindern einer Klasse in vielen Bereichen in der Regel einen Trainings- oder Lern-
rückstand von 9–12 Monaten haben, der kaum aufzuholen ist.
Entwicklungsbereiche des Kindes
Sozial-emotionale Fähigkeiten
Umgang mit anderen Kindern
Beispiele: Ist das Kind hilfsbereit? Kann es mit Ent-
täuschungen umgehen? Spielt es gern mit anderen?
Nimmt es Kontakt auf? Findet es in Gruppen seinen
Platz? Spürt und benennt es seine Grenzen?
Selbstvertrauen
Beispiele: Übernimmt es Verantwortung? Freut es
sich auf die Schule? Kann es allein bleiben?
Durchhaltevermögen und Anstrengungs-
bereitschaft
Beispiel: Kann es bei einem Regelspiel bis zum
Ende dabei bleiben?
Konfliktbereitschaft
Beispiel: Löst es Konflikte verbal?
Regelverständnis
Beispiele: Kann es zuhören, Bedürfnisse zurückstel-
len, Gefühle äußern? Kann es teilen und verlieren?
Konzentration
Beispiele: Kann es sich auf eine Sache konzentrieren?
Bringt es angefangene Tätigkeiten zu Ende?
17
Interesse und Durchhaltevermögen
Die wichtigste Frage lautet: Ist das Kind
von sich aus bereit, sich den Lern-
herausforderungen zu stellen? Zeigt
es Interesse und Anstrengungsbereit-
schaft für Lernprozesse und andere
Anforderungen?
Kognitive Fähigkeiten
Motorische und körperliche Kompetenzen
Sprache
Beispiele: Kann das Kind grammatikalisch richtig
sprechen und ähnlich klingende Wörter auseinander-
halten? Kann es Abläufe und Situationen mit eigenen
Worten beschreiben?
Zahlen und Mengen
Beispiel: Erkennt es kleine Mengen bis 6, ohne nach-
zählen zu müssen?
Formen und Lagebezeichnungen
Beispiel: Wendet es Begriffe wie »oben«, »unten«,
»vorn«, »zwischen«, »hinten« sicher an?
Vergleiche herstellen
Beispiel: Unterscheidet es »lang-kurz«, »viel-wenig«?
Vorstellungsvermögen/Kreativität
Beispiele: Versteht es Aufgaben, die aus mehreren
Teilaufgaben bestehen? Hat es eigene Spielideen?
Interesse an Wort und Schrift
Beispiele: Erkennt es den eigenen Namen in Schrift-
form? Kann es seinen Namen schreiben?
Feinmotorik
Beispiele: Hält das Kind beim Ausmalen Begrenzun-
gen ein? Malt es einen kompletten Menschen mit
Details wie Haaren, Augenbrauen, Ohren, Hals usw.?
Grobmotorik
Beispiele: Kann es komplexe Bewegungen nach-
ahmen? Kann es auf einem Bein hüpfen, Bälle fangen?
Geschicklichkeit bei praktischen Tätigkeiten
Beispiele: Kann es sich an- und ausziehen? Kann es
die Tasche oder den Turnbeutel ein- und auspacken?
Bewegung
Beispiel: Kann es klettern, Roller oder Fahrrad fahren?
Körperliche Gesundheit
Beispiele: Kann es hören, woher ein Geräusch
kommt? Kann es gut sehen?
Psychische Gesundheit
Beispiel: Lässt es sich beruhigen?
18
Vorschulbegleitung
fängt früh an
Was ist Vorschulerziehung?
Heute sprechen wir von Vorschulerziehung, wenn sich das
Kind im letzten Kindergartenjahr befindet und mit speziellen
Programmen ein- bis mehrmals wöchentlich auf die Schule
vorbereitet wird. Es werden interessante Inhalte vermittelt,
doch der Erwerb bestimmter Kompetenzen wie der Konzen-
trationsfähigkeit ist von zentraler Bedeutung.
Die Vorschule
Die meisten Kinder fiebern diesem bedeut-
samen Jahr mit großer Freude entgegen
und die Eltern nehmen den Kindergarten
nun als Bildungseinrichtung wahr. Sie haben
bestimmte Vorstellungen, wie ihr Kind auf
die Schule vorbereitet werden soll, und
stellen sich selbst die Frage, wie sie ihr Kind
auf das Lernen vorbereiten können.
Schulvorbereitung
beginnt mit dem Ein-
tritt des Kindes in den
Kindergarten.
Wie entstehen
Regenwolken?
SIEHE AUCH
‹ 16–17 Was bedeutet »schulreif«?
Das Spiel des Kindes
Geist und Verstand
Selbstvertrauen
20–21 ›
62–63 ›
96–97 ›
INTERESSANT
Kinder lernen im Spiel
Kinder lernen vor allen Dingen im Spiel. Dabei sind sie in
Inter aktion mit anderen Kindern, entfalten sich und ent -
wickeln Fantasie und Kreativität.
Die gesamte Kindergartenzeit
ist Vorbereitung auf die Schule
Vergleichbar ist dies mit einem Beispiel aus dem Bereich der
Schule selbst. Natürlich kann ein Kind für eine anstehende
Schulaufgabe erst zwei bis drei Tage vorher mit dem Lernen
beginnen, aber eine kontinuierliche Vorbereitung durch täg-
liches Lernen, gute Mitarbeit im Unterricht und ein fächer-
übergreifendes Bündeln des Lernstoffs helfen dem Kind,
sich besser vorzubereiten. Ebenso fällt Kindern, die sich bereits
im Kindergarten mit Mengen oder Gewichten beschäftigen,
der Einstieg in das Fach Mathematik in der Schule oft leichter.
VORSCHULBEGLEITUNG FÄNGT FRÜH AN
19
Exemplarischer Entwicklungsstand von Kindern zwischen drei und fünf Jahren
Kognitive
Entwicklung
Sprachliche
Kompetenzen
Soziale
Entwicklung
• Interesse für Formen und Farben,
im Verlauf auch für Zahlen
• Mag gern Puzzles
• Merkt sich Dinge
• Erkennt Buchstaben
• Stellt W-Fragen, »Warum«-Phase
• Hat Spaß an Liedern und Reimen
• Interessiert sich für Bilderbücher
• Erzählt Erlebnisse
• Spielt mit Gleichaltrigen
• Schließt Freundschaften
• Lernt, sich an Regeln zu halten
Feinmotorik
• Klettert gerne
• Vom Laufrad zum Fahrrad
• Kann Bewegungen
koordinieren
• Kann sich allein an- und ausziehen
• Kann Bedürfnisse äußern
• Möchte Verantwortung übernehmen
• Kann mit der Schere umgehen
• Hält den Stift richtig
• Kann Besteck handhaben
• Zeichnet Formen und Figuren
Persönlichkeits-
entwicklung
Emotionale
Entwicklung
• Kann Gefühle regulieren
• Umgangsformen wie Hilfs-
bereitschaft und Empathie
• Mag gern Rollenspiele
• Ist kreativ mit Bastel- und Alltagsmaterialien
• Mag Regelspiele
• Baut und konstruiert
• Beschäftigt sich auch allein
Grobmotorik
Spielverhalten
Wie können Eltern diese Phase unterstützen?
Die Selbstständigkeit fördern
Überlege, was dein Kind tun kann, ohne dass es für dich
eine Belastung ist. Es kann Aufgaben übernehmen, wie
den Tisch zu decken oder sich selbst ein Brot zu strei-
chen. Kinder können dafür ein Kindermesser benutzen.
So viel wie möglich nach draußen gehen
Kurze Spaziergänge mit kleinen Besorgungen oder auch
Wanderungen bieten wertvolle Lernerfahrungen.
So oft wie möglich vorlesen
Beantworte auch die vielen Fragen, die dein Kind hat,
denn es erweitert dadurch seinen Wortschatz, sein
Wissen und seine Sprachkompetenz.
Das Kind ernst nehmen
Unterhalte dich mit ihm, beispielsweise beim gemeinsa-
men Abendessen. Dabei können auch Gefühle zur Spra-
che kommen. Auch du darfst mal davon sprechen, wenn
es dir nicht so gut geht, das verkraftet dein Kind.
Dinge sortieren oder aufreihen
Kinder lieben das. Biete deinem Kind Puzzles, Bügelper-
len, Holzperlen zum Fädeln oder Pinzetten zum Sortieren
an. Auf diese Weise kann es seine Feinmotorik schulen
und eine gute Grundlage für die Stifthaltung erwerben.
Regelspiele spielen
Es gibt viele geeignete Spiele wie KinderUno. Lass dein
Kind dabei nicht mit Absicht gewinnen, damit sich eine
Frustrationstoleranz entwickeln kann. Wenn du selbst erst
lernen musst, dein Kind verlieren zu lassen, kannst du die
Regeln umwandeln und das Kind langsam hinführen.
Vielfältige Materialien anbieten
Damit kann dein Kind seiner Kreativität freien Lauf lassen.
In Kitas werden z. B. Papprollen gesammelt und den Kin-
dern zum Basteln zur Verfügung gestellt. Daraus lassen
sich verschiedene Dinge wie Kugelbahnen oder Fernglä-
ser bauen. Dies lässt sich auch zu Hause gut umsetzen.
20
Das Spiel des Kindes
Bleibe gelassen und lass dein Kind einfach spielen!
Für Eltern von Vorschulkindern ist es manchmal schwer auszu halten,
wenn das Kind »nur« spielt und kaum Interesse an schulischen
Themen zeigt. Dies gilt vor allem, wenn die Kindergartenfreundin
vielleicht schon ihren Namen schreiben kann oder anfängt, erste
Wörter zu lesen.
Kinder im Freizeitstress
Viele Eltern kennen das: Am Montag ist Musikschule, dienstags
das Eltern-Kind-Turnen, am Mittwoch folgt der Hip-Hop-Kurs,
am Donnerstag der Schwimmkurs und freitags findet immer
das Treffen mit den besten Freunden statt. Vielleicht ist das
zwar alles ein wenig übertrieben, doch schließlich wollen wir
die bestmögliche Förderung und einen guten Start in eine
erfolgreiche Schulkarriere.
Wir erfüllen den Kindern diese Wünsche und Möglichkeiten,
weil wir es uns finanziell leisten können, weil die beste Freun-
din, der beste Freund es genauso macht und weil das Angebot
der Freizeitaktivitäten immer größer wird. Wir selbst hatten
diese Angebote als Kinder noch nicht und unsere Kinder
sollen es einmal besser haben. Das ist verständlich.
Vielleicht sollten wir aber öfter auf uns selbst schauen. Gehen
wir auch täglich nach der Arbeit einer Aktivität nach oder ist
es nicht viel entspannender, manchmal nur auf dem Sofa zu
liegen und ein gutes Buch zu lesen?
SIEHE AUCH
Planung und Freizeit
Warum Bewegung so wichtig ist
Geist und Verstand
Wie lernen Kinder?
Rollenspiele
Digitale Medien
22–23 ›
40–41 ›
62–63 › 70–73 ›
108–109 ›
150–151 ›
Freiraum schaffen
Unsere Kinder brauchen Zeit, sich nach einem langen Tag
in der Kita zu entspannen, gerade auch, weil von ihnen als
Vorschulkindern viel verlangt wird – im Rahmen der Förder-
programme und in der Rolle der »Großen«, die stets Vorbild
sein sollen. Kinder suchen gern Ruhe nach einem Tag in der
Kita. Sie müssen den Tag verarbeiten und das können sie am
besten im Spiel oder beim Nichtstun, welches ja auch wieder
neue Spielanregungen produziert.
Hip-Hop-Kurs
Freunde treffen
Schwimmkurs
Musikschule
Turnen
D AS SPIEL DES KINDES
Spielen ist ein wichtiges Bedürfnis
Ich koche jetzt
das Essen für
meine Puppe!
21
Kinder möchten und sollen spielen, ohne
reglementiert zu werden, und dafür sollen
sie vor allen Dingen Zeit haben. Wenn sie
diesen Rahmen bekommen, werden sie sich
ihre eigenen Grenzen und Regeln setzen und
können in einem geschützten Bereich ihren
Tag verarbeiten und Neues ausprobieren.
Nutze diese Zeit ruhig für dich oder für
Aktivitäten im Haushalt. Unbewusst
nimmst du auf jeden Fall eine Vorbildrolle
ein. Egal, ob du gerade das Essen vorbereitest
oder am PC arbeitest – dein Kind wird dies
häufig mit in sein Rollenspiel einbeziehen.
Kinder sollen sich möglichst viel im Freien
bewegen. Leider lassen die Verkehrssituation,
die eingezäunten Spielplätze oder das Fuß-
ballverbot auf der Wiese vor dem Haus und
vieles mehr nicht ausreichend Möglichkeiten
dafür. Umso wichtiger sind möglichst
viele Ausflüge in Parks oder in die Natur,
damit die Kinder ihre Grenzen austesten
können. Dabei können sie z. B. einfach nur
Ball spielen, rennen oder hüpfen.
Spielen ist das wahre Leben. Im Rollenspiel
können Kinder ausprobieren, wie es im wah-
ren Leben ist, und die Welt um sich herum
besser verstehen. Sie haben viel Freude
daran, lernen und erwerben verschiedene
Fähigkeiten zur Problemlösung sowie soziale
und kognitive Kompetenzen. Darüber hinaus
entwickeln sie ihre Fantasie und Kreativität.
Ich bin die Prinzessin
und du der Zauberer …
22
Planung und Freizeit
Je früher, desto besser?
Welche Förderangebote brauchen Kinder wirklich, bevor sie
in die Schule kommen? Wenn Kinder »nur« spielen, haben sie
dann überhaupt Chancen im Bildungssystem? Kinder brauchen
Möglichkeiten des Ausprobierens, um sich zu entwickeln,
sie brauchen aber auch Zeit für sich.
Der Alltag des Kindes
Ein Kindergartentag ist für jedes Kind unterschied-
lich lang. Einige Kinder besuchen den Kindergarten
nur halbtags, während andere bis zu zehn Stunden in
der Betreuungseinrichtung verbringen. Die Dauer der
Betreuung sollte keinen Einfluss darauf haben, wie sich
ein Kind entwickelt.
Genauso verschieden ist auch die Art und Weise, wie
ein Kind so einen Kinderalltag körperlich und see-
lisch verkraftet. Manche Kinder ermüden bereits nach
wenigen Stunden, andere bewältigen einen ganzen Tag
mühelos. Einige Kinder verkraften eine ganze Woche
ohne Probleme, andere wiederum wirken schon in der
Wochenmitte recht geschafft. Gerade für sensible Kinder
ist es wichtig, dass der Kindergarten alltag Phasen für
freies Spiel und zum Ausruhen bereithält. Ein Gespräch
mit dem Kita-Personal schafft Klarheit darüber, wie das
eigene Kind in dieser Hinsicht zurechtkommt.
Spielzeit
Kindergarten
SIEHE AUCH
‹‹ 14–15 Die ersten sechs Lebensjahre
20–21 Das Spiel des Kindes
Familiäres und soziales Umfeld
Alle Sinne fördern
24–25 ›
90–91 ›
Programm
Musikalische
Früherziehung
Termine über Termine
Schwimmkurs
Logopäde
Spielzeit
Im letzten Jahr vor der Schule kommen oft zusätzliche Nach-
mittagstermine für die Kinder hinzu, z. B. für einen Schwimm-
kurs, Logopädie oder Ergotherapie.
Gleichzeitig entwickeln sich beim Kind immer mehr eigene
Interessen und Freundschaften. Die Kinder möchten gern die-
selben Freizeitaktivitäten wie ihre Freunde ausüben, während
die Eltern vielleicht die musikalische Frühförderung im Hinter-
kopf haben.
Dies alles gilt es zu sortieren und in ein ausgewogenes Gleich-
gewicht zu bringen. Hierbei sollte das Verhältnis zwischen
Aktivitäten und ausreichend Spielzeit stimmig sein. Spielzeit
sollte nicht verplant werden.
PLANUNG UND FREIZEIT
Freizeit im Alltag gemeinsam mit dem Kind entwickeln
Mo
Wenn das Kind an zwei Tagen eine Aktivität hat, etwa einmal
Sport und das andere Mal eine musikalische Aktivität, und
wenn vielleicht ein weiterer Tag mit Terminen verplant ist,
sollte es an den anderen Tagen einfach nur Zeit zum Spielen
haben. In dieser freien Zeit entwickeln Kinder ihre Fähig-
keiten, aus dem Nichts heraus Ideen zu kreieren oder mit
anderen Kindern gemeinsam etwas zu planen und durch-
zuführen. Durch das gemeinsame Spielen lernen sie, wie
man sich einigen oder einen Kompromiss finden kann. Auch
diese Fähigkeiten sind eine Grundlage für das ganze Leben.
Di
Flöte
23
Mi
Do
Fr
Sport
Sa
So
Welche Sportart
würdest du gern
ausprobieren?
Aufmerksam beobachten
Wenn uns etwas auffällt, sollten wir gezielt nachfragen.
Grundsätzlich sollten wir mit dem Kind gemeinsam über
seine Interessen sprechen. Nur weil der liebste Spielkamerad
eine Aktivität ausübt oder wir als Eltern eine Lieblingssport-
art haben, muss die gleiche Leidenschaft nicht bei unserem
Kind vorhanden sein. Es gibt sehr viele Sportarten, von denen
weder unser Kind noch wir selbst je gehört haben. Ebenso gibt
es unzählige Instrumente, die ein Kind lernen könnte. Manche
Musikschulen bieten Tage an, an denen man die verschiedenen
Instrumente ausprobieren darf. Auch Tanzen, Klettern, Yoga,
Schach, Zirkuskurse usw. sind Möglichkeiten, die es vielleicht in
eurer Umgebung gibt.
Verschiedene Aktivitäten testen
Sportvereine bieten oft ein umfassendes Sportprogramm an, in
dessen Rahmen die Kinder zahlreiche Sportarten ausprobieren
können, bevor sie sich auf eine festlegen. Falls es hier Schnup-
perangebote gibt, sollte man sie auf jeden Fall nutzen.
Nicht jedes Kind muss eine Sportart wählen, es kann sich auch
einfach frei in der Natur bewegen. Oder vielleicht hat es für
dein Kind eine größere Bedeutung, ein Instrument zu erlernen.
Hat sich das Kind für eine Aktivität entschieden, ist es gut, eine