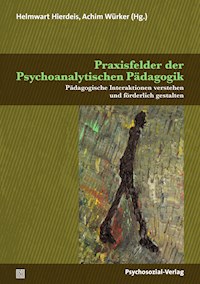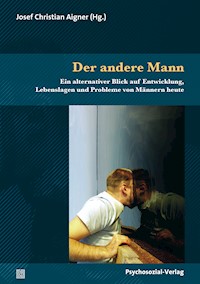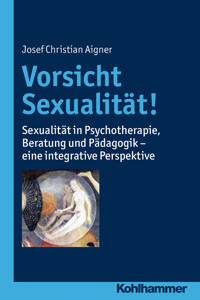
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Sexualität ist einer der zentralen Aspekte des menschlichen Lebens. Gleichwohl ist sie nach wie vor kaum im Blickfeld der Erziehungs- und Beratungs- sowie der Therapie- und Heilberufe. Selbst in der Psychoanalyse scheint sich das Thema immer mehr zu verflüchtigen oder von den sonstigen Lebenszusammenhängen abgespalten zu werden. Dieses Buch wagt einen neuen, integrativen Blick auf die menschliche Sexualität. Es behandelt Fragen zu Liebe und Sexualität in Geschichte, Gesellschaft und im individuellen Lebenslauf, die vor allem zu einem neuen Bewusstsein über die Zusammenhänge dieser heiklen Themen mit unserem "nicht-sexuellen" Leben führen sollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sexualität ist einer der zentralen Aspekte des menschlichen Lebens. Gleichwohl ist sie nach wie vor kaum im Blickfeld der Erziehungs- und Beratungs- sowie der Therapie- und Heilberufe. Selbst in der Psychoanalyse scheint sich das Thema immer mehr zu verflüchtigen oder von den sonstigen Lebenszusammenhängen abgespalten zu werden. Dieses Buch wagt einen neuen, integrativen Blick auf die menschliche Sexualität. Es behandelt Fragen zu Liebe und Sexualität in Geschichte, Gesellschaft und im individuellen Lebenslauf, die vor allem zu einem neuen Bewusstsein über die Zusammenhänge dieser heiklen Themen mit unserem 'nicht-sexuellen' Leben führen sollen.
Prof. Dr. phil. Josef Christian Aigner, Psychologe und Psychoanalytiker, Universitätsprofessor für Psychosoziale Arbeit/Psychoanalytische Pädagogik an der Universität Innsbruck; Leiter des Instituts für Psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung.
Der Autor
Prof. Dr. phil. Josef Aigner, Psychologe und Psychoanalytiker, Universitätsprofessor für Psychosoziale Arbeit/Psychoanalytische Pädagogik an der Universität Innsbruck; Leiter des Instituts für Psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung.
Josef Christian Aigner
Vorsicht Sexualität!
Sexualität in Psychotherapie, Beratung und Pädagogik - eine integrative Perspektive
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2013 Alle Rechte vorbehalten © 2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Umschlagabbildung: Hieronymus Bosch »Der Garten der Lüste« Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-021753-9
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-023808-4
epub:
978-3-17-028208-7
mobi:
978-3-17-028209-4
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Einleitung
I Grundlagen und Konzepte
1 Ein Blick in die Geschichte: Sexualität und Sexualwissenschaft – junge Erfindungen?
1.1 Zur Entwicklung einer Disziplin
1.2 Begriffsgeschichte und Begriffswirrwarr
1.3 Abklären statt Wegpsychologisieren – biologische und medizinische Aspekte des Sexuellen
2 Das »Sexuelle« und die »Sexualität«: zur Psychoanalyse von Sexualität und Sexualentwicklung
2.1 Die Bedeutung der Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung
II Kultur – Gesellschaft – Sexualität
3 Kulturelle und gesellschaftliche Umbrüche und ihre Auswirkungen auf sexuelles Erleben
3.1 »Die Welt ist mit Nacktheit bekleidet ...«
3.2 Von der Scheinhaftigkeit der »Befreiung«
3.3 Auf dem Weg zur Lustlosigkeit
3.4 Verhandlungsmoral, Pure Relationship und Tyrannei der Lust
3.5 Die »neosexuelle Revolution« vor der Jahrtausendwende
3.6 Mythos Körper – Fetisch Jugend
4 Jugend als Seismograf gesellschaftlicher Trends – auch »in sexualibus«?
4.1 Verunsicherung, Suche nach Werten, Rückgang an Sexualität
4.2 Was Jugendsexualität heute alles ist
5 Die Bedeutung der gesellschaftlichen Umbrüche für Partnerschaft und Sexualität
5.1 Angst, Leistung und Lustverlust
5.2 Über die Liebe in lieblosen Verhältnissen
5.3 Modernisierung und Demokratisierung?
5.4 Wie leben die verschiedenen Generationen heute Partnerschaft und Sexualität?
5.5 »Null Bock«? – Lustlosigkeit als gesellschaftliches Leitsymptom
5.6 Die Last mit der Lust?
6 Altensexualität – Mythos oder pharmazeutisches Hoffnungsgebiet?
6.1 Nicht Alter, sondern Gelegenheit und Geschlechtsrolle!?
6.2 Spezielle »Alterssexualität«?
6.3 Abschaffung des Begriffs »Alterssexualität«?
6.4 Was sie treiben und was sie treibt
6.5 Die Generationenschranke – »Meine Eltern tun das nicht!«
6.6 Selbstbewusstheit statt Jungbleiben um jeden Preis
7 »Das brauch ich doch nicht!« – Asexualität, Postsexualität und der Widerstand gegen gesellschaftliche Zumutungen
7.1 Das Phänomen Asexualität
7.2 Postsexualität – die vierte Revolution?
7.3 Sexualität, Narzissmus, Selfsex
7.4 Resümee?
8 Was ist schon »normal«? Perversionen und was wir aus ihnen lernen können – eine neue Perspektive
8.1 Entstehen und Verstehen von Perversionen
8.2 Die Dynamik von Demütigung, Feindseligkeit, Risiko und Triumph
8.3 Ohne Perversion keine Lust? Zur Bedeutung des »perversen Mechanismus«
III Ein neuer Blick
9 Der neue Blick auf Sexualität, Liebe und Partnerschaft oder die Bedeutung des »Nichtsexuellen« für die Sexualität
9.1 Neue Perspektivenvielfalt – Sexualität und »Nichtsexuelles«
9.2 Sexuelle Probleme zwischen Metaphorik und Ätiologie
9.3 »Sexualtherapie« oder Psychotherapie?
IV Lernen am Leiden
10 Was wir aus der Psychotherapie sexueller Störungen alles lernen können
10.1 Lernen am »Hamburger Modell« der Paartherapie, einer integrativen Methode zur Therapie sexueller Störungen
10.2 Vorgehen und helfendes Regelwerk
11 Die Geschlechterfrage
11.1 Das »starke Geschlecht« in Beratung und Therapie
11.2 Gender-Diskurse und das Verschwinden von Sex
V Lehrreiche Geschichten aus der Praxis
12 Fallgeschichten oder Lernen über Sexualität
12.1 Die Enge des Frau-Seins – Fallbeispiel Vaginismus
12.2 »Was wollen die denn noch?« – Eine erektile Dysfunktion – und noch viel mehr – bei einem älteren Paar
13 Ausblick: Liebeshungersnot – Anerkennungsnot!
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Es ist schon einige Zeit her und war ganz zu Beginn meiner Berufslaufbahn als junger Psychologe in den 1980er Jahren in einer Intervisionssitzung der Beratungsstelle, in der ich damals gearbeitet hatte. In dieser Beratungsstelle wurde auch Ehe- und Familienberatung angeboten. Eines Tages stellte dort eine Kollegin aus der Abteilung Eheberatung den Fall eines sehr schwierigen Paares vor, in dessen Beratungsprozess einfach nichts weiter ging. Ich weiß heute gar nicht mehr, was das eigentliche Problem des Paares war; ich weiß nur mehr, was offenbar das Problem der Beraterin gewesen sein muss: Als ich nämlich mit der Unverdrossenheit eines unerfahrenen Berufsanfängers in dieser Intervisionsgruppe die Kollegin zu diesem Paar, das schon ein halbes Jahr (!) lang zu ihr in Beratung kam, fragte: »Schlafen die beiden eigentlich noch miteinander?«, war zunächst einmal betretene Stille im Raum, bis die Eheberaterin ihren ersten Schock überwunden hatte und gleichermaßen freimütig wie selbst verblüfft eingestand: »Das habe ich sie noch gar nie gefragt!«.
Dies war eine Initialszene für mich, um Fragen der Sexualität in Beratung und Therapie in meiner beruflichen Entwicklung mehr Beachtung zu schenken – in der Praxis beratender und helfender Beziehungen ebenso wie in der Forschung. Wenn jetzt einige Leserinnen und Leser meinen, dass sei halt vor 30 Jahren gewesen und lange her, dann muss ich das insofern gleich zurückweisen, als man irrt anzunehmen, dass so etwas nur in der Vergangenheit vorgekommen sei. Meine Supervisionserfahrung mit Kolleginnen und Kollegen aus dem psychotherapeutischen, ja sogar aus dem psychoanalytischen Bereich, für den man theoriegeschichtlich ja eine genuine Aufmerksamkeit auf das Sexuelle annehmen könnte, ist eine andere: Immer noch oder – aus anderer Perspektive – nach wie vor ist Sexualität und sind sexuelle Details oder Besonderheiten des Erlebens und Verhaltens von Beratungs- und Therapiefällen ein vielfach ausgespartes Gebiet, das man vergisst, genauer anzuschauen, oder das nach wie vor Peinlichkeit oder zumindest Unbehagen unter Professionellen auslöst.
Warum das alles – und das mehr als 100 Jahre, nachdem der »Lustlümmel aus der Berggasse« (vgl. Roazen 1971, S. 104 f.), nachdem also Sigmund Freud vermeintlich all diese Tabus durch eine wissenschaftliche Herangehensweise versucht hatte einzureißen, freilich gegen den Widerstand seiner in maskuliner Doppelmoralität gefangenen Kollegenschaft aus der hohen Medizin? Was an der Sexualität ist denn so »schwierig«, peinlich, wie manche meinen, so beschämend und ängstigend, dass sie nach wie vor ein prekäres Gebiet professioneller und vielfach auch privater Praxis darstellt?
Vielleicht ist es – und damit wären wir schon bei einem der Motive, dieses Buch zu schreiben – gerade die verbreitete Un- oder Halbwissenheit, die viele Fachkräfte des pädagogischen und psychosozialen Sektors zum Thema Sexualität nach wie vor haben. Dies ist kein unkollegialer Angriff gegen irgendjemanden. Es ist eigentlich kein Wunder, dass Kolleginnen und Kollegen unsicher und unwissend sind, bei all den Aus- und auch Fortbildungsdefiziten, die auf diesem Gebiet feststellbar sind. Diese Defizite kann ein Buch wie dieses nicht kompensieren und wahrscheinlich auch kein einzelnes anderes. Es geht mir deshalb weniger um die Vermittlung von Detailwissen zu den verschiedensten sexualmedizinischen und/oder sexualpsychologischen Feinheiten, mit denen man mehrere Bände füllen könnte. Es geht mir vielmehr um eine emotionale Öffnung dahingehend, wie bedeutsam und eigentlich ganz und gar unübersehbar Sexualität im Zusammenhang mit Beratung und Psychotherapie ist, wenn man nur ein wenig sensibilisiert dafür ist und keine Angst hat, dass das etwas ganz besonders Schwieriges ist, das eines speziellen Expertentums bedarf.
Das Anliegen des Buchs ist also eine grundlegende Einstimmung in Fragen der Sexualwissenschaft, Sexualberatung und Sexualtherapie. Es erhebt keinen Anspruch auf vollständige oder systematische Darstellung dessen, was in Sexualberatung und -therapie vorkommen kann. Ich beschränke mich dabei auch im Wesentlichen auf heterosexuell liebende Menschen und heterosexuelle Paare (so weit dies als primäre Lebensform gewählt wurde); dies nicht, um andere Lebens- und Liebensformen damit zu diskriminieren, sondern weil dies die Hauptklientel in den offenen Sexualberatungsstellen und bei niedergelassenen Sexualtherapeuten ist. Ja man könnte andersherum fast sagen, dass es für bestimmte Randgruppen in der Gesellschaft, die hohe Aufmerksamkeit und mediale Präsenz entfalten – etwa Transgender oder Menschen mit einem Bedarf an operativen Eingriffen und Personenstandsänderung –, sowie für Menschen mit schwul-lesbischer Liebensart wegen deren wachsamer Vertretung und guter politischer Organisiertheit ohnehin ein kleines, aber gut organisiertes Angebot gibt. Es scheint fast, als ob für die alltägliche Heterosexualität und ihre Probleme dagegen wenig Aufmerksamkeit besteht. Ja es wäre wohl sogar eher schambesetzt und schwierig zuzugeben, dass wir dafür im Bereich der medizinischen und psychosozialen Versorgung wenig Angebot und Fachexpertise bereitstellen können. Es bedarf also gleich zuallererst schon allein dazu Mut, zuzugeben, dass wir den alltäglichen Formen sexuellen und partnerschaftlichen Unglücks oft recht hilflos gegenüberstehen. Um dies zu ändern, bedarf es vor allem einer neuen Sichtweise auf Sexualität als einer umfassenden, nicht aus dem Zusammenhang heraus isolierbaren Lebenserfahrung – und das auch in Bereichen, wo wir sie nicht vermuten. Es bedarf eines bestimmten Wissens und Bewusstseins über diese Zusammenhänge, das nicht auf »erbsenzählende« Orgasmus-Statistiken und auf die oberflächliche Kenntnis sexueller Vorlieben, die in Zeitschriften ab und an zu finden sind, beschränkt ist.
Das Buch trägt – neben der Darstellung eigener Erfahrungen aus Beratung und Therapie – somit zusammen, was ich selbst als hilfreich und brauchbar zur Arbeit mit und zum Verständnis von sexuellen Problemen erfahren habe, um es weiterzugeben. Für manche Leser wird das eine oder andere deshalb nicht unbekannt sein, aber es sollte in einem neuen Kontext zur Anwendung auf unsere praktische Arbeit erscheinen. Es soll auch kein »wissenschaftliches«, aber ein wissenschaftlich fundiertes Fachbuch sein, das sich der Lesbarkeit halber mit Dauerzitationen zurückhält, aber dennoch auf einen breiten Literaturschatz verweist, der im Falle detaillierteren Interesses oder Bedarfs nachgeschlagen werden kann. Es soll deutlich machen, dass Sexualität so vielfältig in unser Leben verstrickt ist, dass wir bei ihrer Erforschung immer ein breites Spektrum von Äußerungsformen im Auge haben müssen, um nicht der Gefahr zu erliegen, Sexualität tatsächlich in entfremdender Form aus den großen Lebenszusammenhängen herauszureißen und zu isolieren. Das Buch soll Bekanntes mit Neuem und Verschüttetem (davon gibt es bei der Sexualität sehr viel) und Kritisches mit Originellem vermengen, um neugierig zu machen und zum Tätigwerden zu ermuntern. Es soll somit tatsächlich ein Mutmach-Buch sein, um einmal einen neuen, in seiner Breite vielleicht ungewohnten Blick auf diese zutiefst menschlichen Eigenheiten und ihre so oft vom Scheitern bedrohten Äußerungsformen zu wagen – einen Blick, der auch ermutigt, dieses »schwierige« Thema offensiv in die Beratungs- oder psychotherapeutische Arbeit mit aufzunehmen.
Es soll aber kein Lehrbuch zu bestimmten sexuellen Störungen und ihrer Behandlung sein, wovon es wenige, aber einige gibt, die sehr lehrreich sind und nicht ergänzt werden müssen (vgl. Beier und Loewit 2004; Sigusch 1996; Hauch [Hrsg.] 2006). In ihnen kann alles Wesentliche systematisch nachgeschlagen werden. So erspare ich mir auch detailliertere diagnostische Beschreibungen, Darstellungen und Unterscheidungen (nach ICD-10 oder DSM-IV), die anderswo und dort vollständig nachgelesen werden können. Das Buch soll also Mut machen, aber warum Mut? Mut setzt Überwindung von Angst voraus. Angst kann deshalb entstehen, weil wir nirgendwo sonst so verletzlich sind wie in Fragen der Sexualität und der Liebe. Das spüren auch die Menschen in den Helferberufen. Deshalb soll dieses Buch Mut machen, indem es Bewusstsein und Kenntnis über Zusammenhänge schafft, wie Sexualität im Lebenslauf organisiert ist, wie sie basale menschliche Grundbedürfnisse berührt und wie sie gesellschaftlich mit geprägt wird. Damit wird sie zu etwas »ganz Normalem« oder – wie wir es auch nennen werden – scheinbar »Nichtsexuellem«, von alltäglichen Wünschen und Ängsten Geprägtem, das in jedem Beratungsprozess und in jeder Therapie ganz ohne besondere »sexualtherapeutische Tricks« erreicht werden kann. Das Buch soll somit einige Wissens- und Bewusstseins-Voraussetzungen für ein breites Verständnis liefern, das notwendig ist, wenn wir Sexualität verstehen wollen.
Es wird, wenn wir in diesem Feld kompetent handeln wollen, Mut brauchen. Mut zuzuhören und nichts wegzuwischen, wenn etwas am Rande auftaucht, als ob es nicht wirklich dazugehörte; Mut hinzuschauen, worüber manche lieber diskret hinweggehen; Mut zuzugreifen, wenn entsprechende Fälle auf Beraterinnen und Therapeuten zukommen und sie nicht gleich mit »Da gibt es einen Spezialisten« wieder wegzuschicken. Und damit wird es auch zu einem Buch gegen die Angst, mit sexuellen Problemen käme etwas besonders Schwieriges auf uns zu, das wir besser weitervermitteln sollten! Mit sexuellen Problemen kommt vielmehr etwas zutiefst Menschliches, Alltägliches und manchmal hoch Hilfsbedürftiges auf uns zu, das man nur um den Preis der Verzerrung und fragwürdigen Isolierung aus Beratung und Therapie mit seelisch in Not geratenen Menschen abspalten darf.
Die Klientel und die Patientinnen und Patienten werden es Ihnen danken.
Aber auch ich habe für das, was ich im Laufe meines eigenen Lernens über Sexualität erfahren konnte, zu danken, bestimmten Institutionen und Menschen, die mich angeleitet und auf diesem Weg begleitet haben: angefangen bei Igor Caruso, meinem psychoanalytischen Lehrer an der Universität Salzburg, der stets die hohe Bedeutung der Sexualität für ein ausreichend gesundes Seelenleben hervorhob und in der Beforschung der historisch-gesellschaftlichen Verflochtenheit psychischer Phänomene eine Leitfigur für mich und eine ganze Generation von Psychologen geworden ist; meinen Kolleginnen und Freunden an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, wo ich in den frühen 1990er Jahren die Paartherapie-Fortbildung und eine Menge anderer Lernprozesse erleben konnte; von diesen wiederum im Besonderen Gunter Schmidt, der sicherlich einer der bedeutendsten sexualwissenschaftlich lehrenden und forschenden Psychologen der Gegenwart im deutschen Sprachraum ist, Margret Hauch als richtungweisende Weiterentwicklerin des Paar- und Sexualtherapieansatzes, Reinhardt Kleber, dem langjährigen Leiter der Sexualberatungsstelle Hamburg, der mich neben Witz und Humor vor allem die Demut lehrte, auch als erfahrener Sexualtherapeut stets dichte Supervision und Intervision zu suchen, vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen im Umfeld dieser Institutionen und last not least auch meinen Angehörigen, die die vielen Abwesenheiten zu passiven wie aktiven Fortbildungszwecken und auch die monatelange Schreibtischflucht, die so ein Buch erfordert, verständnisvoll hingenommen haben.
Innsbruck im Sommer 2012
Josef Christian Aigner
Postskriptum:
Ein Wort zur Verwendung der männlichen beziehungsweise weiblichen Form: Lange habe ich überlegt, wie ich das machen soll; die gängigen Gender-Mainstream-Lösungen sind meines Erachtens keine (guten), sie erschweren die Lesbarkeit und fügen neuerfundene Buchstaben wie ein großes »I« ein, die in unserer Orthografie fremd erscheinen. Wie der Heidelberger Sexual- und Paartherapeut Ulrich Clement (2004) in seinem Buch »Systemische Sexualtherapie« habe ich deshalb kapituliert und verwende meistens frei nach Gefühl, einmal die männliche Form, manchmal auch beide Formen. Natürlich sind aber immer beide Geschlechter gemeint, wenn der Sinnzusammenhang stimmt. Die Verwendung der männlichen Form gefällt mir wie Clement deshalb, weil ich nicht behaupten möchte – was die »gegenderten« Varianten ja eigentlich suggerieren –, dass ich immer derart über den Dingen stünde, dass mir kein männlicher Blick auf manches passieren könnte. Deshalb teile ich auch Clements Begründung für die männliche Form, nämlich »die Möglichkeit, dass das Buch und auch die Erfahrungen und Überlegungen, die ihm zugrunde liegen, meinem männlichen Blick folgen. ... Man kann sich nie sicher sein, welche Aussagen vom Gender-Blick gefärbt sind und welche nicht. Beim Schreiben so wenig wie beim Lesen« – genau so geht es mir auch!
Einleitung
Sexuelles Erleben und Verhalten sind heute in den meisten Curricula an Fachhochschulen, Universitäten und auch in psychotherapeutischen oder beratungsorientierten Ausbildungen am Aus- und Weiterbildungsmarkt immer noch so gut wie kein Thema. Ein wahlloser Griff ins Regal der psychotherapeutischen Standardwerke zeigt, dass etwa in einem ganz aktuellen Lehrbuch »Analytisch orientierte Psychotherapie in der Praxis« (Hohage 2011) der Begriff Sexualität im Register gerade ein einziges Mal (S. 73) vertreten ist. In älteren Lehrbüchern ist es oft nicht anders, hier fehlt dieser Begriff meist überhaupt gänzlich.1 Haben also seelisch leidende Menschen keine Sexualität und keine sexuellen Probleme?
Brumlik (2012) machte kürzlich darauf aufmerksam, dass sich selbst in herausragenden internationalen Handbüchern zur Entwicklungspsychologie »Sexualität« als eigenes Kapitel nicht findet; höchstens zum Thema »Geschlecht« gibt es hier und da Einträge, die sich aber meist auf »Sex differences« beziehen (Brumlik 2012, S. 13 f.). Das 2008 erschienene, beinahe klassisch zu nennende »Handbuch Sozialisationsforschung« (Hurrelmann et al. 2008) kennt zwar ein Kapitel »Sozialisation und Geschlecht«, in dem es aber – wie so oft – lediglich um »Gender« im Sinne des sozialen Geschlechts geht, während »Sex« im Sinne von Sexualität kein Thema ist. Eine Erhebung an allen österreichischen Universitäten im Wintersemester 2010/11 liefert ähnliche Hinweise: Lediglich in einigen wenigen Lehrveranstaltungen im Umfang von nur 18 Semesterwochenstunden (das sind bundesweit insgesamt neun Lehrveranstaltungen an sechs Universitäten oder recht bescheidene eineinhalb Lehrveranstaltungen pro Universität per anno!) spielte Sexualität – und dies wiederum im weitesten Sinne – irgendwie eine Rolle: Auch hier sind »genderbezogene« und kulturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen schon mit eingerechnet, wie etwa »Kulturpsychologie des Körpers: Schönheit und Sexualität« an der Uni Wien oder »Wort-Bild-Geschlecht: Eros und Gefühl – erotische Phantasien und emotionale Befindlichkeiten in (Film)Bildern und Texten« (vgl. Aigner 2010). Bedenkt man nun, dass an diesen Universitäten der wissenschaftliche Nachwuchs in den Bereichen von Medizin, Psychologie, Pädagogik und den angrenzenden Sozialwissenschaften ausgebildet wird, dann wird schnell klar, dass diese 9 (= neun!) Lehrveranstaltungen in keiner Weise in der Lage sind, diese Menschen der Bedeutung des Gegenstands entsprechend auszubilden beziehungsweise das enorme Defizit an sexualitätsbezogener Lehre und Forschung in den Human- und Sozialwissenschaften auch nur annähernd zu lindern.
Diese schier unglaubliche Ausblendung des Themas Sexualität aus den Human- und Sozialwissenschaften macht seit einiger Zeit auch von der »Paradedisziplin«, die sich von Anfang an mit Sexualität befasst und sich damit nicht gerade beliebter gemacht hat, nicht Halt: vor der Psychoanalyse. Auch hier ist die Beschäftigung mit Sexualität und ihren verschiedensten Lebens- und Konfliktäußerungen nicht mehr so selbstverständlich2, wie manche meinen. Paul Parin hatte schon vor gut 25 Jahren die »Verflüchtigung des Sexuellen« in der Psychoanalyse beklagt. Er führte dies u. a. auf die verstärkte Konzentration auf frühe, narzisstische Störungen im Gefolge des Aufkommens der Selbstpsychologie und des Niedergangs der psychoanalytischen Trieb- und Konflikttheorie zurück (Parin 1986, S. 81).
Im Rahmen der von Heinz Kohuts (1979) aus der Psychoanalyse heraus entwickelten Selbstpsychologie, aber auch im Rahmen der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorien spielt die Sexualität in ihrer triebhaften Verursachung längst nicht mehr die Rolle, die ihr die Psychoanalyse einst zugedacht hatte. Erst in jüngster Zeit hat auch der renommierte Bindungsforscher Peter Fonagy (2012), Inhaber des Freud Memorial Chair an der Universität London, auf »einen sichtbaren Rückgang des psychoanalytischen Interesses an der Psychosexualität« hingewiesen (Fonagy 2012, S. 469) und hat das sogar anhand einer Begriffsstudie in psychoanalytischen Arbeiten nachgewiesen: Dort kämen immer weniger Begriffe vor, die sich direkt auf Sexualität beziehen (473f.). Betrachtet man es historisch kritisch, sind aber auch innerhalb der klassischen Psychoanalyse, als diese sich noch mehr auf die Bedeutung der Sexualität konzentrierte, diejenigen, die verstärkt sexualwissenschaftlich tätig waren, eigentlich immer eher Ausnahmen und sogar Außenseiter geblieben oder aus Gründen politischer Akzeptanzängste von führenden Vertretern an den Rand gedrängt worden. Am besten ist dies bei Wilhelm Reich dokumentiert (vgl. Fallend u. Nitzschke 1997), weniger aufgearbeitet ist diese Ausgrenzung noch bei Otto Gross3 (vgl. Hurwitz 1979), von dem heute bezeichnender- und doch sonderbarerweise kaum mehr jemand etwas weiß.
Schließlich, aber nicht zuletzt, macht jenen, die sich nachhaltig mit der Rolle der Sexualität beschäftigen, vielleicht immer noch die Außenseiterposition, die sie wie einst Freud treffen könnte, zu schaffen: So droht erfahrungsgemäß bis heute jedem, der sich fachlich mit Sexualität beschäftigt, leicht einmal die verdächtigende und gleichermaßen schlüpfrige Frage, warum er das täte: »Haben Sie etwa selbst Probleme?« – »Ja«, könnte man antworten, »Sie denn nicht?« Womit auch schon gesagt wäre, dass es so etwas wie eine »problemlose« Sexualität nicht gibt, nicht beim Durchschnittsbürger und auch nicht beim Experten, und schon gar nicht, wenn wir uns mit Menschen befassen, die aus irgendeinem Grund in schwierige Lebens- oder Entwicklungspositionen geraten sind. Jedenfalls scheint es auch im akademischen Bereich, in dem es – wie im diesbezüglich rückständigen Österreich – keinerlei universitäre Position dazu gibt oder wo die wenigen, die existierten, abgeschafft oder ausgehungert werden4, anscheinend wenig karrierefördernd zu sein, wenn man sich mit Sexualität beschäftigt.
So weit nur ein paar grundsätzliche Reflexionen, warum ein Gutteil der Psychotherapeuten und auch der Psychoanalytiker sich mit Fragen der Sexualität lieber nicht oder nur recht zögerlich befassen könnte. Schnell werden dann im Bedarfsfall Klientinnen und Patienten mit dem Anschein einer sexuellen Pathologie oder Auffälligkeit zu einem vermeintlichen Spezialisten weitervermittelt (also eigentlich abgeschoben), obwohl man doch meinen könnte, dass alle psychotherapeutischen Experten – und erst recht jene aus der Psychoanalyse – mit »Perversen«, Lustlosen oder Menschen mit sexuellen Funktionsstörungen ebenso zurechtkommen müssten, wie sie es mit anderen seelischen Störungen oder mit Neurotikern tun.
Wie kürzlich eine Diplomarbeit (Grimm u. Ortner 2012) zur Frage der Qualitätsstandards und der Ausbildung von Sexualpädagogen und Sexualberatern in Österreich ergab, schätzen die in diesem Berufsfeld Tätigen – die zumeist übrigens nicht unmittelbar »hauptberufliche« Sexualitäts-Experten sind – zwar Hilfestellungen zur Umsetzung praktischer Kompetenzen in Fortbildungen als sehr wichtig ein. Noch mehr aber und zuvorderst schätzen sie solide theoretische Grundlagen und Reflexionen zu Fragen der Sexualität als wichtig ein – quasi als Ermutigung, sich auch in diesem schwierigen Themenfeld gut zurechtzufinden und nicht davor zu kneifen. Genau diesem Zweck soll, neben den praxisorientierten Kapiteln am Ende, dieses Buch, wie ich es zu schreiben gedachte, dienen, und es soll diesen Bedürfnissen entgegenkommen: Das heißt dann, dass es keine detaillierte Erläuterung eines bestimmten »Handwerkszeugs«, keine systematische Lehrbuchattitüde gibt, sondern die Anregung zu einem reflexiven Umgang im breiten Spektrum von Fragen zur menschlichen Sexualität.
1 Bezeichnenderweise findet sich – gemäß dem Negativdiskurs, der die öffentlichen und Fachdebatten über Sexualität seit langer Zeit dominiert – eher der Begriff des sexuellen Missbrauches, so auch hier; ihm sind immerhin die Seiten 63 sowie 134 bis 136 gewidmet (vgl. Hohage 2011).
2 Eigentlich haftete ja seit jeher der Vorwurf des »Pansexualismus« auf Freuds Psychoanalyse. Dieser besagt, dass sie alles und jedes von »der Sexualität« herleiten wolle. Freilich ging dieser Vorwurf immer schon an dem breiten, umfassenden Sexualitätsbegriff der Psychoanalyse vorbei und meinte eigentlich, sie wolle alles von der Genitalität, also von einem kulturell verengten Sexualitätsbegriff, ableiten.
3 Otto Gross (1877–1920) war der Sohn des berühmten österreichischen Juristen Prof. Hans Gross und wuchs in Graz auf, wo sein Vater an der Universität wirkte. Dort wurde er auch 1899 zum Dr. med. promoviert. Wegen seiner späteren Drogenabhängigkeit ließ er sich 1902 in der Psychiatrischen Klinik Burghölzli in Zürich (unter Eugen Bleuler) internieren und lernte dort Carl Gustav Jung und über ihn schließlich auch Sigmund Freud kennen. Gross hatte intensive Kontakte zur Münchner Bohème. Dies und andere gesellschaftspolitische Aktivitäten, denen der junge Mediziner nachging, waren es wohl auch, was Freud – der Gross einst als seinen vielleicht begabtesten Schüler bezeichnet hatte – von diesem Abstand nehmen ließ. Nach mehreren wirren Beziehungen zu verschiedenen Frauen und Selbstmorden seiner Geliebten, bei denen Gross geholfen haben soll, wurde er schließlich des Mordes und der Beihilfe zum Selbstmord beschuldigt, was zusätzlich zu den gegen ihn angestrengten Prozessen wegen Anarchismus 1913 zur gerichtlichen Verurteilung und zur Einweisung in die Privat-Irrenanstalt Tulln bei Wien führte, wo er auf Betreiben seines Vaters auch entmündigt wurde, was erst nach langen Kämpfen wieder aufgehoben werden konnte. Im Februar 1920 fand man den unter Entzugssymptomen leidenden Otto Gross völlig verwahrlost und halb erfroren in Berlin auf, wo er kurz darauf in einer Klinik in Pankow starb. Sein Werk, das inmitten vieler psychoanalytischer, sexualwissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Visionen auch eine interessante Matriarchatstheorie enthält, gilt heute als fast völlig vergessen (vgl. Hurwitz 1979).
4 So war etwa die Schließung des Instituts für Sexualwissenschaft im Klinikum der Universität Frankfurt am Main im Jahr 2006 – und dies trotz wirklich historischer Verdienste in Lehre und Forschung – ein wissenschaftlicher Skandal mit großem internationalen Echo, das allerdings ungehört blieb (vgl. Sigusch 2007).
IGrundlagen und Konzepte
1 Ein Blick in die Geschichte: Sexualität und Sexualwissenschaft – junge Erfindungen?
Der Begriff Sexualität kommt – wie Sigusch in seinem Monumentalwerk »Geschichte der Sexualwissenschaft« (2008) dargelegt hat – weder in der Bibel noch bei historischen Dichterfürsten wie Homer oder Shakespeare vor (Sigusch 2008, S. 11). Es handelt sich bei ihm also – ebenso wie bei der als Sexualwissenschaft bezeichneten Disziplin – um eine sehr junge Prägung. Der Begriff selbst ist erst etwa 200 Jahre alt und wurde von dem – man staune! – Botaniker August Henschel (1790 bis 1856 –letzteres übrigens Freuds Geburtsjahr!) in einer Studie über die Weitervermehrung von Pflanzen5 in die Geschichte der Wissenschaften eingeführt (vgl. Fiedler 2010, S. 8). Die Schaffung eines Terminus für das lange und anhaltend Verpönte oder Nicht-zu-Problematisierende eröffnete durch die Versprachlichung dessen, was hier zur Debatte stand, nun auch neue Formen des Nachdenkens und Verhandelns darüber. Zuvor waren wohl Hinnehmen von etwas Gegebenem bzw. eine breite Palette von Tabus, von Diffusem, von Geheimhaltung und Angst (und sei es nur vor unerwünschter Schwangerschaft) die »Bestimmungsstücke« dessen, was dann später als benannt und problematisiert wurde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!