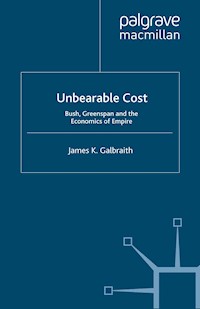Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der renommierte US-amerikanische Wirtschaftsprofessor James K. Galbraith setzt die jüngste Finanz- und Schuldenkrise in einen größeren zeitlichen Rahmen – vom Nachkriegsboom über die Dotcom-Blase bis hin zum Immobiliencrash – und zeigt, dass der Wachstumsglaube de facto ein historischer Irrtum ist. Schon längst sind die Ausnahmen die Regel. Fundiert und anschaulich legt er in diesem Buch dar, warum es keine Rückkehr zur »Normalität« geben wird und was das für die globale Wirtschaft und die Politik bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James K. Galbraith
Wachstum neu denken
James K. Galbraith
Wachstumneudenken
Was die Wirtschaft ausden Krisen lernen muss
Aus dem Amerikanischenvon Peter Stäuber
Rotpunktverlag.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
The End of Normal. The Great Crisis and the Future of Growthbei Simon & Schuster, Inc., New York. Sie wurde vom Autorfür die vorliegende Ausgabe aktualisiert.
© 2014 by James K. Galbraith
© 2016 Rotpunktverlag, Zürich (für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
Umschlag: Sylvie Dardel
ISBN 978-3-85869-701-1
1.Auflage 2016
Für Bruce Bartlett,einen mutigen und verehrten Freund
Politik ist nicht die Kunst des Möglichen.Politik besteht vielmehr darin, zwischen dem Desaströsenund dem Unangenehmen zu wählen.
John Kenneth Galbraith
Inhalt
Vorwort
Prolog
Teil I Im Garten der Optimisten
1 Das unendliche Wachstum
2 Ein Jahrzehnt der Zerrüttung
3 Die große Illusion
4 Streit im Elfenbeinturm
5 Die vergessenen Propheten
Teil II Das Ende des Wachstums
6 Der Würgehalsband-Effekt
7 Die Nutzlosigkeit des Militärs
8 Der digitale Sturm
9 Die Folgen des Finanzbetrugs
Teil III Keine Rückkehr zur Normalität
10 Verfehlte Prognosen
11 Die Legende von der Staatsverschuldung
12 Die Krise in Europa
13 Auf der Suche nach dem langsamen Wachstum
Epilog
Dank
Literatur- und Quellenverzeichnis
Vorwortzur deutschsprachigen Ausgabe
Dieses Buch basiert auf zwei Thesen. Die erste These lautet, dass die Volkswirtschaften der Industrieländer die Zeit des schnellen Wachstums – also die Zeit, die die Erwartungen der Nachkriegsgeneration entscheidend geprägt hat – definitiv hinter sich gelassen haben. Der Grund ist nicht nur im Dogma der Austeritätspolitik zu finden. Die tiefere Ursache liegt vielmehr darin, dass die objektiven Umstände ein starkes Wirtschaftswachstum und eine hohe Beschäftigung verunmöglichen, und zwar mindestens seit dem Jahr 2000.
Zu diesen widrigen Bedingungen zählen wechselhafte und instabile Energiepreise, eine zunehmend unsichere globale Sicherheitslage, ein technologischer Wandel, der sich in erster Linie in der Digitalisierung äußert, und vor allem die sich verschlimmernde Betriebsstörung im internationalen Finanzsystem. Instabile Energiepreise und wachsende Konflikte hemmen Investitionen, die digitale Revolution würgt die Beschäftigung ab, und die Banken nehmen ihre Aufgabe nicht wahr und vergeben keine langfristigen, nachhaltigen und produktiven Darlehen.
Im Fall Europas könnte man zu dieser Liste die fundamentalen Fehler in der Architektur der Eurozone hinzufügen. Diese Mängel haben dazu geführt, dass Deutschland chronische Handelsbilanzüberschüsse erzielt, die durch Defizite anderswo wettgemacht werden müssen. Falls die Defizite nicht finanziert werden können, ist das ein Garant für eine instabile Schuldendynamik und wiederkehrende Krisen. Das griechische Drama, das sich derzeit abspielt, ist eines von zahlreichen Beispielen solcher Krisen.
Wir haben bislang noch keine größeren wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels gespürt, aber auch diese werden früher oder später kommen. Zusammengenommen, sorgen diese Faktoren dafür, dass ökonomische Prognosen, die vergangene Entwicklungen als Ausgangspunkt nehmen, nicht mehr ausreichen. Insbesondere hat das ökonomische Konzept des »potenziellen BIP«, also die Projektion des vergangenen Wachstums in die Zukunft, keine Gültigkeit mehr, genauso wenig wie die Vorstellung, dass die Wirtschaft naturgemäß zu diesem illusorischen Potenzial zurückkehrt. Die Situation ist ein gutes Stück komplizierter.
Die zweite These des Buchs besagt, dass wir unseren wirtschaftspolitischen Kurs angesichts dieser Situation von Grund auf überdenken müssen.
Gegen Arbeitslosigkeit verschreiben die Keynesianer in der Regel ein »Konjunkturpaket« – entweder ein fiskalisches, in Form von Haushaltsdefiziten, oder ein monetäres, nämlich »quantitative Lockerung«. Diese Maßnahmen sind notwendig, aber sie reichen nicht aus. Sie füllen sozusagen einfach Treibstoff in den Tank. Aber manche Beobachter sind der Auffassung, dass der Treibstoff gar nicht brennt, und in monetärer Hinsicht deutet tatsächlich einiges darauf hin. Die Wirksamkeit fiskalischer Konjunkturpakete hingegen ist durch Beweise gestützt. Aber selbst ein wirksamer Treibstoff ist nutzlos, wenn der Motor kaputt oder der Kühler leer ist.
Der alternative Lösungsansatz, der bei der politischen Führung Deutschlands derzeit beliebt ist, heißt Sparpolitik, ist also das Gegenteil eines Konjunkturpakets. Im Prinzip soll Austerität eine reinigende Wirkung haben, sie ist eine Reparaturphase, in der die Bedingungen für Wachstum wiederhergestellt werden. Diese Idee stammt von Friedrich von Hayek, Joseph Schumpeter und der klassischen Tradition, die auf David Ricardo und bis Adam Smith zurückgeht. Demnach gibt es produktive und unproduktive Aktivitäten, produktive und unproduktive Menschen. Wenn man die unproduktiven unterstützt, dann belastet man damit die produktiven; wenn die Belastung zu groß ist, dann verlangsamt sich dadurch das Wachstum. Laut dieser Theorie sind also Sparprogramme und harte Zeiten unerlässlich, um der Wirtschaft die Energie zurückzugeben, dem Unternehmergeist neues Leben einzuhauchen und Talente zu fördern.
Die Schwierigkeit bei dieser Theorie besteht darin, dass die Hindernisse, die heute den Weg zum Wachstum versperren, nicht in einem Mangel an menschlicher Energie, an Unternehmergeist oder Fähigkeiten liegen – von all dem gibt es heute mehr als je zuvor. Vielmehr liegen die Probleme jenseits des normalen menschlichen Handelns, nämlich in der Verfügbarkeit und im Preis von Treibstoffen, in drohenden Konflikten, in den schädlichen Praktiken der Banken und im eigenartigen Charakter des technologischen Wandels, der dazu neigt, talentierte Arbeitskräfte überflüssig werden zu lassen. Unter diesen Bedingungen hat Austerität negative Auswirkungen: Sie reduziert das Ausmaß der gesamten Wirtschaftsaktivität. Die dadurch verursachte Not ist völlig nutzlos. Wenn man den Pensionär in die Armut stürzt, dann raubt man dadurch auch der Krankenschwester, dem Lebensmittelhändler und dem Apotheker den Lebensunterhalt. Der produktive Sektor ist keinen Schritt weiter, und das Wachstum wird ausbleiben.
Wir hatten seit Ausbruch der Großen Krise sechs Jahre Erfahrung sowohl mit Konjunkturpaketen als auch mit Sparmaßnahmen. In den USA, wo man sich für Konjunkturpakete entschied, zunächst fiskalische und dann monetäre, waren die Resultate nicht völlig unbefriedigend, aber das Wachstum und die Beschäftigung bleiben weit hinter dem Trend zurück, den wir vor der Krise beobachteten. In Europa, wo sich die Austerität durchsetzte, waren die Resultate in gesellschaftlicher und ökonomischer Hinsicht desaströs, insbesondere in den Krisenländern des Südens. Und die Folge ist, dass der Europäischen Union jetzt der Zusammenbruch droht.
Was also ist zu tun? Meine Antwort lautet, dass wir die Zielvorgabe anpassen müssen: Das erste ökonomische Ziel unserer Zeit sollte nicht das Wachstum sein, sondern die Solidarität in unserem Streben nach einem guten Leben. In einer Situation des langsamen oder moderaten Wachstums, in einer fortschrittlichen Gesellschaft mit hochentwickelter Technologie und der Fähigkeit, die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen angemessen zu befriedigen, besteht die dringendste Notwendigkeit darin, die wichtigsten sozialen und ökonomischen Strukturen zu bewahren und zu stärken, die für das moderne, zivilisierte Leben unerlässlich sind. Dazu gehören die Sozialversicherungen für Gesundheit, Ausbildung und Rente; eine wirksame Regulierung in Bezug auf die Umwelt, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und sauberer Luft, die Qualität des städtischen Lebens sowie die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Ferner zählen dazu die Qualitätskontrolle in der fortgeschrittenen Produktion und faire Lohnstrukturen, darunter ein vernünftiger Mindestlohn. Und schließlich gehört dazu auch die Bereitstellung von Gütern, die gemeinsam konsumiert werden, etwa Kunst und Musik.
Deutschland hat in seiner langen Geschichte gelernt, was für eine wichtige Rolle die gesellschaftliche Solidarität für den Erfolg der Wirtschaft spielt. Schließlich wurde der Wohlfahrtsstaat im späten 19. Jahrhundert auf dieser Grundlage aufgebaut, genauso wie die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und das wiedervereinte Deutschland nach 1989. Zudem wurde die soziale Solidarität, die in den USA während des New Deal konkrete Gestalt annahm, von Ideen aus Deutschland und aus den Siedlungsgebieten der deutschen Einwanderer in den Vereinigten Staaten inspiriert, insbesondere in Wisconsin in der progressiven Ära. Zusammen mit den Ideen Friedrich Lists, der auf die Notwendigkeit eines ausgeglichenen und zweckorientierten Programms für die Entwicklung der Volkswirtschaft verwies, wurden diese Vorstellungen in unserer Zeit in den Hintergrund gedrängt, und zwar von den konkurrierenden Schulen, die ihren Ursprung in Österreich und in England haben. Doch ihre Bedeutung bleibt bestehen.
In diesem Geist der Solidarität empfehle ich dieses Buch meinen deutschsprachigen Leserinnen und Lesern.
James K. Galbraith
Januar 2016
Austin, Texas
PrologSchönheitswettbewerb der Ökonomen
John Maynard Keynes schrieb 1930: »Die Welt hat nur langsam begriffen, dass wir dieses Jahr im Schatten eines der größten wirtschaftlichen Zusammenbrüche der neueren Geschichte leben.« (Keynes 1956, S.193) Während des Tumults vom September 2008, als die Finanzwelt in die Arme der US-Regierung kollabierte, war von einer solchen Begriffsstutzigkeit nichts zu spüren. Auch die Schreiberlinge und Analysten reagierten flink. Nach dem Großen Börsencrash von 1929 dauerte es über zwei Jahrzehnte, bis das Ereignis historisch aufgearbeitet wurde – die Große Depression, der New Deal und der Zweite Weltkrieg waren dazwischengekommen; erst 1954 erschien ein dünnes Buch aus der Feder meines Vaters, das er im Lauf eines Sommers geschrieben hatte. Im Gegensatz dazu steht uns heute, gerademal ein halbes Jahrzehnt nach der Großen Krise von 2007/8, eine Vielzahl von Büchern von Journalisten und Ökonomen zur Verfügung, dazu eine wachsende Zahl politischer Memoiren und ein ganzes Regal von offiziellen Berichten. Die Herausforderung besteht darin, aus ihnen schlau zu werden.
Eine erste Runde, darunter David Wessels Die große Panik und Andrew Ross Sorkins Die Unfehlbaren, konzentrierte sich auf die wichtigsten Banker und auf George W. Bushs Regierung; Ron Suskinds Confidence Men und Noam Scheibers The Escape Artists deckten die Jahre während Barack Obamas Präsidentschaft ab. Politische Memoiren, wie sie bislang verfasst worden sind – vom ehemaligen Finanzminister Henry Paulson, vom ehemaligen Generalinspekteur des Bankenrettungsprogramms Troubled Asset Relief Program (TARP), Neil Barofsky, und von der früheren Vorsitzenden des Einlagensicherungsfonds Federal Deposit Insurance Corporation, Sheila Bair –, erzählen die Geschichte der Krise vornehmlich aus dem menschlichen und politischen Blickwinkel: Sie befassen sich mit den Stärken und Schwächen der Männer und Frauen, die sich mitten im Sturm befanden.
Die politischen und persönlichen Berichte gehen kaum auf die Praktiken ein, die zum Debakel führten. Diese zu beleuchten, fällt in die Domäne der Finanzjournalisten, einer Handvoll Rechtsprofessoren und der offiziellen Untersuchungskommissionen. Sie verorten den Kern der Krise im Verhalten jener Organisationen, die den Wohnungskauf in den USA finanzierten. Zu den wichtigen Veröffentlichungen zu diesem Thema zählen All the Devils are here von Bethany McLean und Joseph Nocera, Kleptopia von Matt Taibbi, The Subprime Virus von Kathleen Engel und Patricia McCoy und Anatomy of a Financial Crisis von Marc Jarsulic. The Big Short von Michael Lewis hat einen etwas anderen Fokus und befasst sich mit den Spekulanten, die gewinnbringend auf den Zusammenbruch des Immobilienmarkts wetteten. Es wurden offizielle Untersuchungen unternommen von der Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC, unter Vorsitz von Phil Angelides), vom Aufsichtsgremium des Kongresses (unter Vorsitz von Elizabeth Warren), vom Ständigen Unterausschuss des US-Senats für Untersuchungen (unter Vorsitz von Carl Levin), und vom Büro des Sondergeneralinspektors für das Bankenrettungsprogramm Troubled Asset Relief Program (TARP). In ihrer Summe haben diese Untersuchungen eine Fülle von Beweisen zusammengetragen. Einige der Berichte sind faszinierend und lesen sich wie ein guter Horror-Roman. Aber ihr Zweck ist es, Fakten aufzuzeigen. Ihre Aufgabe besteht in der Regel nicht darin, Erklärungen zu suchen.
Um ein Beispiel zu nennen: Der Bericht der FCIC von 2011 legt eine detaillierte, gut dokumentierte Geschichte des Missbrauchs sowohl in der Regierung als auch im Bankensektor vor (für ein Regierungsdokument ist es auch sehr gut geschrieben). Der Bericht hält fest, dass sich die Vorkommnisse im Finanzsektor vor jedermanns Augen abspielten. Aber was ist der Zweck dieser Feststellung? Welche Theorie hilft uns dabei, diese Fakten zu bewerten? Eine Aneinanderreihung von bestechenden Tatsachen liefert noch keine Erklärung, weshalb die Umstände so waren. Auch kann sie nichts beitragen zur Errichtung eines sichereren und stabileren Wirtschafts- und Finanzsystems. Fakten sind unerlässlich, um festzustellen, ob das Verhalten von Individuen und Unternehmen den ethischen und rechtlichen Standards entsprach. Aber auch wenn wir darüber voll und ganz im Bild sind und die zuständigen Behörden entsprechend handeln (was bislang noch nicht der Fall gewesen ist), dann gibt uns das allein keine Hinweise darauf, was wir tun müssten, um den Schaden zu beheben und solche Ereignisse in Zukunft zu verhindern.
Damit kommen wir zur Phase, in der diverse Autoren von der Frage Was ist passiert? übergehen zur Frage Weshalb konnte es zu diesen Ereignissen kommen? Das ist die Aufgabe der Ökonomen. Der Ökonom tritt hier als Interpretationskünstler auf, der die Fakten in ein Bezugssystem einfügt, das zum Verständnis beiträgt und, wo nötig, Handlungsempfehlungen ausspricht. Das ist eine wichtige Aufgabe; ohne sie bleiben die persönlichen Schilderungen und professionell angefertigten Berichte nutzlos. Volkswirtschaftler nehmen diese Rolle ernst, und sie wachen eifersüchtig über die Vorherrschaft ihres Fachs in dieser Nische des Diskurses. Und so ist in den Regalen der Bibliotheken eine kleine Abteilung voller Interpretationen entstanden, von Autoren wie Nassim Taleb (Der Schwarze Schwan), Nouriel Roubini (Das Ende der Weltwirtschaft und ihreZukunft), Raghuram Rajan (Fault Lines – Verwerfungen), Joseph Stiglitz (Im Freien Fall) und Paul Krugman (Vergesst die Krise!).
Aber bislang hat sich noch kein gemeinsamer Nenner abgezeichnet. Im Gegenteil: Jeder Ökonom folgt seiner eigenen Auslegung, die sich von jener aller anderen unterscheidet und seine oder ihre Stellung innerhalb der Zunft widerspiegelt. All diese Deutungen messen sich auf dem Marktplatz der Ideen in einer Art Marketingwettbewerb. Was es braucht, um diesen Wettkampf zu gewinnen, ist nicht ganz klar, aber wichtig sind sicherlich Leidenschaft, politische Verbündete und eine prominente Plattform, um die eigenen Bücher zu bewerben. Dazu kommt Einfachheit: die Macht einer Idee, die leicht zu verstehen ist. Eine unkomplizierte Idee lässt sich viel einfacher verkaufen, auch wenn das zwangsläufig bedeutet, dass die Konflikte mit anderen Ideen ungelöst bleiben.
In den meisten Fällen haben Ökonomen versucht, die Krise als Beispiel für ein jeweils spezifisches finanzwirtschaftliches Phänomen zu interpretieren: Schwarze Schwäne, »Fat Tails«, Spekulationsblasen, staatliche Einmischung, Ungleichheit, Liquiditätsfallen. Die einen stellen einfache Metaphern dar, andere sind etwas ausgefeilter. Einige entstammen dem konservativen, andere dem linksliberalen Spektrum. Die einen folgen der vorherrschenden akademischen Volkswirtschaftslehre, andere weichen von ihr ab. Einige wenige bestehen überwiegend aus Falschinformationen oder sind politisch motiviert, opportunistisch oder sogar korrupt, andere beinhalten ein gutes Stück Wahrheit. Aber alle sind unvollständig. Bislang ist kaum versucht worden, diese Erklärungsversuche gegeneinander abzuwägen, und es gibt anscheinend noch nicht einmal eine Verständigung darüber, nach welchen Regeln man hierbei Vorgehen könnte. Ein kurzer Überblick wird uns helfen, diese Situation etwas zu erhellen.
Schwarze Schwäne
Die Theorie vom »Schwarzen Schwan« ist die vielleicht einfachste Erklärung der Großen Krise; sie besagt, dass nicht unbedingt etwas erklärt werden muss. Genau wie schwarze Schwäne sind Krisen selten. Das Versäumnis, ein selten auftretendes Ereignis vorauszusagen, ist zwar bedauernswert, aber es bedeutet nicht, dass die Wissenschaft versagt hat. Ein Modell kann hilfreich sein, auch wenn zuweilen seltene Ereignisse auftreten, die das Modell nicht vorausgesehen hat. Die Theorie vom Schwarzen Schwan verweist auf die begrenzte Fähigkeit eines theoretischen Apparats, Voraussagen zu machen. Mit ihr lässt sich der Standpunkt verteidigen, dass »niemand das Desaster von 2008 hätte vorhersehen können« – obwohl einige Leute genau das taten. Möglicherweise war die beste der verfügbaren Prognosen vor der Krise sogar die, dass es keine Krise geben würde, und dass jene, die etwas anderes behaupteten, nichts als Panikmacher waren, die in diesem einen Fall zufälligerweise Recht hatten – wie die sprichwörtliche kaputte Uhr, die zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt.
Ein erstes Problem mit dieser Erklärung besteht darin, dass Finanzkrisen global gesehen gar nicht besonders selten sind. Für Normalbürger in den USA und in Deutschland mag eine umfassende Kernschmelze des Finanzsystems ein Novum darstellen. Aber für internationale Investoren und Währungsspekulanten gehören sie sozusagen zum Inventar, und für Bürgerinnen und Bürger von weniger stabilen Ländern sind sie wohl oder übel fester Bestandteil des täglichen Lebens. Seit Mitte der 1990er-Jahre haben wir Finanzkrisen in Lateinamerika, Afrika, Russland, Island, in weiten Teilen Asiens, in Japan, in den Vereinigten Staaten und in der Eurozone erlebt.1 Die Vorstellung, dass Finanzkrisen eine Seltenheit darstellen, ist eine Illusion, und sie basiert einzig auf der Tatsache, dass Krisen in der Regel nicht dieselben Menschen in kurzen Abständen heimsuchen und in reichen Ländern weniger häufig auftreten als in armen.
Fat Tails
Die Idee der »Fat Tails«, der sogenannten fetten Verteilungsenden, dämpft den Optimismus der Black-Swan-Theorie. Sie räumt ein, dass extreme Ereignisse keineswegs rar sind. Aus Gewohnheit und mathematischer Zweckdienlichkeit gehen die Urheber ökonomischer Modelle in der Regel davon aus, dass das Auftreten von Fehlern »normal« (oder gaußisch) ist, sodass die relative Häufigkeit extremer Vorkommnisse bekannt ist. In diesem statistischen Sinn zeichnet sich der Normalzustand dadurch aus, dass extreme Ereignisse selten auftreten. Bei Ereignissen, die in menschlichen Zeitdimensionen gemessen werden, sollte die sogenannte Six-Sigma-Abweichung vom Durchschnitt nicht mehr als einmal in Tausenden von Jahren vorkommen. Aber Krisen können viel häufiger auftreten, als sie es – vom statistischen Standpunkt aus betrachtet – tun »sollten«. In der Realität entspricht die Verteilung der Ereignisse nicht unbedingt der Gaußschen Normalverteilung. In diesem Fall werden extreme Vorkommnisse viel häufiger sein als angenommen. Gemäß der Fat-Tail-Theorie ist es nicht einmal möglich vorherzusagen, wie oft mit einem Desaster zu rechnen ist. In ihrem Kern besagt die Theorie, dass sich das schlichtweg nicht messen lässt; wir wissen nur, dass Krisen vorkommen und dass das Risiko nicht zuverlässig abgeschätzt werden kann, indem man die Fläche unter der Normalkurve berechnet.
Und dennoch muss ein Modell, das keine Krise vorhersagt, auch in der Welt der Fat Tails nicht falsch sein. Die durchschnittliche Aussage – gleichzeitig die »beste« Annahme des Modells zu einem beliebigen Zeitpunkt – kann sein, dass alles weiterlaufen wird wie gehabt. Die Botschaft lautet, dass wir im Allgemeinen auf böse Überraschungen vorbereitet sein sollen, weil sie mit Sicherheit kommen werden, ohne dass wir genau sagen können, wann das der Fall sein wird. Wir können nicht einmal vorauskalkulieren, welche Richtung die Abweichung vom Normalzustand nehmen wird – es kann ein Boom sein, oder es kann ein Crash sein. Fat Tails sind gleichermaßen mathematische Ungeheuer wie auch unbarmherzige Wesenszüge der Welt, in der wir leben. Sie machen Wirtschaftsprognostikern und Spekulanten das Leben schwer, und sie sind ein Alptraum für die Leute, die mit den Desastern leben müssen, die – so die Theorie – zwingend auftreten werden.
Spekulationsblasen
Das englische Wort bubble, Blase, vermittelt etwas scheinbar Spezifischeres. Eine Blase ist ein quasi-mechanischer Prozess – ein physisches Phänomen mit gewissen Eigenschaften: Sie wächst langsam an, und sie platzt plötzlich. Diese Merkmale haben das Konzept der Blasen für die Beschreibung finanzwirtschaftlicher Dynamiken zu einem überaus beliebten Begriff gemacht. Die Idee scheint fast schon die Reichweite einer Theorie erlangt zu haben, nämlich in dem Sinn, dass sie eine Erklärung und eine Handlungshilfe bietet. Viele Leute, darunter eine ganze Reihe von Ökonomen, verwenden den Begriff, als beruhe er auf einer handfesten volkswirtschaftlichen Lehre, als müsse man nur eine entstehende Blase ausmachen, um mit Sicherheit zu wissen, dass ein Unglück droht. Das ist jedoch nicht der Fall. »Blase« ist lediglich ein bestechendes Bild, eine Metapher, die durch die wiederholte Verwendung in der Geschichte der Wirtschaftsdesaster vertraut geworden ist.
Die Metapher der Spekulationsblase vermittelt eine Zwangsläufigkeit: Blasen platzen immer. Wenn einmal eine Blase entstanden ist, gibt es kein Zurück. Zwar kann man hoffnungsvoll vom »Aufstechen« einer Blase reden oder auch von einer »sanften Landung«, aber das sind und bleiben Metaphern und damit klare Signale von Wunschdenken. Blasen sind weder Eiterbeulen noch Raumschiffe.
Noch einmal: Eine Blase ist in ihrem Wesen substanzlos, ein Epiphänomen. Sie existiert nur auf der Oberfläche einer tieferen Realität. Nach dem Platzen der Blase herrscht der Vorstellung zufolge wieder der Normalzustand: Die Welt kehrt zurück zur Situation vor Entstehung der Blase und steht im Durchschnitt weder schlechter noch besser da, als wenn die Blase nie entstanden wäre. In diesem Sinn war die »Greenspan-Doktrin«, die während der Zeit von Alan Greenspans Vorsitz der US-Notenbank vorherrschte, intellektuell konsequent, oder zumindest basierte sie auf einer in sich stimmigen Metapher: Die Doktrin besagte, dass die Behörden vom Versuch ablassen sollten, Blasen vorherzusagen, zu identifizieren, sie zu verhindern oder ihnen die Luft abzulassen. Es genüge, nach dem Platzen aufzuräumen.
Und schließlich schwingt in dem Wort »Blase« eine gewisse Unschuld mit. Blasen sind spielerisch. Auf lange Sicht vermittelt das Bild den Eindruck, dass Blasen harmlos seien. Sie sind keine Granaten oder Bomben; sie explodieren nicht, sondern sie platzen, sie töten nicht, und der Schaden, den sie hinterlassen, ist gering.
Diese drei Theorien – Schwarze Schwäne, Fat Tails und Blasen – haben eines gemeinsam, nämlich dass sie das Wirtschaftssystem so beschreiben, als gäbe es einen normalen, krisenfreien und stabilen Zustand. Alle drei besagen zwar, dass es zu einer Störung der Normalität kommen könne, dass aber die Störungen nicht vorhergesehen werden könnten. Folglich lägen Krisen zwangsläufig außerhalb der Reichweite vorbeugender Maßnahmen. Tatsächlich könnten sie nur im Nachhinein erklärt werden, und es gäbe keine Garantie, dass Gegenmaßnahmen die nächste Krise verhindern könnten. Diese Theorien teilen also einen gewissen Fatalismus, der es erlaubt, eine laxe Haltung in Bezug auf Regulierung – also das Prinzip des Laissez-faire – mit einer Welt in Einklang bringen, in der es von Zeit zu Zeit zu schlimmen Ereignissen kommt. Und eine noch gefährlichere Auffassung wird durch sie gestärkt: nämlich die, dass die Zustände, die zuvor als normal erachtet wurden, nach der Krise zurückkehren werden.
Die Vorstellung, dass es in der Wirtschaft einen Normalzustand gibt, hat die Ökonomen fest im Griff – sie hat sich praktisch in ihrem Unterbewusstsein festgesetzt. Lawrence Summers beispielsweise, 2009 und 2010 Wirtschaftsberater von Präsident Obama, schrieb in einem Artikel in der Financial Times Anfang 2012 wie folgt:
»Auch bei einer pessimistischen Interpretation des Potenzials der [US-amerikanischen] Wirtschaft bleibt die Arbeitslosigkeit 2 Prozentpunkte unter dem normalen Niveau, die Beschäftigung bleibt 5 Millionen Jobs unter dem möglichen Niveau, und das Bruttoinlandsprodukt bleibt fast 1 Billion Dollar hinter seinem Potenzial zurück. Selbst wenn die Wirtschaft jeden Monat 300 000 Stellen schafft und um 4 Prozent wächst, würde es mehrere Jahre dauern, bis der Normalzustand erreicht ist. Deshalb wäre dieses Jahr eine Rückkehr zu jener Politik, die in normalen Zeiten angemessen wäre, um einiges verfrüht.« (Summers 2012, Hervorhebungen hinzugefügt)
Man beachte die Wiederholung der Worte normal und Potenzial. Summers bringt damit eine Vorstellung zum Ausdruck, die er mit vielen Ökonomen teilt; sie liegt auch den offiziellen Prognosen der US-Regierung zugrunde und beeinflusst die Weltanschauung von Gesetzgebern und Präsidenten:2 die Auffassung, dass die Marktwirtschaft eine natürliche Tendenz zu einem Endzustand hoher Produktion und Beschäftigungsraten hat. Von diesem Normalzustand kann die Wirtschaft zwar aufgrund eines Schocks oder einer Krise abweichen – und wenn der Schock schwer ist, so fällt die Abweichung entsprechend groß aus. Aber wenn der Schock vorbei ist, beginnt der Aufschwung, und wenn die »Erholung« erst einmal eingesetzt hat, dann ist der Fortschritt hin zur »vollständigen Genesung« unaufhaltsam – es sei denn, eine erneute Erschütterung oder ein politischer Fehltritt kommen in die Quere.
Die nächsten Begriffe auf meiner kleinen Liste – der »starke Staat« und die »Ungleichheit« – laufen dieser Vorstellung zuwider. Das heißt, sie stellen nicht lediglich Metaphern oder Feststellungen über die Wahrscheinlichkeit einer Abweichung vom Normalzustand dar. Sie sind vielmehr Konzepte, die auf einer ökonomischen Theorie fußen: Sie beschreiben spezifische und prinzipiell messbare Zustände, die eine Barriere oder ein strukturelles Hindernis für eine Rückkehr zur Normalität darstellen können. Im Prinzip können diese Hindernisse seit langer Zeit bestehen oder sogar dauerhaft sein. Einige leiten sich aus Ideen der politischen Rechten ab, andere aus jenen der Linken – und ich habe aus jedem Lager eine gewählt. In beiden Fällen ist die Beschreibung einer Schranke ein Versuch, Kausalitäten sichtbar zu machen, um so zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden zu können. Auf diese Weise versucht diese Argumentation, uns aufzurütteln und zu einem politischen Richtungswechsel anzustiften. Wenn man diesen Theorien Glauben schenkt, und wenn man die Dinge ändern will, dann muss etwas unternommen werden.
Der starke Staat
Eine konservative Argumentation besagt, dass die staatliche Wohnungspolitik in den USA für die Große Krise verantwortlich gewesen sei. Als Paradebeispiel wird auf den Community Reinvestment Act von 1977 verwiesen, der Banken verpflichtete, bei der Vergabe von Darlehen nicht aufgrund des Einkommens zu diskriminieren.3 Beispiele Nummer zwei und drei sind Fannie Mae und Freddie Mac, die halbstaatlichen (wenn auch seit langer Zeit privatisierten) Institute, die errichtet wurden, um Hypotheken vom privaten Markt zu kaufen und so die Risiken zu bündeln und die Kreditgeber zu refinanzieren. Die Argumentation, die insbesondere Gretchen Morgenson und Joshua Rosner in ihrem Buch Reckless Endangerment wiederholten, besagt, dass diese Institute wegen der impliziten staatlichen Bürgschaft im Fall eines Verlusts Anreize für verantwortungsloses Verhalten (moral hazard) und die Suche nach ungeeigneten Kreditnehmern (adverse selection) schufen. In seinem von dieser Betrachtung abweichenden Untersuchungsbericht zur Finanzkrise schreibt Peter Wallison:
»Wenn der Staat kein Geld in den Hypothekenmarkt geleitet hätte, um den Hausbesitz zu fördern, dann wären NTMs [non-traditional mortgages, auf Deutsch nicht-traditionelle oder auch variable Hypotheken genannt, Anm. d. Ü.] in der Spekulationsblase relativ schnell nach ihrer Vergabe in Verzug geraten. Aber der stete Fluss von staatlichen oder staatlich garantierten Geldern ließ die Blase anwachsen – sie wurde größer und dauerte länger an und dies hatte zur Folge, dass die bedeutenden Zahlungsverzögerungen und Insolvenzen, die frühere Spekulationsblasen in drei oder vier Jahren beendet hatten, unterdrückt wurden.« (FCIC 2011, S.472)
Hinzu kommt laut einigen Ökonomen, dass die Risikobereitschaft sowohl durch die staatliche Einlagensicherung als auch durch die Doktrin des »Too Big To Fail« gefördert wurde, weil sie Entscheidungen der privaten Kreditvergabe eine staatliche Rückversicherung boten. Hätte die Regierung klargemacht, dass sie den Bankrott der größeren Banken in Kauf nehmen würde, so das Argument, dann hätte die Marktdisziplin sich durchgesetzt, die Banken wären vorsichtiger gewesen, und die Krise hätte vermieden werden können. Richard Fisher, Präsident der regionalen Notenbank von Dallas, ist ein prominenter Vertreter dieser Sichtweise.4
Man kann diesem Argument widersprechen, ohne es schlechtzumachen. Die zugrunde liegende Theorie ist in jedem Lehrbuch nachzulesen und besagt, dass Märkte und Institutionen effiziente Resultate erzielen, wenn sie nicht durch Verzerrungen beeinträchtigt werden – normalerweise seitens des Staates (aber zuweilen auch durch private Monopole oder Gewerkschaften), und meist zum Zweck eines höheren sozialen Ziels. Die Theorie ist komplex. Sie stellt sich eine Welt vor, in der wettbewerbsgesteuerte, gewinnorientierte Unternehmen auf rationale, zielgerichtete Individuen treffen. Sie geht davon aus, dass Unternehmensentscheide in der Regel die Verluste minimieren, die übermäßigen Risiken geschuldet sind. Mit anderen Worten, die Entscheidungen der Unternehmen sind normalerweise vernünftig. Aus dieser Annahme folgt, dass staatliche Maßnahmen zumindest die Gefahr bergen, die Selbstkontrollfunktion rationaler Unternehmensentscheide durcheinanderzubringen. Dahinter steckt der Gedanke, dass Bürokraten, wenn sie so schlau wären wie Unternehmer, eben keine Bürokraten wären, sondern Unternehmer.
Es gibt klare Beweise dafür, dass der Staat tatsächlich in den Wohnungsmarkt eingriff, um wenigverdienende Familien zum Kauf eines Eigenheims zu animieren. Fannie Mae und Freddie Mac gibt es wirklich. Sie sind – auch das stimmt – über ihren ursprünglichen Zweck hinausgegangen, nämlich erstklassige Hypothekendarlehen zu unterstützen, und haben begonnen, nicht-traditionelle Hypotheken zu finanzieren, die, als sie nicht zurückgezahlt werden konnten, das System in den Abgrund stürzten. Wer mehr Beweise braucht, findet in den Wohnungsgesetzen und anderen amtlichen Dokumenten zahlreiche unzweideutige Belege für die erklärte Absicht des Staates, den Eigenheimbesitz anzukurbeln. Auf dieser Grundlage – eine glasklare Theorie und wohlbekannte Fakten – entwarfen die republikanischen Mitglieder der Untersuchungskommission zur Finanzkrise ihre Kritik am Bericht dieser Kommission (aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress waren die meisten Kommissionsmitglieder von den Demokraten ernannt worden). Wallisons lange und oft verspottete Ausführungen hierzu sind in dieser Hinsicht sehr sorgfältig.
Ungleichheit
Hat Ungleichheit die Finanzkrise verursacht? Die Anfänge dieser Auseinandersetzung reichen weit zurück. Karl Marx hat eine Realisationskrise vorausgesehen, und zwar aufgrund von aggressiven Lohnkürzungen – der Proletarisierung der Arbeit –, begleitet von einer zunehmend kapitalintensiven Maschinenproduktion. Einfach ausgedrückt: Es würde, nach Marx, früher oder später zu viele Konsumgüter geben und zu wenig Einkommen, um sie zu kaufen. Die Ungleichheit der Einkommen würde zu einem Überangebot führen, oder zu einer Krise wegen mangelhaften Konsums. Die Folge wäre Massenarbeitslosigkeit, sofern und solange die Kapitalisten keinen externen Markt fänden, der ihre Waren aufzunehmen vermag. Diesen Zwang identifizierte Marx (und nach ihm Lenin und Rosa Luxemburg) als Beweggrund hinter dem Bestreben der europäischen Bourgeoisie, in Indien und Afrika Imperien zu errichten und die Märkte in Japan und China gewaltsam zu öffnen.
Versionen derselben Geschichte werden oft erzählt, um die Große Depression zumindest teilweise zu erklären – den Ideen des britischen Ökonomen J.A. Hobson folgend, der im späten 19. Jahrhundert lebte. In jüngerer Zeit nannte mein Vater, John Kenneth Galbraith, die »schlechte Einkommensverteilung« beiläufig als eine Ursache für den großen Crash, so etwa in seinem Buch Der Große Krach 1929 aus dem Jahr 1955. Die Sicherstellung einer stabilen Gesamtnachfrage nach Konsumgütern, indem man älteren Leuten ein sicheres Einkommen bot, war einer der Gedanken hinter der Einführung der Rentenversicherung in den 1930er-Jahren. Jerome Frank, der in den frühen Jahren des New Deal als Anwalt für die US-Regierung wirkte, schrieb 1938 in einem Buch mit dem Titel Save America first: »Das gesamte Nationaleinkommen wird gezwungenermaßen drastisch schrumpfen, wenn nicht eine genügend große Zahl von Bürgern einen angemessenen Anteil davon erhalten. Das Schicksal der Amerikaner, die ein relativ hohes Einkommen erzielen, ist deshalb untrennbar verbunden mit dem Schicksal jener, die wenig verdienen. Erstere können nicht erfolgreich sein, wenn es nicht auch Letztere sind.« (Frank 1938, S. 235)
Nach der Großen Krise haben Ökonomen, die die Ungleichheit als Ursache ausmachten, die alten Argumente über den unzureichenden Konsum umformuliert und an die Stelle der Notwendigkeit den Wunsch nach gewissen Konsumgütern gesetzt. Darüber hinaus führten sie das Element der Haushaltsschulden ein – im Vorfeld der Großen Depression der 1930er-Jahre spielten diese noch keine große Rolle, da die meisten Haushalte Mieter waren und Häuser mit Bargeld bezahlt wurden. So hat sich die Argumentation im Lauf der Jahrzehnte verschoben: Im Zentrum steht nicht mehr die Unfähigkeit, Grundbedürfnisse durch Einkommen zu befriedigen, sondern die Unfähigkeit, Zinszahlungen für unwesentliche Anschaffungen mit dem künftigen Einkommen zu begleichen.
Die neuen Theorien der Ungleichheit folgen dem großen Ökonomen Thorstein Veblen (1857–1929) und der »relativen Einkommenshypothese« des Konsumtheoretikers James Duesenberry (1918–2009), der diese Ende der 1940er-Jahre in Harvard entwickelte. Die neuen Theorien vertreten den Standpunkt, dass eine der wesentlichen sozialen Folgen, die sich aus der Einkommens- und Vermögensungleichheit zwischen dem Mittelstand und der reichsten Bevölkerungsschicht ergibt, der Neid ist: der Wunsch nach dem Lebensstil der Reichen. Teilweise kann man sich diesen Lebensstil als eine einfache Frage der Konsumgüter vorstellen: Sportwagen, Boote, Flachbildschirme. Andere Aspekte lassen sich besser als Positionsgüter messen: Wohnquartiere mit sauberer Luft, weniger Kriminalität und bessere Schulen. Außerdem stellt sich die keineswegs triviale Frage nach dem Status der Universität, an der die Kinder studieren können. Die Untersuchungen Robert Franks, Autor des Buchs Luxury Fever, sind hierzu sehr aufschlussreich.
Dieser Argumentation folgt Raghuram Rajan in seinem Buch Fault Lines – Verwerfungen. Nach seiner Lesart beginnt das Problem der steigenden Ungleichheit mit den stagnierenden Löhnen der arbeitenden Bevölkerung. Lohnstagnation führt zu Frustration, weil sich der Lebensstandard nicht verbessert. Und dann, wenn diese Leute die steigenden Einkommen der Reichen an der Spitze sehen – sagen wir mal, jene des berüchtigten »1 Prozent« –, verstärkt sich ihr Neid. Weil aufgrund der stagnierenden Löhne ihr Durst nicht aus einem Einkommenszuwachs gestillt werden kann, füllen sie die Lücke mit Schulden – was in den Nachkriegsjahren möglich wurde, als die Banken erstmals Privathaushalten Geld liehen, meist gegen die Wertzunahme ihrer Häuser. So steigen die (privaten) Schulden und der Schuldendienst in Verhältnis zum Einkommen an, insbesondere für jene am unteren Ende der Einkommensleiter. Und die Krise bricht schließlich aus, wenn die zu diesem Zweck aufgenommenen Schulden nicht mehr beglichen werden können.
Diese Geschichte wird vornehmlich von gemäßigten Konservativen erzählt – eine Bezeichnung, die wohl auch auf Rajan zutrifft –, aber sie fügt sich auch gut ins Weltbild eines gewissen Teils der politischen Linken. Zum Beispiel passt sie zu der auf dem »strukturellen Keynesianismus« beruhenden Erklärung der Krise, wie sie der Ökonom Thomas Palley vorgebracht hat. Seine Botschaft lautet, dass der Medianlohn (und daher die Familieneinkommen) proportional zu den Einkommen der Wohlhabenden hätte steigen müssen. Das hätte die Ungleichheit und, so nimmt er an, auch Habgier und Eifersucht in Schranken gehalten, und die Leute wären nicht versucht gewesen, sich für ihren Konsum zu verschulden. Die Finanzstabilität wäre aufrechterhalten worden, und es hätte keine Krisen gegeben.
Wie bei der Debatte um die staatliche Einmischung gibt es eine Reihe von oberflächlichen Beweisen, die diese Erklärung für die Vereinigten Staaten plausibel erscheinen lassen: etwa die Tatsache, dass die mittleren Einkommen, wenn man die erwerbstätige Bevölkerung als Ganzes betrachtet, ab den frühen 1970er-Jahren tatsächlich stagnierten und nur in den späten 1990er-Jahren kurzfristig anstiegen. Ein zweiter Beweis ist das statistische Faktum, dass die gemessene Einkommensungleichheit vor dem großen Börsenkrach 1929 einen ersten Höhepunkt erreicht hatte, und dann einen zweiten genau vor dem Nasdaq-Crash im Jahr 2000. Zumindest in Bezug auf die zeitliche Abfolge scheint es also eine Verbindung zu geben zwischen Lohnstagnation, dem Anstieg der Ungleichheit und dem Auftreten von Finanzkrisen – so wie es anscheinend eine Beziehung gibt zwischen staatlichen Absichtserklärungen zur Ausweitung des Hauseigentums (die »Eigentumsgesellschaft«, wie man sie eine Zeitlang nannte) und den Entscheidungen von Privatbanken, Kredite an Hausbesitzer zu vergeben, die dafür normalerweise nicht infrage gekommen wären.
Aber erneut stellt sich die Frage: Überzeugt diese Geschichte? Stellen wir einige logische Überlegungen an, um diese Frage zu beantworten. Erstens: Müssen stagnierende Medianlöhne (also der Lohn jener Erwerbstätigen, die sich jeweils genau in der Mitte der Einkommensverteilung befinden) zwingend bedeuten, dass die Einkommen der einzelnen Erwerbstätigen stagnieren und so zur Frustration bezüglich ihres Lebensstandards führen? Zweitens: Auch wenn die Einkommen der einzelnen Erwerbstätigen steigen würden, wären sie dann zwingenderweise weniger neidisch auf jene, die mehr verdienen, und deshalb weniger anfällig für den kompetitiven Konsum, der durch die Anhäufung von Schulden angeheizt wird?
Ein Moment des Nachdenkens müsste die Leser zur Vorsicht mahnen. Trifft es zu, dass ein stagnierender Medianlohn einem stagnierenden Lohn für den Einzelnen entspricht? Die Antwort ist: Nein, das ist nicht zwingend der Fall. Stellen wir uns eine Belegschaft vor, in der alle Löhne, für jeden Job und jede Erfahrungsstufe, jedes Jahr genau gleich bleiben wie im Vorjahr, und stellen wir uns des Weiteren vor, dass es keine Bevölkerungszunahme oder -abnahme gibt. Das Einzige, was in diesem Szenario passiert, ist, dass einzelne Angestellte jedes Jahr eine fixe Lohnerhöhung erhalten, die ihre zunehmende Arbeitserfahrung widerspiegelt, und zwar bis zum Tag, an dem sie in den Ruhestand treten. Jedes Jahr tritt eine Gruppe von Schulabgängern und Uniabsolventen der Belegschaft am unteren Ende bei, und eine Gruppe von ranghöheren Angestellten lässt sich pensionieren. In dieser Welt wird der mittlere Lohn immer gleich bleiben. Und dennoch hat jeder Angestellte jedes einzelne Jahr ein höheres Einkommen! Jede und jeder Angestellte wird demnach in jedem Jahr einen höheren Lebensstandard als im Vorjahr genießen. Mit anderen Worten, ein stagnierender Medianlohn darf nicht verwechselt werden mit einer Lohnstagnation für den Einzelnen. Ein stagnierender mittlerer Lohn verträgt sich bestens (zumindest im Prinzip, wenn auch nicht in der tatsächlichen Erfahrung) mit ringsum steigenden Löhnen.
Überlegen wir uns jetzt, was passiert, wenn sich die Belegschaft verändert – mehr Frauen, junge Leute, Angehörige von Minderheiten und Einwanderer kommen hinzu, während ältere weiße Männer das Unternehmen aufgrund ihres Alters oder des industriellen Wandels verlassen müssen. Neue Angestellte, junge Leute, Einwanderer und Mitglieder benachteiligter Gruppen haben fast immer einen Lohn, der unter dem Mittel liegt. Entsprechend fällt der Medianlohn. In dieser Situation wird er nach unten gezogen, und zwar weil es mehr Angestellte gibt, deren Löhne unter dem vorherigen Mittel liegen. Und dennoch sind alle neuen Angestellten jetzt, wo sie einen Job haben, besser dran als vorher, als sie nicht angestellt waren. Und jeder Angestellte erhält weiterhin Jahr für Jahr eine Lohnerhöhung und ein steigendes Einkommen – bis zum schlimmen Tag, an dem die Fabrik schließt, der Job nach Übersee ausgelagert oder der Angestellte in den Ruhestand versetzt wird. In diesem Szenario verschiebt sich die Beschäftigungsstruktur im Lauf der Zeit insgesamt hin zu weniger gut bezahlten Arbeitsplätzen. Möglicherweise werden die neuen Jobs hauptsächlich für Geringqualifizierte und in schlecht bezahlten Bereichen des Dienstleistungssektors geschaffen, während gut bezahlte, gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie im Verhältnis abnehmen. Aber nur ein Teil der Angestellten wird diese Verschiebung als einen persönlichen Verlust wahrnehmen, solange sie Teil der Belegschaft bleiben. Die Mehrheit erlebt Jahr für Jahr eine geringe Verbesserung, mit steigendem Alter, zunehmender Erfahrung und einer gelegentlichen Beförderung.
Ist dies eine plausible Darstellung der Entwicklung in den Vereinigten Staaten? Selbstverständlich. In den vergangenen vierzig Jahren ist der Anteil weißer Männer in der aktiven Erwerbsbevölkerung um rund 11 Prozentpunkte zurückgegangen, in erster Linie (aber nicht immer) weil ältere Angestellte in den Ruhestand gingen. Der Anteil der Arbeiter in der verarbeitenden Industrie ist um die Hälfte eingebrochen. Und wenn man sich die mittleren Einkommen innerhalb der ethnischen Minderheiten und bei den Frauen anschaut, dann sieht man, dass sie bis Ende der 1990er-Jahre mehrheitlich anstiegen, obwohl der Medianlohn stagnierte.5 Entsprechend gibt es keinen triftigen Grund zur Annahme, dass einzelne Arbeiter frustrierter oder neidischer seien als frühere Generationen.
Es trifft zwar zu, dass viele von ihnen anfangs verhältnismäßig ärmer waren als die vorige Generation. Und es stimmt auch, dass sich die gesamte Struktur der Erwerbsbevölkerung hin zu weniger gut bezahlten Arbeitsplätzen verschoben hat. Aber was kümmert das die Angestellten? Verglichen mit ihrer früheren Stellung machten viele schlecht bezahlte Arbeitnehmer die Erfahrung eines Einkommenszuwachses – und ihre frühere Stellung ist ausschlaggebend, wenn es um konsumbedingte Verschuldung geht, ausgelöst durch Neid.
Der zweite Teil der Geschichte läuft darauf hinaus, dass die Erwerbstätigen im Fall von steigenden Löhnen und einem steigenden Lebensstandard zufriedener gewesen wären und sich keine übermäßigen Schulden aufgeladen hätten, um mit jenen gleichzuziehen, die auf der Konsumleiter einige Stufen über ihnen saßen. Aber wieso sollte dies der Fall gewesen sein? Auch wenn die Löhne der »Working Poor« schnell steigen, bleiben ihre Einkünfte stets weit hinter jenen der Reichen zurück. Wenn die Kluft zwischen den Einkommen ausschlaggebend ist für die Verschuldung, dann sollte es keine Rolle spielen, wie schnell der Lohn steigt. Denn die Kluft bleibt sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten bestehen, und (wenn man von der Prämisse ausgeht, dass Neid den Wunsch nach Konsumgütern anstachelt) so auch der Zwang, mehr auszugeben, als man einnimmt. Stattdessen wird es darauf ankommen, ob die Geldverleiher bereit sind, die entsprechenden Kredite zu vergeben.
Doch dieser Faktor fehlt. In der Argumentation, dass steigende ökonomische Ungleichheit die Krise verursacht habe, kommen die Kreditinstitute und Schattenbanken nicht vor. Sie spielen keine aktive Rolle. Die Theorie geht davon aus, dass Darlehen verfügbar sind für jene, die sie wollen, für welchen Zweck auch immer. In dieser merkwürdigen Welt leihen reiche Leute armen Leuten Geld. Die Banken sind lediglich Bindeglieder, die Geldmittel verschieben von jenen, die mehr haben als sie brauchen, zu jenen, die mehr brauchen als sie haben. Ausschlaggebend ist allein die Nachfrage nach Kredit, das Angebot spielt keine Rolle.
Nachdem er die Banken aus seinem Bild retuschiert hat, legt Raghuram Rajan in seinem Buch sein Augenmerk auf den Ursprung der steigenden Nachfrage nach Krediten, mit besonderer Berücksichtigung der Frage, weshalb sich die Einkommensschere in den Vereinigten Staaten in den vergangenen dreißig Jahren so weit geöffnet hat. Den Grund findet er in einer »undifferenzierten Sozialisierung und einer ebenso undifferenzierten frühkindlichen Lernförderung sowie in Grund- und weiterführenden Schulen, die viele amerikanische Schüler nicht ausreichend für ein College-Studium qualifizieren« (Rajan 2012, S.19). Nach seiner Lesart haben diese Faktoren das starke Lohngefälle zwischen wohlhabenden Amerikanern und jenen in der Mitte der Einkommensverteilung verursacht. Mit anderen Worten: In einem effizienten Arbeitsmarkt verdienen dumme Leute einfach weniger. Und dies wiederum habe zu der »politischen Antwort« geführt, die »in einer Ausweitung der privaten Kreditvergabe […] insbesondere auf einkommensschwache Haushalte [bestand]. Die Vorteile – ein wachsender Konsum und die Entstehung neuer Arbeitsplätze – waren unmittelbar spürbar, während sich die Rechnung für diese Lösung auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschieben ließ. So zynisch es auch klingen mag, wurden Kredite im Verlauf der gesamten Geschichte von Regierungen, die unfähig sind, sich direkt mit den tiefer liegenden Ängsten und Sorgen der Mittelschicht auseinanderzusetzen, als Linderungsmaßnahme eingesetzt.« (Ebd., S. 20) Dumme Leute bekommen Kredite, damit sie zufrieden bleiben.
Das heißt also: Seine Argumentation läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass die finanzielle Kernschmelze ausgelöst wurde durch Mangelernährung, die Unzulänglichkeit von Head Start (ein Förderprogramm für Kinder aus armen Familien), und das Versagen der öffentlichen Schulen. Diese Versäumnisse – die größtenteils staatlich verschuldet sind – führten zu steigender Ungleichheit und riefen letzten Endes den Staat auf den Plan, der jene Kredite lockermachte, die dann eine »unvermeidliche Rechnung« hinterließen. So zynisch es auch klingen mag: Die Banken spielen in dieser Erzählung praktisch keine Rolle. Obwohl Rajan einräumt, dass sie raffiniert und unmoralisch seien, so tragen sie bei ihm keine Verantwortung und könnten genauso gut teilnahmslose Zuschauer sein.
Wenn diese Geschichte stimmt und der vorangegangene Prozess der steigenden Lohnungleichheit für den Zusammenbruch verantwortlich war, dann wäre der gesamte Ausbau der Bankenregulierung nach der Krise, die Stärkung der Finanzaufsicht und die Untersuchung von Missbräuchen logischerweise nichts als Zeitverschwendung. Schließlich waren die Banken nach dieser Lesart passive Beteiligte. Die Akteure waren jene Haushalte mit mittleren und tiefen Einkommen, die stur an ihrem gewünschten Konsum festhielten, obwohl ihr Lohn sie nicht dazu berechtigte. Plötzlich nimmt die Moral der Geschichte eine andere Färbung an: Während laut der »konservativen« Interpretation staatliche Entscheidungen die Banken in die Irre führten, treffen die Banken in der Ungleichheitstheorie gar keine Entscheidungen, tragen demnach auch keine Verantwortung. Man fragt sich: Ist das wirklich die »progressive« Alternative zum konservativen Standpunkt?
Selbstverständlich nicht. Brechen wir deshalb die Suche nach einspurigen Erklärungen ab. Wir brauchen einen anderen Ansatz. Ich schlage vor, dass wir die Geschichte mit der Welt beginnen, die unsere Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg schufen.
Teil IIm Garten der Optimisten
Kapitel 1Das unendliche Wachstum
Um zu verstehen, weshalb die Weltöffentlichkeit den Ausbruch der Großen Finanzkrise mit solcher Fassungslosigkeit verfolgte, muss man sich die Mentalität jener Leute vor Augen führen, die unsere Erwartungen in den Jahren vor der Krise formten: die Führungsriege der akademischen Wirtschaftswissenschaften. Die meisten Spitzenökonomen von heute absolvierten ihre Ausbildung in der Zeitspanne von den späten 1960er- bis zu den 1980er-Jahren. Aber ihre Gesinnung geht weiter zurück: in die Nachkriegszeit und die Anfänge des Kalten Kriegs, betrachtet aus den Cockpits von Cambridge, Massachusetts, und Chicago. An den dortigen Universitäten entstanden damals die modernen Grundsätze der amerikanischen Ökonomie, die noch heute vorherrschen.
Diese Lehren führten das Konzept des ökonomischen Wachstums in die Volkswirtschaftslehre ein; im Lauf mehrerer Jahrzehnte gelang es ihnen, die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner vom Glauben zu überzeugen, dass Wachstum nicht nur wünschenswert, sondern auch normal, konstant und voraussehbar sei. Wachstum wurde zur Lösung für die meisten (wenn auch nicht für alle) alltäglichen ökonomischen Probleme, insbesondere Armut und Arbeitslosigkeit. Wir lebten in einer Kultur des Wachstums; es zu hinterfragen war, naja, Ausdruck von Gegenkultur. Die Funktion des Staates bestand darin, das Wachstum zu erleichtern und zu fördern, und darüber hinaus vielleicht die zyklischen Schwankungen abzuschwächen, die sich von Zeit zu Zeit über den zugrunde liegenden Trend legen mochten. Dass das Wachstum ausbleiben könnte, lag jenseits der Vorstellungskraft. Zuweilen traten zwar Abschwünge auf – man nannte sie jetzt Rezessionen – aber auf eine Rezession folgte stets der Aufschwung und letztendlich die Rückkehr zum langfristigen Trend. Dieser Trend war definiert als der potenzielle Output, der langfristige Trend bei hoher Beschäftigung, der damit zum Richtwert wurde.
Um zu sehen, was daran neu war, ist es sinnvoll, diese Periode sowohl von der viktorianischen Mentalität des 19. Jahrhunderts abzugrenzen, wie sie Karl Marx oder John Maynard Keynes beschrieben hatten, als auch von der alltäglichen Erfahrung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im viktorianischen England bestand das höchste Ziel für die Gesellschaft nicht im Wirtschaftswachstum, wie wir es verstehen. Ziel war vielmehr die Investition oder die Kapitalakkumulation. Wie Marx es ausdrückte: »Akkumuliert, akkumuliert! Das ist Moses und die Propheten!« Keynes formulierte es in Krieg und Frieden. Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags von Versailles (1919 erstmals unter dem Titel The Economic Consequences of the Peace in London erschienen) folgendermaßen:
»Europa war sozial und ökonomisch so organisiert, dass eine maximale Kapitalakkumulation möglich war. […] Hierin lag in der Tat die hauptsächliche Berechtigung des kapitalistischen Systems. Hätten die Reichen ihren neuen Reichtum zum eigenen Vergnügen ausgegeben, hätte die Welt schon vor langer Zeit eine solche Ordnung unerträglich gefunden. Doch sie sparten und horteten wie die Bienen, was der gesamten Gesellschaft zugute kam – auch wenn sie selbst damit engere Ziele verfolgten.« (Keynes 2014, S. 51)
Aber Akkumulieren wofür? Im Prinzip für Profit, Macht und sogar fürs Überleben. Es war etwas, zu dem sich die Kapitalisten aufgrund ihrer ökonomischen und sozialen Stellung verpflichtet fühlten. Es war nicht