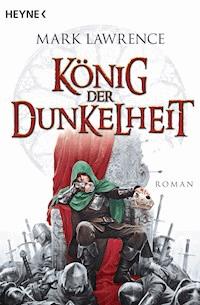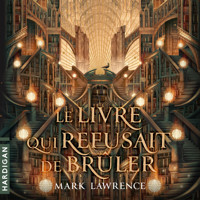13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Waffenschwestern
- Sprache: Deutsch
»Waffenschwestern« ist der Auftaktband zu einer neuen Fantasy-Trilogie von Bestseller-Autor Mark Lawrence. Nona ist kein gewöhnliches Kind: Sie hat auffällig schwarze Augen und schwarze Haare und kann sich mit übernatürlicher Geschwindigkeit bewegen. Und sie ist erst acht, als sie ihren ersten Mord begeht. Nona steht schon im Schatten des Galgens, als sie von der Äbtissin des Klosters zur süßen Gnade gerettet wird, wo sie man sie zur Kriegerin ausbildet. Doch der Mann, den sie getötet hat, gehörte einer der mächtigsten Familien des Reiches an – die alles daransetzt, sich an ihr und den Schwestern des Konvents zu rächen. Doch Nona ist alles andere aIs leichte Beute. Im Kloster zur süßen Gnade leben Mystikerinnen, die das Gewebe der Welt manipulieren, Schwestern der Verschwiegenheit, die sich der Kunst der Täuschung widmen, und hier werden die gefährlichsten Kriegerinnen des Reiches ausgebildet. Nona durchläuft ein rigides Trainingsprogramm, das sie mit dem mystischen Pfad vertraut macht, den geheimen Künsten des geräuschlosen Tötens und der Fähigkeit, mit den verschiedensten Waffen zu kämpfen. Mit den anderen Novizinnen ist sie in Freundschaft und Liebe – und manchmal auch leidenschaftlichem Hass – verbunden. Nicht alle werden es schaffen, aber diejenigen, die ihren Weg bis zu Ende gehen, werden Teil der Schwesternschaft. Sie werden die gefährlichsten Klingen des Reiches, sie werden Waffenschwestern sein. Für Leser von Joe Abercrombie, Anthony Ryan, Brent Weeks und Peter V. Brett. »Wie eine Mischung aus Harry Potter und Anthony Ryans ›Das Lied des Blutes‹, nur mit komplett weiblicher Besetzung.« Tor.com »Ein exzellenter Autor.« George R.R. Martin »Mark Lawrence' bisher bestes Buch.« The British Fantasy Society
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mark Lawrence
Waffenschwestern – Das erste Buch des Ahnen
Über dieses Buch
»Will man eine Nonne töten, so gilt es sicherzustellen, dass man über ein Heer von hinreichender Größe verfügt.«
Das Kloster zur süßen Gnade ist kein gewöhnlicher Konvent. Hier leben Mystikerinnen, die das Gewebe der Welt manipulieren, Schwestern der Verschwiegenheit, die sich der Kunst der Täuschung widmen, und hier werden Mädchen zu tödlichen Kriegerinnen ausgebildet. Als die junge Nona von einer Äbtissin in den Konvent geholt wird, ahnt sie nicht, dass ihre Ausbildung sie bis an ihre Grenzen führen wird – und weit darüber hinaus.
Nona durchläuft ein rigides Trainingsprogramm, dass sie mit dem mystischen Pfad vertraut macht, den geheimen Künsten des geräuschlosen Tötens und der Fähigkeit, mit den verschiedensten Waffen zu kämpfen. Mit den anderen Novizinnen ist sie in Freundschaft und Liebe – und manchmal auch leidenschaftlichem Hass – verbunden. Nicht alle werden es schaffen, aber diejenigen, die ihren Weg bis zu Ende gehen, werden Teil der Schwesternschaft. Sie werden die gefährlichsten Klingen des Reiches, sie werden Waffenschwestern sein.
»Waffenschwestern« ist das erste Buch des Ahnen von Mark Lawrence.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mark Lawrence wurde in Illinois (USA) geboren und lebt in Bristol (UK). Als promovierter Mathematiker arbeitete er eine Zeitlang im »Star Wars«-Raketenabwehrprogramm, bevor ihn die Leidenschaft für die Fantasyliteratur packte. Er war mehrfach für den Goodreads Choice Award nominiert und ist mit dem David Gemmel Award für den besten Fantasy-Roman ausgezeichnet worden.
Frank Böhmert, Jahrgang 1962, wurde hauptsächlich durch seine Mitarbeit an der Perry Rhodan-Serie bekannt und lebt als Autor und Übersetzer in Berlin. Er hat Autoren wie Philip K. Dick, James Tiptree jr. und Daryl Gregory ins Deutsche gebracht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Red Sister« bei ACE/Penguin Random House LLC. Copyright © 2017 by Bobalinga Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung mehrerer Bilder von shutterstock/Liu zishan und Bastien Lecouffe Deharme
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490560-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Celyn, deren Eloquenz nicht auf Worte angewiesen ist.
Rote Klasse
Prolog
Will man eine Nonne töten, so gilt es sicherzustellen, dass man über ein Heer von hinreichender Größe verfügt. Für Schwester Dorn vom Kloster zur süßen Gnade führte Lano Tacsis zweihundert Mann heran.
Von der Stirnseite des Konvents aus sieht man sowohl das Nord- als auch das Südeis, den schöneren Ausblick bieten jedoch die Hochebene und dahinter die Flucht des schmalen Lands. An einem klaren Tag erhascht man vielleicht sogar einen Blick auf die Küste mit der Marnsee als Andeutung in Blau.
An irgendeinem Punkt der quälend langen Geschichte hat ein längst vergessenes Volk eintausendvierundzwanzig Säulen auf der Hochebene errichtet: korinthische Riesen, dicker als eine tausendjährige Eiche, höher als eine Langkiefer. Ein Wald aus Stein ohne Ordnung oder Muster, der sich von der einen Seite bis zur anderen erstreckt, so dass man darin an keiner Stelle weiter als zwanzig Meter von einer Säule entfernt ist. Schwester Dorn wartete inmitten dieses Waldes, allein und auf der Suche nach ihrer Mitte.
Lanos Männer schwärmten zwischen den Säulen aus. Dorn konnte den Feind weder sehen noch hören, seine Position jedoch war ihr bekannt. Sie hatte zuvor beobachtet, wie die Männer den Westweg aus dem Styxtal heraufgeschlichen waren, jeweils im Dreier- oder Viererglied: Pelarthi-Söldner aus den Randlanden, Felle des Weißbärs und des Schneewolfs überm Lederzeug, manche in Fetzen von Kettenhemden gehüllt, die uralt und geschwärzt waren oder wie neu glänzten, je nach Glück. Viele trugen Speere, manche Schwerter, einer von fünfen einen kurzen Reflexbogen aus Horn. Hünen hauptsächlich, blond, die Bärte gestutzt oder geflochten, die Frauen mit blauen Strichen auf Stirn und Wangen wie die Strahlen einer kalten Sonne.
Dieser eine Moment.
Die ganze Welt und mehr kam durch die Ewigkeit herangerast, schrill den Strang der Jahre herab, um bei diesem Schlag deines Herzens anzugelangen. Und wenn du es zulässt, wird das Universum sich, ohne Luft zu holen, durch dieses Bruchstück einer Sekunde zwängen und zur nächsten rasen, fort in eine neue Ewigkeit. Alles, was ist, der Nachhall von allem, was war, die Wurzeln von allem, was je sein wird, all das muss durch diesen Moment hindurch, der dir gehört. Du hast lediglich die Aufgabe, ihn innehalten zu lassen – ihn aufmerksam werden zu lassen.
Dorn stand dort ohne Regung, denn nur wenn man wirklich still ist, kann man die Mitte sein. Ohne einen Laut stand sie da, denn lauschen kann man nur lautlos. Stand da ohne Furcht, denn nur die Furchtlosen vermögen die Gefahr zu erfassen.
In ihr die Stille des Waldes, verwurzelte Rastlosigkeit, eichenlangsam, kiefernschnell, eine brausende Geduld. In ihr die Stille von Eiswänden, die dem Meer trotzen, klar und tief, die blaue Geheimnisse kühl halten vor der Wahrheit der Welt und dicht gepackt einem unvermittelten Abfall trotzen, eine Geduld von Äonen. In ihr die Reglosigkeit eines schmerzgeborenen Kindes, das sich in seiner Krippe nicht rührt. Und die der Mutter, erstarrt in ihrer Entdeckung, kurz nur und doch endlos lang.
Dorn bewahrte ein Schweigen, das alt gewesen war, bevor die Nonne das Licht der Welt erblickt hatte. Eine über Generationen weitergegebene Ruhe. Den Frieden, der uns ermahnt, die Morgendämmerung zu betrachten, das stillschweigende Bündnis mit Welle und Flamme, die uns verstummen lassen und uns verleiten, vor dem Wogen und Schwellen innezuhalten oder zu warten, bis wir den verschlingenden Freudentanz der Flammen mitangesehen haben. In ihr das Schweigen eines Kindes, das zu Fremden gegeben wurde: stumm, unbewusst, gezeichnet für Jahre. In ihr all das Unausgesprochene der ersten Liebe, die Zunge gelähmt, um Worte verlegen und keinesfalls willig, eine so überwältigende und einmalige Empfindung mit etwas so Plumpem wie Worten zu beschmutzen.
Dorn wartete. Furchtlos wie Feldblumen, leuchtend, zart, dem Himmel offen. Tapfer wie nur diejenigen sein können, die bereits verloren haben.
Stimmen drangen zu ihr, Rufe der Pelarthi, die einander auf den unterbrochenen Freiflächen der Ebene aus dem Blick verloren. Schreie schallten über das Gelände, hallten von den Säulen wider, Fackellicht flackerte, eine Vielzahl von Schritten, lauter, näher. Dorn rollte unter der Schwarzhautrüstung mit den Schultern. Sie verstärkte ihren Griff um die scharfen Gewichte der beiden Wurfsterne, ihr Atem ruhig, das Herz rasend.
»An diesem Ort sehen mir die Toten zu«, flüsterte sie. Ein plötzlicher Ruf nahebei, huschende Gestalten zwischen zwei Säulen, erneut Deckung suchend. Viele Gestalten. »Ich bin eine Waffe im Dienst der Lade. Wer mich angreift, der erfährt, was Verzweiflung ist.« Mit der steigenden Anspannung, Vorbote jeden Kampfes, wurde ihre Stimme lauter. Ein summendes Kribbeln über ihren Wangenknochen, eine Enge in der Kehle, das Gefühl, sich tief in ihrem Körper zu befinden und zugleich über ihm und um ihn herum.
Der erste Pelarthi kam in Sicht getrabt und blieb bei ihrem Anblick stolpernd stehen. Ein junger Mann, bartlos, doch mit harten Augen unter dem Eisen seines Helms. Weitere drängten heran, verteilten sich auf dem Schlachtfeld.
Die Rotschwester neigte zum Gruß den Kopf.
Dann ging es los.
1
Kein Kind glaubt ernsthaft, dass es hängen wird. Noch unter dem Galgen, mit dem kratzenden Strick um die Handgelenke und dem Schatten der Schlinge im Gesicht, sind sie überzeugt, dass jemand vortreten wird, eine Mutter, ein lang verschollener Vater, ein König, der Gnade gewähren will … irgendjemand. Wenige Kinder haben lange genug gelebt, um die Welt zu begreifen, in die sie hineingeboren wurden. Das gilt wohl auch für manche Erwachsene, doch die haben dann zumindest einige bittere Lektionen gelernt.
Saida erklomm die Stufen des Schafotts, wie sie so viele Male die hölzernen Sprossen zum Dachboden der Caltess hinaufgestiegen war. Dort schliefen sie alle, die jüngsten Arbeiter, ausgestreckt zwischen den Säcken, dem Staub und den Spinnen. Heute Abend würden die anderen diese Sprossen hinaufklettern und im Dunkeln von Saida flüstern. Morgen Abend würde das Geflüster verklungen sein und ein neuer Junge, ein neues Mädchen den leeren Platz ausfüllen, den Saida unter dem Dachstuhl hinterlassen hatte.
»Ich hab nichts gemacht«, sagte sie ohne Hoffnung, mit längst wieder trockenen Augen. Der Wind schnitt von Westen her, ein Schneiswind, die Sonne glühte rot und nahm den halben Himmel ein, ohne viel Wärme zu spenden. Saidas letzter Tag?
Eher gleichgültig als grob schob der Wärter sie weiter. Sie sah zu ihm hoch. Groß, alt, mit festem Fleisch, als hätte der Wind es bis auf die Knochen abgeschliffen. Noch ein Schritt, die Schlinge baumelte dunkel vor der Sonne. Der Gefängnishof lag nahezu ausgestorben da, eine Handvoll sahen von den schwarzen Schatten aus zu, wo der Außenwall Schutz bot, alte Frauen, deren graue Haare flatterten. Saida fragte sich, was sie hergelockt hatte. Vielleicht waren sie so alt, dass sie sich Sorgen über das Sterben machten und sehen wollten, wie es ging.
»Ich war das nicht. Nona war’s. Hat sie doch selber gesagt.« Sie hatte diese Worte so oft ausgesprochen, dass jede Bedeutung herausgelaugt worden war und nur noch bleiche Laute übrig blieben. Und doch stimmten sie. Von vorn bis hinten. Wie Nona selber gesagt hatte.
Der Henker bedachte Saida mit dem allerschmalsten Lächeln, beugte sich herunter und überprüfte den Strick an ihren Handgelenken. Der saß zu fest und juckte, und ihr tat der Arm weh, wo Raymel ihn gebrochen hatte, aber Saida sagte nichts, sondern suchte nur mit Blicken den Hof ab, die Türen zu den Zellentrakten, die Nebengebäude, sogar das große Tor zur Außenwelt. Jemand würde kommen.
Drüben beim Zapfen, einem gedrungenen Turm, in dem der Gefängnisvorsteher angeblich in einem Luxus lebte, der jeder hohen Familie zur Ehre gereicht hätte, flog eine Tür auf. Ein Wärter blinzelte in die Sonne. Bloß ein Wärter. Die Hoffnung, die das Mädchen prompt durchrieselt hatte, verflüchtigte sich wieder.
Hinter dem Wärter trat eine kleinere, breitere Gestalt heraus. Saida sah wieder auf, hoffte wieder. Eine Frau in dem langen Habit einer Nonne stand im Hof. Nur der Stab in ihrer Hand mit seiner gebogenen goldenen Spitze bezeichnete ihre Stellung.
Der Henker bemerkte sie, und sein Lächeln verflog. »Die Äbtissin …«
»Die hat sich hier unten noch nie blicken lassen.« Der alte Wärter packte Saidas Schulter fester.
Saida öffnete den Mund, der jedoch zu trocken für ihre Gedanken war. Die Äbtissin kam ihretwegen. Kam, um sie zum Orden des Ahnen mitzunehmen. Um ihr einen neuen Namen und neues Obdach zu geben. Saida war nicht einmal überrascht. Sie hatte nie ernsthaft geglaubt, dass sie hängen würde.
2
Der Gestank eines Gefängnisses ist ehrlich. Die Beschönigungen der Wärter, das öffentliche Lächeln des Vorstehers, selbst die Fassade des Gebäudes können lügen und wieder lügen, der Gestank jedoch erzählt die ungeschminkte Wahrheit: Fäulnis und Abwasser, Krankheit und Verzweiflung. Dennoch roch es in Harriton angenehmer als in vielen anderen Strafanstalten. Ein Hinrichtungsgefängnis gab seinen Insassen nicht die Gelegenheit, zu verfaulen. Ein kurzer Aufenthalt, ein langer Fall am kurzen Strang, und sie konnten oben auf dem Armenfriedhof in Winscon in einem Sammelgrab für Straftäter seelenruhig die Würmer füttern.
In seiner Anfangszeit als Wärter hatte der Gestank Argus zu schaffen gemacht. Angeblich gewöhnt man sich nach einer Weile an solche Gerüche und nimmt sie gar nicht mehr wahr. Das stimmt, gilt jedoch auch für so ziemlich alle anderen Widrigkeiten des Lebens. Nach zehn Jahren in Harriton ließ ihn das Spektakel des Hälselangziehens ebenso kalt wie der Gestank.
»Wann hast du Feierabend?« Früher hatte ihn Davas Besessenheit von den Zeitplänen anderer Leute genervt, nun jedoch antwortete er, ohne groß einen Gedanken daran zu verschwenden. »Zur Siebenglocke.«
»Zur Sieben!« Die kleine Frau legte mit ihrer üblichen Kritik an ungerechten Schichtzeiten los. Dabei trotteten die beiden zum Haupthaus hinüber, das nichtöffentliche Schafott im Rücken. Dort baumelte Jame Lender außer Sicht unter der Falltür und zuckte noch immer. Um Jame hatte sich nun der Grabmann zu kümmern. Schon bald würde der alte Herber mit seinem Eselskarren eintrudeln und die Tagesladung abholen. Die kurze Strecke bis zum Winscon Hill mochte sich für den alten Herber, seine fünf Fahrgäste und den Esel, der fast ebenso gebrechlich war wie sein Herr, durchaus als lange Fahrt erweisen. Dass Jame kaum Fleisch auf den Knochen hatte, würde die Last immerhin erleichtern. Das und die Tatsache, dass zwei der anderen vier Toten kleine Mädchen waren.
Herber würde sich seinen Weg durchs Schneiderviertel bahnen und rauf zur Akademie fahren, um sämtliche Leichenteile zu verhökern, die aktuell gefragt waren. Allzu viel würde er dem Sammelgrab oben auf dem Berg wohl nicht hinzufügen – bei gutem Tagesgeschäft nur ein paar nasse Überreste.
»… gestern zur Sechsglocke, vorgestern zur Fünf.« Dava war am Ende ihrer Kritik angelangt, an der sie seit Jahren festhielt; ihrem beständigen Wittern von Ungerechtigkeiten verdankte sie den Mumm, es mit Verurteilten aufzunehmen, die zweimal so groß waren wie sie.
»Wer ist das?« Eine hochgewachsene Gestalt klopfte mit schwerem Stock an die Tür zum Trakt für die Neuen.
»Der Kerl von der Caltess, du weißt schon.« Dava schnipste mit den Fingern vor ihrem Gesicht, als ließe sich die Antwort so hervorlocken. »Der die Kämpfe organisiert.«
»Partnis Reeve!«, rief Argus, als ihm der Name einfiel, und der Hüne wandte sich um. »Weilchen her.«
Partnis musste seine Kämpfer oft genug aus den Tageszellen auslösen. Man führte keinen Stall voller wütender und gewalttätiger Männer, ohne dass diese nach Feierabend die ein oder andere Nase brachen; im Allgemeinen jedoch endeten sie nicht oben in Harriton. Normalerweise bewahren Berufskämpfer einen hinreichend kühlen Kopf, um während ihrer Kneipenschlägereien keine Toten zu hinterlassen. Es sind die Amateure, die ausrasten und auf einen niedergeschlagenen Gegner eintreten, bis nur noch Brei übrig ist.
»Mein Freund!« Partnis wandte sich mit ausgebreiteten Armen und einem breiten Lächeln um, ohne sich an Argus’ Namen zu versuchen. »Ich komme mein Mädchen holen.«
»Dein Mädchen?« Argus runzelte die Stirn. »Hab dich nicht für einen Familienmenschen gehalten.«
»Ein Lehrmädchen. Eine Arbeiterin.« Partnis winkte ab. »Nun mach schon die Tür auf, guter Mann. Sie soll heute hängen, und ich wurde schon lange genug aufgehalten.« Er verzog missmutig das Gesicht.
Argus holte den schweren Eisenschlüssel heraus. »Hast sie wahrscheinlich schon verpasst, Partnis. Wird langsam dunkel. Da kommt der alte Herber längst mit seinem Karren die Gassen runtergequietscht, um seine Beute einzusacken.«
»Die quietschen beide, stimmt’s? Herber und sein Karren«, warf Dava ein. Sie riss ständig Witze. Lachen wollte nie einer.
»Ich hab einen Boten geschickt«, sagte Partnis. »Mit der Anweisung, dass die Caltess-Mädchen erst gehenkt werden sollen, wenn …«
»Anweisung?« Argus verharrte, den Schlüssel im Schloss.
»Dann eben mit dem Vorschlag. Um eine Silbermünze gefaltet.«
»Ach so.« Argus drehte den Schlüssel und machte auf. Er nahm mit seinem Besucher die Abkürzung durch die Wachstube, vorbei an dem kleinen Zellentrakt für die Neuen und wieder hinaus in den Hof.
Unter dem Fenster des Vorstehers hockte das öffentliche Schafott.
Das Haupttor war bereits geöffnet, um den Karren des Grabmanns einzulassen. Dicht bei den Stufen zum Schafott wartete eine kleine Gestalt, die von einem einzelnen Wärter bewacht wurde, von John Fallon offenbar.
»Gerade noch rechtzeitig!«, sagte Argus.
»Gut.« Partnis machte ein paar Schritte, stockte dann. »Ist das nicht …« Er verzog die Lippen zu einem frustrierten Knurren.
Argus folgte seinem Blick und entdeckte den Grund seines Unmuts. Die Äbtissin des Klosters zur süßen Gnade schritt durch die kleine Menge von Schaulustigen vor den Stufen des Zapfens. Auf diese Entfernung hätte sie irgendeine alte Witwe sein können, eine recht kleine, rundliche, in schwarzen Stoff gehüllte Gestalt, doch ihr Krummstab beseitigte jeden Zweifel.
»Herrgott nochmal, diese scheußliche alte Hexe will mich schon wieder beklauen.« Partnis ging schneller, woraufhin Argus widerwillig in einen würdelosen Trab verfiel, um Schritt zu halten. Dava, auf der anderen Seite des Mannes, musste rennen.
Trotz seiner Eile kam Partnis nur knapp vor der Äbtissin beim Schafott an. »Wo ist das andere?« Er sah an dem Wärter vorbei, als hätte dieser hinter sich noch jemanden versteckt.
»Das andere was?« John Fallon warf einen Blick zu der Nonne, die mit flatterndem Habit anmarschiert kam.
»Mädchen! Es waren zwei. Ich hab Anweisung gegeben … Ich habe darum nachgesucht, dass sie noch zurückgehalten werden.«
»Drüben bei den Gehenkten.« Fallon deutete mit dem Kopf zu einem meterhohen Haufen neben dem Haupttor. Die fleckige graue Decke darüber war mit Steinen beschwert. Jetzt kam der Karren des Grabmanns in Sicht.
»Verdammnis!« Das Wort brach laut genug aus Partnis hervor, dass alle im Hof sich umwandten. Er hob die Hände, sichtlich um Beherrschung bemüht, und senkte sie wieder. »Ich will sie beide.«
»Über die Große musst du dich mit dem Grabmann einig werden«, konstatierte Fallon. »Über die hier …« Er griff nach dem Mädchen an seiner Seite. »Mit mir. Dann mit den beiden.« Er nickte zu Dava und Argus hin. »Und dann mit dem Vorsteher.«
»Da gibt es nichts zum Einigen.« Die kleine Äbtissin trat zwischen Fallon und Partnis und unterbrach mit dem Krummstab ihren Blickkontakt. »Ich werde das Kind nehmen.«
»Von wegen!« Partnis sah mit finsterem Gesicht auf sie hinab. »Bei allem nötigen Respekt dem Ahnen gegenüber und so weiter, aber sie gehört mir, mit Handschlag und bar bezahlt.« Er sah zurück zum Tor, wo Herber seinen Karren neben dem abgedeckten Haufen zum Stehen gebracht hatte. »Außerdem … woher wissen Sie, dass das die Kleine ist, die Sie wollen?«
Die Äbtissin schnaubte und bedachte Partnis mit einem gütigen Lächeln. »Natürlich ist sie es. Das sieht man auf einen Blick, Partnis Reeve. Dieses Kind hat das Feuer in den Augen.« Sie runzelte die Stirn. »Das andere habe ich gesehen. Verängstigt. Verloren. Es hätte niemals hier sein sollen.«
»Saida ist noch in der Zelle …«, mischte sich das Mädchen ein. »Die haben gesagt, ich soll als Erste.«
Argus musterte das Mädchen. Ein kleines Ding in unförmigem Leinen – keine Straßenlumpen, voller rostbrauner Flecken zwar, doch trotzdem die Kleidung eines Kaufkinds. Sie war vielleicht neun. Argus tat sich inzwischen schwer damit, das einzuschätzen. Seine beiden Großen waren längst erwachsen, und die kleine Sali würde für immer fünf bleiben. Dieses Mädchen hier war eine Wilde und guckte finster aus ihrem schmalen, verdreckten Gesicht. Schwarze Augen unter einem kurzen Schopf ebenholzfarbener Haare.
»War ja vielleicht trotzdem die andere. Die war richtig groß«, sagte Partnis ohne rechte Überzeugung. Ein Kampfmeister erkennt das Feuer, wenn er es sieht.
»Wo ist Saida?«, fragte das Mädchen.
Die Augen der Äbtissin weiteten sich leicht. Es sah fast aus wie Schmerz. Und war schneller wieder weg als der Schatten eines Vogelflügels. Argus entschied, dass er es sich nur eingebildet hatte. Die Klostervorsteherin wurde vieles genannt, nur wenig davon ins Gesicht, und »weichherzig« zählte nicht dazu.
»Wo ist meine Freundin?«, fragte das Mädchen erneut.
»Bist du deshalb geblieben?« Die Äbtissin zog einen Rauhapfel aus ihrem Habit, so dunkel, dass er fast schwarz sein mochte, ein bitteres und holziges Stück Obst. Ein Maulesel fraß so etwas vielleicht – die meisten Menschen verzichteten darauf.
»Geblieben?«, mischte Dava sich ein. »Sie ist geblieben, weil das hier ein verflixtes Gefängnis ist und sie mit Fesseln an den Händen unter Bewachung steht!«
»Bist du geblieben, um deiner Freundin beizustehen?«
Die Kleine antwortete nicht, sondern funkelte die Frau nur an, als wollte sie sich im nächsten Moment auf sie stürzen.
»Fang.« Die Äbtissin warf ihr den Apfel zu.
Zack, unterbrach eine kleine Hand seinen Flug. Der Apfel klatschte in die Handfläche. Hinter dem Mädchen fiel ein Strick zu Boden.
»Fang.« Die Äbtissin hatte wieder einen Apfel in der Hand und warf ihn mit Kraft.
Das Mädchen fing ihn in der anderen Hand.
»Fang.«
Woher genau die Nonne ihren Obstvorrat eigentlich holte, konnte Argus nicht sagen, aber im nächsten Moment war es ihm auch egal, denn er starrte den dritten Apfel an, der zwischen den beiden Händen klemmte, die noch die anderen Äpfel hielten.
»Fang.« Die Äbtissin warf erneut einen Rauhapfel, aber die Kleine ließ ihre drei fallen und den vierten über ihre Schulter hinwegfliegen.
»Wo ist Saida?«
»Du kommst mit, Nona Grey«, sagte die Äbtissin freundlich. »Über Saida reden wir im Kloster.«
Partnis bewegte sich zu dem Mädchen hin. »Ich gebe sie nicht her. Eine geschätzte Tochter! Außerdem hat verflixt wenig gefehlt, und sie hätte Raymel Tacsis umgebracht. Die Familie wird niemals zulassen, dass sie freikommt. Aber wenn ich zeigen kann, was sie wert ist, darf ich sie vielleicht vorher noch ein paarmal kämpfen lassen.«
»Raymel ist tot. Ich hab ihn getötet. Ich …«
»Geschätzt?«, unterbrach die Äbtissin das Mädchen. »Ich bin überrascht, dass Sie sie haben gehen lassen, Mr. Reeve.«
»Wäre ich dort gewesen, hätte ich es nicht zugelassen!« Partnis ballte die Faust, als wollte er die verpasste Gelegenheit doch noch beim Schopf packen. »Ich war am anderen Ende der Stadt, als ich davon gehört habe. Als ich zurückkam, war die Hölle los … überall Blut … Die Leute von Tacsis warteten schon … Hätte die Stadtwache die Kleine nicht hierhergeschleift, säße sie längst in Thurans Privatverlies. Er ist kein Mann, der einen Sohn verliert und Däumchen dreht.«
»Und genau deshalb werden Sie sie mir überlassen.« Das Lächeln der Äbtissin erinnerte Argus an seine Mutter. So hatte sie gelächelt, wenn sie im Recht gewesen war und sie es beide gewusst hatten. »Ihre Taschen sind nicht tief genug, um die kleine Nona hier herauszubekommen, sollte der junge Tacsis sterben, und selbst wenn Sie ihre Freilassung erreichen könnten, wären weder Sie noch Ihr Etablissement hinreichend robust, dass Sie sich Thuran Tacsis’ Vergeltungsgelüsten widersetzen könnten.«
Das Mädchen versuchte sich einzumischen. »Woher kennen Sie meinen Namen? Ich hab ihn nicht …«
Die Äbtissin unterbrach die Kleine erneut. »Wohingegen meine Freundschaft zu Vorsteher James älter ist als Sie, Mr. Reeve. Und kein Mann bei Verstand wird einen Angriff auf einen Konvent des Ahnen vorbereiten.«
»Sie sollten sie nicht als Rotschwester aufnehmen.« Partnis bekam den verdrießlichen Tonfall eines Mannes, der begreift, dass er verloren hat. »Es ist nicht richtig. Sie gehört nicht dem Ahnenglauben an … und sie ist praktisch eine Mörderin. Und bösartig, heißt es.«
»Den Glauben kann ich ihr vermitteln. Die Rotschwestern brauchen, was sie bereits hat.« Die Äbtissin hielt dem Mädchen eine rundliche Hand hin. »Komm, Nona.«
Nona sah zu John Fallon hinauf, zu Partnis Reeve, zu dem Henker und dem Galgenstrick, der neben ihm baumelte. »Saida ist meine Freundin. Wenn ihr ihr was getan habt, bring ich euch alle um.«
Schweigen herrschte, während sie über die fallengelassenen Äpfel hinwegtrat und die Hand der Äbtissin ergriff.
Argus und die anderen sahen ihnen nach. Beim Tor blieben sie stehen, schwarze Gestalten vor der roten Sonne. Das Kind ließ die Äbtissin los und machte drei Schritte zu dem abgedeckten Haufen. Der alte Herber und sein Esel sahen sie an, ebenso im Bann des Geschehens wie die anderen. Nona stand da, starrte auf den Haufen. Sie sah zu den Männern beim Schafott – ein langer, langsamer Blick – und kehrte zur Äbtissin zurück. Sekunden später war das Paar um die Ecke verschwunden.
»Hat unser Schicksal besiegelt, die Kleine«, sagte Dava.
Immer noch am Witze reißen. Über die immer noch niemand lachte.
3
Einmal kam ein Jongleur in Nonas Dorf, das so klein war, dass es weder einen Namen noch einen Marktplatz besaß. Der Jongleur, eine magere Erscheinung, trug Schlammkrusten und ein ausgeblichenes Narrenkostüm. Er kam allein, ein junger Mann, dunkle Augen, flinke Hände. Aus einem Leinenbeutel zog er bunte Lederbälle, schwarzweiß gestreifte Stäbe und grob gefertigte Messer hervor.
»Kommt her und schaut, der große Amondo wird euch unterhalten und zum Staunen bringen.« Es klang wie ein Spruch, der nicht von ihm stammte. Er präsentierte sich der Handvoll Dörfler, die nicht auf dem Feld oder im Haus arbeiteten und dennoch wacker einem Schneiswind trotzten, der mit Eisregen gewürzt war. Dann legte er seinen Hut, der breitkrempig war und Aufmerksamkeit heischend das Maul aufriss, in ihre Mitte, nahm vier gestreifte Stäbe und ließ sie in der Luft tanzen.
Amondo blieb drei Tage, obwohl sich nach der ersten Stunde des ersten Abends kein Publikum mehr blicken ließ. Traurig, aber wahr: Ein einzelner Jongleur, so beeindruckend er sein mag, kann nur ein gewisses Maß an Unterhaltung bieten.
Nona jedoch blieb bei ihm und beobachtete jede Bewegung, jedes geschickte Einklemmen und Einhaken, jeden Wechsel. Sie blieb sogar, als es dunkel wurde und das letzte der anderen Kinder sich verkrümelte. Stumm und mit starrem Blick sah sie zu, wie der Jongleur seine Requisiten wieder im Beutel verstaute.
»Du bist eine von der stillen Sorte.« Amondo warf ihr einen verschrumpelten Apfel aus seinem Hut zu, in dem noch mehrere bessere Exemplare lagen, außerdem zwei Brötchen, ein Stück von Kennals Ziegenhartkäse sowie dazwischen versteckt ein Quarterpenny, der eigentlich die Hälfte eines zersägten Halfpennys aus Kupfer war.
Nona hielt den Apfel dicht an ihr Ohr und lauschte dem Geräusch ihrer Finger an den Runzeln. »Die anderen können mich nicht leiden.«
»Nein?«
»Nein.«
Amondo jonglierte unsichtbare Bälle und wartete.
»Sie sagen, ich bin böse.«
Ein unsichtbarer Ball entglitt Amondo. Er ließ die übrigen auch noch fallen und zog eine Augenbraue hoch.
»Mutter meint, das sagen sie, weil mein Haar so schwarz ist und meine Haut so blass. Sie meint, ich hab meine Haut von ihr und mein Haar von meinem Pa.« Die anderen Kinder hatten braune Haut und rotblondes Haar von ihren Eltern, aber Nonas Mutter stammte aus dem Randland, und der Clan ihres Vaters jagte oben auf den Gletschern; sie waren beide Fremde. »Mutter meint, sie können einfach niemanden leiden, der anders ist.«
»Ganz schön hässliche Gedanken für so junge Dinger.« Der Jongleur hob seinen Beutel auf.
Nona stand da und sah auf den Apfel in ihrer Hand, ohne ihn wahrzunehmen. Die Erinnerung hielt sie gefangen. Ihre Mutter in ihrer schummrigen Hütte, wie sie zum ersten Mal das Blut an Nonas Händen sah. Was ist das denn? Haben sie dir weh getan? Nona hatte langsam den Kopf geschüttelt. Billem Smithson hat versucht, mir weh zu tun. Das war in ihm drin.
»Sieh mal zu, dass du zu deinen Eltern kommst.« Amondo drehte sich langsam im Kreis, musterte die Hütten, die Bäume, die Scheunen.
»Mein Pa ist tot. Das Eis hat ihn geholt.«
»Na dann.« Ein Lächeln, nur halb traurig. »Ich bring dich am besten nach Hause.« Er strich sich das lange Haar zurück und reichte ihr die Hand. »Wir sind doch Freunde, stimmt’s?«
Nonas Mutter ließ Amondo in der Scheune schlafen, die allerdings kaum mehr war als ein Stall, in dem sich das Schaf verstecken konnte, wenn der Schnee kam. Sie meinte, die Leute würden reden, aber darauf gebe sie nichts. Nona verstand nicht, wie man überhaupt etwas auf Gerede geben konnte. Das waren doch bloß Geräusche.
An dem Abend, als Amondo abreiste, ging Nona ihn in der Scheune besuchen. Er hatte den Inhalt seines Beutels vor sich auf dem festgestampften Boden ausgebreitet, wo das rote Mondlicht durch den Türeingang fiel.
»Zeig mir, wie man jongliert«, sagte sie.
Er sah von seinen Messern auf und grinste, die dunklen Haare vor den dunklen Augen. »Jonglieren ist schwer. Wie alt bist du?«
»Klein.« Sie zählten im Dorf nicht die Jahre. Man war ein Baby, dann klein, dann groß, dann alt, dann tot.
»Klein ist ja noch ziemlich winzig. Ich bin zwanzig Jahre und zwei. Da zähle ich wohl als groß.« Er lächelte, doch es lag mehr Sorge als Freude darin; als würde die Welt keinen Sinn ergeben und Großen auch nicht mehr Trost bieten als Kleinen. »Versuchen wir’s mal.«
Amondo hob drei Lederbälle auf. Im Mondlicht waren ihre Farben kaum zu erkennen, aber da bald der Brennpunkt kam, war es zum Werfen und Fangen hell genug. Amondo gähnte und rollte mit den Schultern. Eine rasche Folge von Handbewegungen, und die drei Bälle tanzten auf ihren ineinander verschränkten Bögen. »So.« Er fing sie. »Jetzt du.«
Nona nahm die Bälle. Einige wenige der anderen Kinder hatten es mit zweien geschafft. Drei Bälle war ein Hohn. Amondo sah zu, wie sie die Bälle in den Händen drehte, um ihr Gewicht zu begreifen, ein Gefühl für sie zu bekommen.
Seit seiner Ankunft hatte sie den Jongleur beobachtet. Nun stellte sie sich das Muster vor, das die Bälle in der Luft beschrieben hatten, den Rhythmus seiner Hände. Sie warf den ersten Ball auf die notwendige Höhe und verlangsamte die Welt um sich herum. Dann den zweiten Ball, der träge von ihrer Hand fortschwebte. Einen Moment später tanzten alle drei nach Nonas Flöte.
»Beeindruckend!« Amondo stand auf. »Wer hat dir das beigebracht?«
Nona runzelte die Stirn und hätte fast einen Fang verpasst. »Na, du.«
»Lüg mich nicht an, Mädchen.« Er warf ihr einen vierten Lederball zu, braun mit einem blauen Streifen.
Nona fing ihn, warf ihn, passte mit Mühe das Muster an, und im nächsten Moment hielt sie alle vier in der Luft, in langen, langsamen Bögen.
Amondos zorniger Blick traf sie wie aus heiterem Himmel. Sie hatte gedacht, dass er sich freuen würde – dass er sie dafür gernhaben würde. Er hatte gesagt, dass sie Freunde wären, aber sie war noch nie mit jemandem befreundet gewesen, und er hatte es so beiläufig gesagt … Diese Gemeinsamkeit hätte doch vielleicht dafür sorgen können, dass er es noch einmal sagte, hätte es vor aller Welt besiegelt. Freunde. Sie griff bei einem Ball mit Absicht daneben und warf den nächsten dann falsch.
»Ein Zirkusmensch hat es mir beigebracht«, log sie. Die Bälle rollten davon in die dunklen Ecken, wo die Ratten hausten. »Ich übe. Jeden Tag! Mit … Steinen … glatten Steinen aus dem Fluss.«
Amondo atmete aus und setzte ein brüchiges Lächeln auf. »Niemand lässt sich gern für dumm verkaufen, Nona. Nicht einmal Narren.«
»Wie viele kannst du jonglieren?«, fragte sie. Männer erzählten immer gern von sich und ihrem Können. So viel wusste Nona über Männer, auch wenn sie noch klein war.
»Gute Nacht, Nona.«
Damit war Nona entlassen und eilte zu der kleinen Hütte zurück, in der ihre Mutter und sie wohnten, und überall um sie herum gleißte das Licht des Brennmonds wärmer als die Mittagssonne.
»Schneller, Mädchen!« Die Äbtissin zog Nona am Arm und riss sie aus ihren Erinnerungen an Amondo, die die Rauhäpfel wieder wachgerufen hatten. Die Frau warf einen Blick über die Schulter. Kurz darauf erneut. »Beeil dich!«
Nona ging schneller. »Wieso?«
»Weil es nicht lange dauern wird, bis der Gefängnisvorsteher uns seine Männer nachschickt. Mich werden sie anschreien – dich werden sie hängen. Also munter mit den Füßen!«
»Sie haben gesagt, Sie waren schon mit dem Vorsteher befreundet, als Partnis Reeve noch nicht einmal geboren war!«
»Also hast du doch zugehört.« Die Äbtissin führte sie eine schmale Gasse hinauf, die so steil war, dass es alle paar Meter ein oder zwei Stufen erforderte und die Hausdächer einander überlappten. Nona stieg Ledergeruch in die Nase, der sie an Amondos bunte Bälle erinnerte, ein so kräftiger Geruch wie im Kuhstall, stark, satt, poliert, braun.
»Sie haben gesagt, Sie und der Vorsteher wären Freunde!«
»Ich bin ihm ein paarmal begegnet. Ein abstoßendes Männlein. Glatze, schielt, inwendig noch hässlicher.« Sie umrundeten die vorm Ladentreppchen eines Schusters ausgelegten Waren. Anscheinend kam alle paar Häuser ein Schuster, mit einem alten Mann oder einer jungen Frau im Fenster, die auf Absätze einhämmerten oder Leder zuschnitten.
»Sie haben gelogen!«
»Die Bezeichnung Lüge hilft einem selten weiter, Kind.« Die Äbtissin kämpfte sich schweratmend den Hang hinauf. »Worte sind Schritte auf einem Weg: Das Wichtige ist, an dein Ziel zu gelangen. Du kannst nach allen möglichen Regeln spielen – wer auf den Spalt tritt, stürzt ab –, doch am schnellsten erreichst du es auf der gangbaren Route.«
»Aber …«
»Lügen sind eine komplexe Angelegenheit. Am besten schlägt man sich gar nicht erst mit Begrifflichkeiten wie Wahrheit oder Lüge herum – mach die Notwendigkeit zu deinem Leitstern … und sei erfinderisch!«
»Sie sind gar keine Nonne!« Nona entwand ihr die Hand. »Und Sie haben zugelassen, dass die Saida töten!«
»Hätte ich sie gerettet, hätte ich dich dortlassen müssen.«
Von irgendwo weiter unten am steilen Hang kamen Rufe.
»Schnell.« Die Gasse führte eine schmale Treppe hinauf zu einer breiten Durchgangsstraße, und die Äbtissin bog ab, ohne stehenzubleiben oder nach hinten zu sehen.
»Die wissen doch, wo wir hinwollen.« Nona hatte in ihrem kurzen Leben schon oft weglaufen und sich verstecken müssen; sie wusste durchaus, dass es egal war, wie schnell man lief, wenn die wussten, wo sie einen fanden.
»Sie wissen aber auch, dass sie nicht mehr Hand an uns legen können, wenn wir erst einmal da sind.«
Die Straße war voller Menschen, doch die Äbtissin wand sich einen Weg mitten durch die Menge. Nona folgte ihr so dichtauf, dass die Schöße des Habits sie umflatterten. Menschenmengen machten sie nervös. So viele Leute, wie sich hier drängten, hatte es in ihrem Dorf nicht gegeben, nicht einmal in ihrer ganzen Welt. Und sie waren alle verschieden, manche Erwachsene kaum größer als sie, andere überragten selbst die massigen Riesen, die in der Caltess kämpften. Manche dunkel, mit Haut schwarz wie Tinte, manche weißblond und so blass, dass sich jede Ader blau abzeichnete, und alle möglichen Schattierungen dazwischen.
Durch die zur Straße heraufführenden Gassen blickte Nona auf ein Meer von Dächern, geziegelt aus Terrakotta und mit unzähligen Schornsteinen gespickt, aus denen Rauch trieb. Einen so großen Ort, der so dicht mit Menschen bepackt war, hatte sie sich nie träumen lassen. Seit der Nacht, als der Kindersammler mit ihr und seinen anderen Neuerwerbungen nach Verity hineingefahren war, hatte sie fast nichts von der Stadt gesehen, nur die Kampfhalle, die Wohnanlage der Kämpfer und die Trainingsplätze. Und auf der Fahrt zum Gefängnis hatten Saida und sie sich aneinander festgeklammert und auch nicht viel mehr mitbekommen.
»Hier durch.« Die Äbtissin legte Nona eine Hand auf die Schulter und lenkte sie zu den Stufen einer Art Säulentempel, dessen große, mit unzähligen Bronzescheiben beschlagene Torflügel offenstanden.
Die Stufen waren so hoch, dass Nona jeden Schritt in den Beinen merkte. Oben erwartete sie eine gewaltige Halle, die von hohen Fenstern erhellt war, jeder Quadratmeter vollgestopft mit Ständen und Menschen, die den besten Angeboten nachjagten. Das Geschrei der Händler sprach, von den Marmorgewölben hoch oben zurückgeworfen und verstärkt, mit einer vielstimmigen Zunge. Mehrere Minuten lang waren da nur Lärm und Farbe und Geschiebe. Nona konzentrierte sich darauf, die hinter der eilenden Äbtissin entstehende Lücke zu füllen, bevor sich jemand anders dazwischendrängen konnte. Endlich stolperten sie in einen kühlen Gang und hinaus auf eine ruhigere Straße hinter der Markthalle.
»Wer sind Sie?«, fragte Nona. Sie war der Frau jetzt weit genug gefolgt. »Und«, wurde ihr erst jetzt klar, »wo ist Ihr Stock?«
Die Äbtissin wandte sich um, eine Hand in die lila Perlenkette an ihrem Hals verschlungen. »Ich bin Schwester Glas. Frau Äbtissin für dich. Und meinen Krummstab habe ich gleich hinter der Schuhgasse einem reichlich verblüfften jungen Mann in die Hand gedrückt. Ich hoffe, die Wachen des Vorstehers sind ihm gefolgt und nicht uns.«
»Glas, so heißt doch niemand. Das ist eine Sache. Ich hab welches im Arbeitszimmer von Partnis Reeve gesehen.« Ein hartes und fast unsichtbares Zeug, das die Schneiswinde draußenhielt.
Die Äbtissin wandte sich ab und marschierte weiter. »Jede Schwester nimmt, wenn sie als geeignet erachtet wird, das Bündnis mit dem Ahnen einzugehen, einen neuen Namen an. Um uns von den Weltlichen zu scheiden, handelt es sich dabei stets um den Namen eines Gegenstands oder einer Sache.«
»Ach so.« In Nonas Dorf beteten die meisten zu den namenlosen Göttern des Regens und der Sonne, wie man es überall in Grey machte, und sie stellten auf den Feldern Garbenpuppen auf, um für eine gute Ernte zu sorgen. Ihre Mutter und ein paar der jüngeren Frauen jedoch gingen zu der neuen Kirche drüben in White Lake, wo ein grimmiger junger Mann von dem Gott sprach, der sie retten würde, dem Licht, das jetzt in diesem Augenblick auf sie zuraste. Das Dach der Kirche vom Licht stand immer offen, damit sie sehen konnten, wie der Gott näherkam. Für Nona sah er aus wie alle anderen Sterne auch, nur weiß anstatt rot und heller. Sie hatte gefragt, ob die anderen Sterne auch Götter wären, aber das hatte ihr nur eine Ohrfeige eingebracht. Prediger Mickel sagte, der Stern sei das Licht und sei auch der eine Gott, und bevor das Nordeis und das Südeis sich vereinten, würde er kommen und die Gläubigen erretten.
In den Städten jedoch beteten sie hauptsächlich zum Ahnen.
»Da. Siehst du es?«
Glas’ Finger zeigte zu einer Hochebene jenseits der Stadtmauer, in vielleicht fünf Meilen Entfernung. Die Strahlen der tiefstehenden Sonne fielen auf ein Kuppelgebäude.
»Dorthin wollen wir.« Damit setzte sich die Äbtissin wieder in Bewegung und trat über einen Haufen Pferdeäpfel hinweg, die so frisch waren, dass die Gärtnerburschen sie noch nicht hatten aufsammeln können.
»Sie haben da ganz oben doch nicht von mir gehört?« Nona konnte es kaum glauben.
Die Äbtissin lachte auf, es klang freundlich und ansteckend. »Ha! Nein. Ich hatte anderweitig in der Stadt zu tun. Ein Glaubensbruder erzählte mir deine Geschichte, und da habe ich auf dem Rückweg zum Kloster noch im Gefängnis vorbeigeschaut.«
»Woher wussten Sie dann, wie ich heiße? Wie ich wirklich heiße, nicht wie Partnis mich genannt hat.«
»Hättest du den vierten Apfel fangen können?«, stellte die Äbtissin eine Gegenfrage.
»Wie viele Äpfel können Sie fangen, alte Frau?«
»So viele wie nötig. Jetzt beeil dich.«
Nona wusste vielleicht nicht viel von der Welt, doch sie merkte, wenn jemand bei ihr Maß nahm, und sie ließ sich nicht gern aushorchen. Die Äbtissin hätte so lange Äpfel geworfen, bis Nona an ihre Grenze gekommen wäre – und dann dieses Wissen bereitgehalten wie ein Messer in der Scheide. Nona verkniff sich eine Entgegnung und ging schneller. Zur Stadtmauer hin leerten sich die Straßen, die Schatten waren schon lang.
Links und rechts gähnten Seitengassen, dunkle Mäuler, die darauf warteten, Nona mit einem Happs zu verschlucken. Da konnte das Lachen der Äbtissin noch so freundlich sein, Nona traute ihr nicht. Sie hatte zugesehen, wie Saida starb. Brav mitzugehen war vielleicht ein Fehler. Bei einer Horde Nonnen auf einem windigen Berg draußen vor der Stadt zu leben war besser als der Galgen, aber so viel besser nun auch nicht.
»Mr Reeve hat gesagt, Raymel ist noch am Leben. Das stimmt nicht.«
Die Äbtissin zog in einer flüssigen Bewegung ihre Haube ab, enthüllte kurzes graues Haar und setzte ihren Hals dem Wind aus. Rasch warf sie sich einen Schal aus paillettenbesetzter Wolle um die Schultern.
»Woher – den haben Sie geklaut!« Nona sah sich unter den Passanten um, die ja vielleicht ihren Zorn teilten, doch es waren nur wenige unterwegs, und die strebten mit gesenkten Köpfen ihren Zielen entgegen. »Eine Diebin und eine Lügnerin!«
»Meine Integrität ist mir kostbar.« Die Äbtissin lächelte. »Darum hat sie auch einen Preis.«
»Eine Diebin und Lügnerin.« Mit der würde sie definitiv nicht brav mitgehen.
»Und du, Kind, tust dich offenbar schwer damit, dass der Mann, für dessen Ermordung du hängen solltest, in Wirklichkeit noch lebt.« Äbtissin Glas wand einen Knoten in den Schal und zupfte ihn zurecht. »Vielleicht erzählst du mal, was in der Caltess passiert ist, und dann erkläre ich dir, wie Partnis Reeve das mit Raymel Tacsis höchstwahrscheinlich meinte.«
»Ich hab ihn getötet.« Die Äbtissin wollte eine Geschichte, aber Nona war wortkarg. Sie hatte so spät angefangen zu sprechen, dass sie von ihrer Mutter schon für dumm gehalten worden war, und noch heute hörte sie lieber zu.
»Wie denn? Und warum? Beschreib es mir.« Glas bog scharf ab und zog Nona in einen so schmalen Durchgang, dass die Nonne mit ein paar Pfund mehr auf den Hüften an beiden Wänden entlanggeschrammt wäre.
»Wir wurden in einem Käfig in die Caltess gebracht.« Nona dachte an die Fahrt zurück. Es waren drei Kinder auf dem Wagen gewesen, als Giljohn, der Kindersammler, bei ihrem Dorf haltgemacht hatte und Nona weggegeben worden war. Der graue Stephen hatte sie ihm übergeben. Alle hatten zugeschaut, wie Giljohn sie in den Holzkäfig zu den anderen sperrte. Die Dorfkinder, kleine wie große, hatten stumm geglotzt, die alten Frauen gezischelt, Mari Streams, die Freundin ihrer Mutter, hatte geweint und Martha Baker laut geschimpft. Als der Wagen fortrollte, waren Steine und Schlammklumpen hinterhergeflogen. »Das mochte ich nicht.«
Der Wagen war tage-, dann wochenlang dahingeruckelt. In zwei Monaten hatten sie fast tausend Meilen zurückgelegt, die meisten auf schmalen, gewundenen Straßen, immer im selben Gebiet hin und her. Die ganze Schneise hatten sie abgeklappert, immer in Nordsüdrichtung auf dem Schlingerkurs eines Säufers, so dicht am Eis, dass Nona manchmal die Wände sehen konnte, wie sie blau über den Bäumen aufstiegen. Der Wind erwies sich als einzige Konstante, zog ohne Freundlichkeit übers Land und kämmte es mit den Fingern eines Fremden, ein kalter Eindringling.
Tag um Tag lenkte Giljohn seinen Wagen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Weiler zu einsamer Hütte. Die weggegebenen Kinder waren dürr, manche kaum mehr als Haut und Knochen, da ihren Eltern der Willen oder das Geld fehlte, um sie zu ernähren. Giljohn bot zwei Mahlzeiten am Tag. Gerstensuppe mit Zwiebeln am Morgen, heiß und salzig, mit hartem Schwarzbrot zum Stippen. Am Abend gestampfte Rüben mit Butter. Seine Fahrgäste sahen mit jedem Tag besser aus.
»Da hab ich ja auf einer Metzgerschürze schon mehr Fleisch gesehen.« Das hatte Giljohn zu Saidas Eltern gesagt, als sie sie aus ihrer Hütte hinaus in den Regen brachten.
Der Vater, ein verlottertes Männlein, längst krumm und grau, zwickte Saida in den Arm. »Großes Mädchen für ihr Alter. Stark. Hat ’n Tick Gerant mit drin.«
Die Mutter, bleichgesichtig und klapperdürr, streckte wimmernd die Hand nach Saidas langem Haar aus, ließ den Arm jedoch kurz vor der Berührung sinken.
»Vier Pennys, und mein Maultier kann heute Nacht auf eurer Wiese grasen.« Giljohn war ständig am Feilschen. Er schien es aus Spaß an der Freude zu machen; eine fettere Börse als seine hatte Nona noch nie gesehen, bis zum Platzen gefüllt mit Pennys, Crowns und sogar einem glänzenden Sovereign, der eine neue Farbe in Nonas Leben brachte. Im Dorf hatte nur der graue Stephen überhaupt je Münzen. Und James Baker, als er damals all sein Brot an ein paar Händler verkaufte, die sich auf dem Weg nach Gentry verlaufen hatten. Aber Gold besaßen beide nie. Nicht mal Silber.
»Zehn, und Sie ziehen noch diese Stunde weiter«, entgegnete der Vater.
Innerhalb der erwähnten Zeitspanne kauerte Saida ebenfalls im Käfig, ihr helles Haar verschleierte das zum Boden gerichtete Gesicht. Der Wagen fuhr ohne Verzögerung los, um ein Mädchen schwerer und fünf Pennys leichter. Nona sah durch die Gitterstäbe, wie der Vater die Münzen immer wieder aufs Neue zählte, als könnten sie sich in seiner Hand vermehren, während seine Frau sich fest umschlungen hielt. Das Weinen der Mutter folgte ihnen bis zum Kreuzweg.
»Wie alt bist du?«, wollte Markus wissen, ein stämmiger dunkelhaariger Junge, der offenbar sehr stolz auf seine zehn Jahre war. Dieselbe Frage hatte er Nona bei ihrer Ankunft gestellt. Sie hatte neun gesagt, weil er ja anscheinend eine Zahl brauchte.
»Acht.« Saida schniefte und wischte sich mit einer schlammigen Hand die Nase.
»Acht? Beim Licht! Ich dachte, du wärst dreizehn!« Markus wirkte zugleich erleichtert, dass er noch der Älteste war, und empört über Saidas Körpergröße.
»Hat ja Gerant drinne«, meldete sich Chara, ein dunkles Mädchen mit so kurzem Haar, dass die Kopfhaut durchschimmerte.
Nona wusste nicht, was Gerant war, nur dass man groß wurde, wenn man es hatte.
Saida rutschte näher an Nona heran. Als Bauernmädchen wusste sie, dass man nicht über den Rädern saß, wenn man seine Zähne behalten wollte.
»Sitz bloß nicht neben der«, sagte Markus. »Auf der liegt ’n Fluch.«
»Die kam voller Blut rein«, sagte Chara. Die anderen nickten.
Markus lieferte das endgültige und vernichtende Urteil. »Für umsonst.«
Dagegen konnte Nona schlecht etwas sagen. Selbst Hessa mit ihrem verkrüppelten Bein hatte Giljohn einen abgesägten Penny gekostet. Sie zuckte die Achseln und zog die Knie vor die Brust.
Saida strich sich das Haar aus der Stirn, schniefte mächtig, warf einen kräftigen Arm um Nona und zog sie näher. Bestürzt leistete Nona Widerstand, doch gegen die Kraft der Größeren war nichts zu machen. So saßen sie beieinander, während der Wagen unter ihnen ruckelte und Saida weinte, und als das Mädchen sie schließlich losließ, standen auch Nona Tränen in den Augen, obwohl sie nicht hätte sagen können wieso.
Nona wusste, dass sie etwas sagen sollte, fand aber nicht die richtigen Worte. Die hatte sie vielleicht im Dorf zurückgelassen, bei ihrer Mutter auf dem Fußboden. Anstatt zu schweigen, sagte sie das, was sie bisher erst einmal ausgesprochen hatte – das, was ihr diesen Käfig eingebrockt hatte.
»Du bist meine Freundin.«
Die Große schniefte, wischte sich erneut die Nase, sah hoch, und hatte ein weißes Grinsen im verdreckten Gesicht.
Giljohn gab ihnen gut zu essen und beantwortete Fragen, jedenfalls wenn sie zum ersten Mal gestellt wurden – was darauf hinauslief, dass »Sind wir bald da?« und »Wie weit noch?« mit keiner anderen Antwort als dem Knarren der Räder belohnt wurden.
Der Käfig hatte zwei Funktionen, die Giljohn genau einmal erklärte, wobei er sein verwittertes Gesicht zu den Kindern umwandte und das Maultier Vierfuß seinen Weg allein finden ließ.
»Kinder sind wie Katzen, nur nicht so nützlich und ohne Fell. Der Käfig hält euren Haufen beisammen, sonst müsste ich euch ständig wieder einsammeln. Außerdem …« Er hob einen Finger zu der hellen Linie, die linksseitig Augenbraue, Augenhöhle und Wangenknochen teilte. »Ich bin ein Mann, der schnell aufbraust und lange hadert. Ärgert mich, und ich schlag zu, hiermit oder hiermit.« Er hielt zunächst die Rute hoch, mit der er Vierfuß antrieb, dann die schwielige Breite seiner Handfläche. »Anschließend bereue ich dann, dass ich mich gegen den Ahnen und meine Börse versündigt habe.« Er grinste, zeigte gelbe Zähne und dunkle Lücken. »Der Käfig bewahrt euch vor meiner Wut. Außer ihr ärgert mich so sehr, dass sie noch nicht verraucht ist, bis ich hinten bei der Tür ankomme.«
In den Käfig passten zwölf Kinder. Von den kleinen ein paar mehr. Giljohn setzte seinen Zickzackkurs westwärts die Schneise entlang fort, pfeifend bei schönem Wetter, geduckt und fluchend bei schlechtem.
»Ich mache Schluss, wenn meine Börse leer oder mein Wagen voll ist.« Das sagte er jedes Mal, wenn eine Neuerwerbung reinkam, weshalb sich Nona bald wünschte, er würde irgendein Goldkind finden, das von seinen Eltern geliebt wurde und ihn jede Münze kostete, die er besaß. Dann kämen sie vielleicht endlich in die Stadt.
Manchmal sahen sie Verity in der Ferne, seinen Rauch. Noch näher, und im Dunst über der Stadt waren Türme zu erahnen. Einmal kamen sie so dicht heran, dass Nona das Blutrot des Sonnenlichts auf den Brustwehren der Festungsanlage sah, die von den Kaisern um die Lade herum erbaut worden war. Weiter unten, im Windschatten einer Hochebene vor der Kälte versteckt, schob die Stadt ihre dicken Mauern ins Land. Doch Giljohn wendete, und die Stadt schrumpfte einmal mehr zu einem fernen Rauchfleck zusammen.
An einem kalten Tag, als die Sonne scharlachrot am halben Himmel stand und der Wind den Holzstäben mit seinen Fingern seltsame, hohle Klänge entlockte, erzählte Nona Saida leise von ihrer Hoffnung.
»Auf Schönheit kommt’s Giljohn nicht an«, schnaubte Saida. »Er sucht nach Erbgut.«
Nona blinzelte nur.
»Erbgut. Du weißt schon. Wo sich die Gabe zeigt.« Sie sah auf Nona hinab, die immer noch verständnislos große Augen machte. »Die vier Stämme?«
Nona hatte von den vier Stämmen gehört, die aus der Finsternis in die Welt gekommen waren und ihre Linien vermischt hatten, um Kinder hervorzubringen, die den Widrigkeiten ihrer neuen Heimat trotzen konnten. »Ma hat mich zur Kirche vom Licht mitgenommen. Die mochten es nicht, wenn man vom Ahnen sprach.«
Saida hob die Hände. »Also, es gab vier Stämme.« Sie zählte sie an den Fingern ab. »Gerant. Wenn du viel Gerantblut hast, wirst du so riesengroß wie sie früher.« Sie schlug sich auf die breite Brust. »Hunska. Die sind nicht so häufig.« Sie berührte Nonas Haar. »Hunskadunkel, hunskaschnell.« Als würde sie einen Reim zitieren. »Die anderen sind noch seltener. Marjool … und … und …«
»Quantal«, sagte Markus aus der Ecke. Er schnaubte und blies sich auf wie ein Alter. »Und es heißt Marjal, nicht Marjool.«
Saida funkelte ihn an, dann senkte sie die Stimme. »Die können zaubern.«
Nona berührte ihr Haar, wo Saidas Hand gelegen hatte. Die Kleinen im Dorf glaubten, die schwarzen Haare machten sie böse. »Wieso will Giljohn solche Kinder?«
»Um sie zu verkaufen.« Saida zuckte mit den Schultern. »Er weiß, nach welchen Anzeichen er gucken muss. Wenn er recht hat, kann er uns für mehr verkaufen, als er bezahlt hat. Ma meinte, dass ich schon Arbeit finde, wenn ich weiter wachse. Dass sie einem in der Stadt Fleisch zu essen geben und mit Münzen zahlen.« Sie seufzte. »Ich will da trotzdem nicht hin.«
Giljohn nahm Straßen, die ins Nichts führten, Feldwege, die so uneben und überwachsen waren, dass Vierfuß oft alle viere in den Boden stemmen und die Kinder mit anschieben mussten. Giljohn ließ dann Markus das Maultier führen – der konnte mit dem Biest umgehen. Die Kinder mochten Vierfuß, er stank zwar schlimmer als eine alte Decke und schnappte gern mal zu, aber er zog sie unermüdlich, und es konkurrierte ja nur Giljohn mit ihm um ihre Zuneigung. Am Tagesende schlugen sie sich immer richtig darum, wer ihm Rauhäpfel und Süßgras bringen durfte. Trotzdem liebte Vierfuß allein Giljohn, der ihn schlug, und Markus, der ihn zwischen den Augen kraulte und dabei den richtigen Unsinn murmelte.
Einmal regnete es tagelang, was das Leben im Käfig elend machte, obwohl Giljohn eine Plane über das Dach und die Windseite warf. Am schlimmsten war der Schlamm, ein kaltes und dickes Zeugs, das an den Rädern kleben blieb, so dass sie alle schieben mussten. Nona hasste den Schlamm: Da sie nicht so großgewachsen wie Saida war, fand sie sich oft schenkeltief in dem kalten und saugenden Morast wieder und musste von Giljohn gerettet werden, sobald der Wagen schmatzend auf festeren Grund kam. Jedes Mal krallte der Kindersammler die Faust in ihren Hanfkittel und zog sie unsanft heraus.
Kaum hatte er sie auf die Ladeklappe gesetzt, kratzte Nona sich den Schmodder ab.
»Was ist schon ein bisschen Schlamm an einem Bauernmädchen?«, wollte Giljohn wissen.
Nona funkelte ihn nur an und kratzte weiter. Sie hatte es noch nie ausstehen können, dreckig zu sein. Ihre Mutter meinte immer, sie würde wie eine Adelige essen, so peinlich genau führte sie jeden Happen zum Mund, um sich nicht zu beschmieren.
»Sie ist kein Bauernmädchen«, widersprach Saida an ihrer Stelle. »Nonas Ma flicht Körbe.«
Giljohn drehte sich auf dem Kutschbock um. »Jetzt ist sie gar nichts mehr, genau wie der Rest von euch, bis ich euch verkaufe. Nur lauter hungrige Mäuler.«
Straßen, die ins Nichts führten, brachten sie zu Leuten, die nichts hatten. Giljohn fragte nie nach Kindern, die zu verkaufen waren. Er fuhr bei jedem Hof vor, dessen Äcker mehr Unkraut und Steine als Getreide hervorbrachten, Gegenden, in denen sich die Ernte nur mit viel gutem Willen als »schlecht« bezeichnen ließ, weil das ja implizierte, dass sie auch hätte gut werden können. In solchen Gegenden hielt der Pachtbauer vielleicht seinen Pflug an oder legte seine Sense beiseite, um sich den Wagen an seiner Grundstücksgrenze einmal anzusehen.
Ein Mann, der eine Wagenladung Kinder umherfährt, braucht nicht zu sagen, womit er handelt. Ein Bauer, der bis auf die Knochen abgemagert ist und dessen Augen die Farbe von Hunger haben, braucht sich nicht zu erklären, wenn er zu einem solchen Mann hinübergeht. Unsere hässlichsten Geschäfte machen wir mit Hunger.
Hin und wieder ging ein Bauer diesen langen, langsamen Weg quer über sein Feld, von richtig nach falsch, stand da in seinem längst zu weiten Overall, kaute auf einem Getreidehalm, und in dem Schatten auf seinem Gesicht glitzerten die Augen. Bei solchen Gelegenheiten brauchte es nur ein paar Minuten, bis sich eine Reihe schmutziger Kinder aufstellte wie die Orgelpfeifen, von den Großen, die misstrauisch die Augen zusammenkniffen, bis zu den Kleinen, die in der einen Hand noch den Stock trugen, mit dem sie eben gespielt hatten, und mit der anderen ihre Lumpen zusammenhielten, die Augen groß und unschuldig.
Beim ersten Durchlauf pickte Giljohn jedes Kind heraus, das vielleicht einen Tropfen Gerantblut in sich trug. Wenn sie ihr eigenes Alter kannten, ging das schneller, aber selbst wenn sich die Jahre eines Kindes nur grob schätzen ließen, gab es hilfreiche Indizien. Oft sah er sich ihren Nacken an oder bog ihnen die Handgelenke um – nur bis sie das Gesicht verzogen. Diese Kinder stellte er beiseite. Beim zweiten Durchlauf sah er sich die Augen an, zog an den Winkeln und musterte das Weiße. Nona erinnerte sich noch an diese Griffe. Sie war sich vorgekommen wie eine Birne am Marktstand, die gedrückt, beschnuppert und wieder hingelegt wurde. Das Dorf hatte nichts für sie verlangt, dennoch hatte Giljohn sie seiner Prüfung unterzogen. Ein Platz in seinem Käfig und Mahlzeiten aus seinem Topf wollten verdient sein.
Bei den möglichen Hunskaträgern rieb der Kindersammler prüfend das Kopfhaar zwischen Finger und Daumen. War er dann noch neugierig, testete er ihre Flinkheit, indem er einen Stein hinter ein hochgehaltenes Tuch fallen ließ, den sie versuchen sollten zu fangen, wenn er unten wieder zum Vorschein kam. So gut wie keines der als Hunska eingestuften Kinder war wirklich flink: Giljohn meinte, sie würden da erst noch hineinwachsen oder durch Übung ihre Schnelligkeit entwickeln.
Nach Nonas Zählung machten sie ungefähr zehnmal Halt, bevor sie jemanden fanden, der bereit war, seine Söhne und Töchter für ein bisschen Kupfer herzugeben. Wenn Giljohn die Kinderreihen abging, bot er höchstens einmal in einem Dutzend Münzen an, und wenn, dann meist für ein übergroßes Kind. Und selbst von diesen wenigen, sagte er, würde kaum eines zu vollem Geranterbe heranwachsen.
Sobald Giljohn diese und alle sonstigen dunklen und überschnellen Kinder ausgewählt hatte, kehrte er für den dritten und langsamsten Durchgang zu der Reihe zurück. Nun musterte er die Kinder zwar mit Adleraugen, behielt die Hände jedoch bei sich. Stattdessen stellte er Fragen.
»Hast du letzte Nacht geträumt?«, fragte er vielleicht.
»Erzähl mal … Welche Farben siehst du im Brennmond?«
Und wenn sie ihm erzählten, der Mond sei immer rot, wenn sie sagten, dass man nicht in den Brennmond schauen könne, weil man davon blind werde, dann antwortete er: »Aber wenn du könntest, wenn er nicht rot wäre, welche Farben hätte er?«
»Was macht ein blaues Geräusch?« Diese Frage stellte er oft.
»Wie schmeckt Schmerz?«
»Kannst du die Bäume wachsen sehen?«
»Welche Geheimnisse bewahren die Steine?«
Und so weiter – manchmal wurde er ganz aufgeregt, manchmal tat er gelangweilt und gähnte in seine Hand. Das Ganze ein Spiel. Selten gewonnen. Und am Ende ging Giljohn immer runter auf Augenhöhe. »Schau auf meinen Finger«, sagte er dann. Und bewegte ihn in einer Linie abwärts, so nahe, dass sein Nagel ihnen fast die Nase schrammte. Die Linie wankte, zuckte, pulsierte, ruckte, nie zweimal dieselbe, doch immer ähnlich. Wonach er in ihren Augen suchte, wusste Nona nicht. Doch er schien es selten zu finden.
Zwei Plätze auf dem Wagen gingen an Kinder, die in dieser letzten Runde ausgewählt wurden, und jedes von ihnen kostete mehr als irgendeins der anderen. Aber auch nicht so richtig viel. Fragte man Giljohn nach Gold, spazierte er davon.
»Freund, ich mach das jetzt schon so lange, wie du deine Furchen ziehst, und wie viele, die ich weiterverkauft habe, sind unterm Bogen der Akademie durch?«, fragte er dann. »Vier. Gerade mal vier Vollblute … und trotzdem nennen sie mich den Magusfinder.«
In den langen Stunden zwischen einer Ecke von nirgendwo und der nächsten sahen die im Käfig durchgeschüttelten Kinder zu, wie die Welt vorbeizog, trostloses Moor zumeist, Felder wie Flicken oder grimmiger Wald, in dem Schraubkiefer und Frosteiche um die Sonne kämpften und kaum Licht für die Straße ließen. Meist sagte niemand etwas, denn auch das Geschnatter von Kindern lässt ohne Anregungen irgendwann nach, doch Hessa überraschte sie alle. Sie legte mit beiden Händen ihr verkümmertes Bein zurecht, lehnte sich gegen die Holzstäbe zurück und erzählte eine Geschichte nach der anderen, die Augen geschlossen, die Wangenknochen so groß, dass sie ihr etwas Fremdartiges verliehen. In dem ganzen müden Gesicht, das von strohblonden Ringellocken umkränzt war, bewegte sich nur ihr Mund. Die Geschichten, die sie erzählte, stahlen die Stunden und nahmen die Kinder auf viel weitere Reisen mit, als Vierfuß je hätte schaffen können. Sie hatte Geschichten von den Sgidgrol im Osten und ihrer Kriegerkönigin Adoma zu bieten, von Adomas Händel mit dem Schrecken, der unter dem Schwarzeis haust. Sie erzählte von den Durnen, die in ihren Krankholzbooten über die Marnsee zur Westküste des Reichs segelten. Von den großen Wellen, die sich wölbten, wenn im Süden die Eiswälle kalbten, und wie sie die Breite der Schneise hinauffegten und an die gefrorenen Klippen des Nordens wuschen, die nun ebenfalls barsten und neue Wellen zurücksandten. Hessa sprach vom Kaiser und seinen Schwestern, von ihrem Gezänk, das viele hohe Familien ruinierte, die das Pech hatten, zwischen die Fronten zu geraten. Sie erzählte von einstigen und heutigen Helden, von den Generälen der alten Zeit, die die Grenzlande hielten, von Admiral Scheer, der eintausend Schiffe verlor, von Noi-Guin, die Burgmauern mit dem Messer erkletterten, von Rotschwestern in ihren Kampfhäuten, von den Leismännern und ihren Giften …
Manchmal redete Hessa auf diesen langen Straßen zu Nona, in eine Ecke gekauert und mit leiser Stimme, und Nona konnte nicht sagen, ob sie dann eine Geschichte erzählte oder seltsame Wahrheiten.
»Du siehst ihn auch, Nona, oder?« Hessa beugte sich dicht heran, so dicht, dass ihr Atem Nona am Ohr kitzelte. »Den Pfad, die Linie? Er will, dass wir ihm folgen.«
»Ich sehe keinen –«
»Da drüben kann ich laufen. Hier haben sie mir die Krücke weggenommen und ich muss kriechen oder getragen werden … aber da … Ich kann so lange gehen, wie ich auf dem Pfad bleibe.« Nona spürte ihr Lächeln. Hessa richtete sich auf und lachte – selten bei ihr, sehr selten. Dann erzählte sie eine Geschichte für alle, Persus und der Verborgene Pfad, eine Legende aus ältester Zeit, und sogar Giljohn lehnte sich zurück und lauschte.
Und eines Tages, Wunder über Wunder, zwängte sich das zwölfte Kind in den Käfig, und Giljohn erklärte den Wagen für voll, den Einkauf für erledigt. Er bog nach Westen ab, lenkte Vierfuß auf den Weg nach Verity und fand bald eine breite, gepflasterte Straße, auf der vier Hufe doppelt so schnell Meilen machten.
Sie gelangten im Dunkeln und im Regen an. Nona sah von der Stadt nicht mehr als unzählige Lichter, zunächst ein Sternbild, das über dem schwarz drohenden großen Wall schwebte, und nach dem Durchqueren des gähnenden Tors eine Abfolge von Inseln, wo das wabernde Licht einer Laterne hier eine Tür anbot, dort eine Säulenreihe, wo in Mänteln versteckte Gestalten für einen kurzen Blick aus der blinden Nacht auftauchten und wieder verschwanden.
Breite Straßen und schmale, die sich wie Schluchten durch die halsverdrehende Höhe der Stadthäuser schnitten, brachten den Wagen schließlich zu einer großen, massiven Holztür. Darüber verkündeten eiserne Lettern einen Namen, doch die Umrisse als Buchstaben zu erkennen überstieg die Grenzen von Nonas Bildung.
»Die Caltess, Jungs und Mädchen.« Giljohn schob seine Kapuze zurück. »Freut euch auf Partnis Reeve.«
Giljohn hielt in dem Hof, der hinter den hohen Mauern wartete, und ließ sie aussteigen. Saida und Nona kletterten steif und wund vom Wagen. Vor ihnen ragte eine Halle mit vielen Fenstern auf, die dreimal so hoch war wie alle Gebäude, die Nona je gesehen hatte. Der Hof, in dessen Mitte Flammen aus einem Kohlebecken schlugen, war praktisch leer. In den Ecken wurden merkwürdige Gerätschaften gelagert, darunter mit Leder umwickelte Holzfiguren, die auf flachen Scheiben standen. Einige junge Männer saßen auf Bänken unter den Laternen und polierten Lederzeug, bis auf einen, der ein Netz flickte wie ein Fischer.
Partnis Reeve ließ die Kinder über eine Stunde lang aufgereiht stehen, bevor er aus seiner Halle trat. Lange genug, dass die Dämmerung in den Hof vordrang und Nona verblüfft feststellte, dass sie die ganze Nacht hindurch gefahren waren.