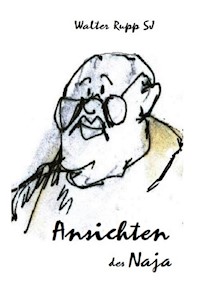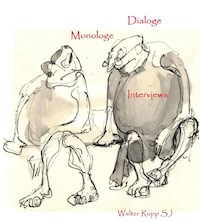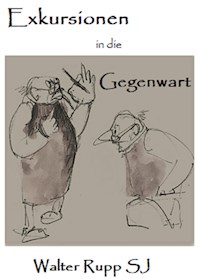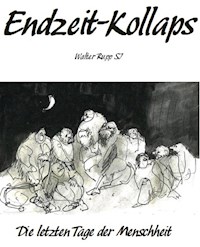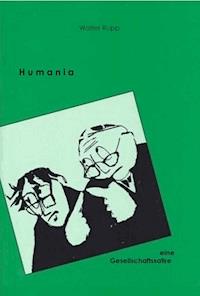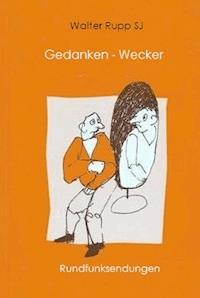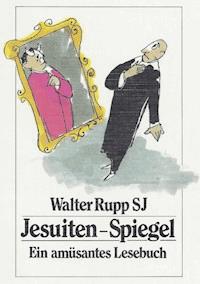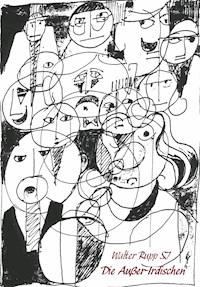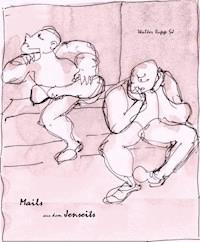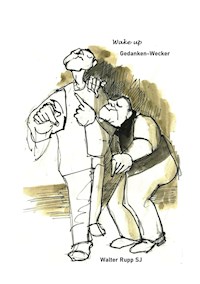
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Täglich werden wir vor immer neue Fragen gestellt, die wir oft ignorieren, weil sie oft unbequem sind, mit denen wir uns aber befassen sollten. Wir sind geneigt, uns den leicht beantwortbaren Fragen zuzuwenden oder versucht, die schon vorhandenen Antworten zu übernehmen. Diese Texte möchten den Leser reizen, Fragen aufzugreifen und weiter zu denken,
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Rupp
Wake up - Gedanken-Wecker
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Albertus Magnus
Altersweisheit
Annoncen
Atheismus
Die Außerirdischen
Außenwelt
Babeltürme
Begräbnisse
Begreifen
Bekehrung
Berühmtheit
Beweise
Biblische Geschichten
Bibelverständnis
Bildung
Bücher
Christlich
Dahinter stehen
Demokratie
Denken
Dichter
Dummköpfe
Dummheiten
Eigensinn
Erfahrung
Erfülltes Leben
Erfüllung
Erwartungen
Eschatologie
Erzählkunst
Fabel
Feuerbachs Appell
Nikolaus von Flüe
Fragen
Frauen und die Philosophen
Gedankenwege
Geschichte
Glauben /Glaubensbereitschaft
Glaube und Wissenschaft
Glaubensfrage
Gott
Gottesbilder
Gottsucher
Gruseln lernen
Gutes tun
Hektik
Hoffen
Human-Computer
Innenwelt
Jesus
Journale
Journalismus
Kinderuniversität
Konversion
Kreativität
Kreuz
Kritik
Kunstwerke
Lachen
Lautstärke
Lebensgestaltung
Lebenskunst
Lebenskünstler
Lebenszeit
Mitmenschen
Medium
Meinungen
Menschenkenntnis
Modern
Moral / Ende der Moral
Münchhausen
Muße
Mythen
Nachrichten
Nahrung
Narrengestalten
Die Narrheit und der Narr
Normal - verrückt
Optimismus
Das Paradies
Passionsspiele
Pädagogik
Persönlichkeit
Plagen der Kirche
Plagiieren
Poesie
Politik
Prometheus
Puzzle
Redekunst
Redenschreiber
Redner
Die Regierungen
Reisen
Rhetorik
Rolle
Ruhestand
Schauspieler
Das Schicksal
Schöpfungsgeschichte der Computer
Schriftsteller
Schule
Schwerelosigkeit
Zwei Seelen
Sinn-Frage
Sinne
Sprachverwirrung
Sterben
Der Stil
Streitkultur
Theologie
Theorie und Praxis
Tod
Träume
Tugend
Tugenden
Unbekannter Gott
Universum
Unterbewusstsein
Unvollendet
Überlieferung
Vergleiche
Vernunft
Vertrauensvorschuss
Wahrhaftigkeit
Wahrheit
Wahrheitsfindung
Die Welt
Weltbild
Welt-Gestaltung
Werbung
Werteschöpfer
Wissen
Der Witz
Wortschatz
Die Zeiten
Die Zeiten und die Zeit
Die Zweifel
Zukunft
Zwerge und Riesen
Gedanken über das Denken
Impressum neobooks
Albertus Magnus
Albertus Magnus, dieser einfache Mönch, der einmal im Unmut über die Unbeweglichkeit seines Geistes, seine Studien aufgeben wollte, wurde einer der bedeutendsten Gelehrten, die das Abendland je hervorgebracht hat. Er besaß in Wahrheit einen ungewöhnlich wachen Geist und trug entscheidend dazu bei, dass das Christentum die Werte, die in der heidnischen, arabischen und jüdischen Philosophie stecken, kennen und schätzen lernte. Es ist erstaunlich, von wie vielen verschiedenen Gebieten er, der sich von der Welt zurückgezogen hatte, etwas verstand: von Astronomie, Chemie, Physik und Klimatologie, von Mineralogie, Anthropologie, Zoologie und von Botanik. Kein Wunder, dass so viel Gelehrsamkeit das Misstrauen seiner Umwelt weckte, und man ihn wegen seines für seine Zeit erstaunlichen Wissens auf naturwissenschaftlichem Gebiet, der Zauberei verdächtigte. Dieser wohl vielseitigste und fruchtbarste Gelehrte des 13. Jahrhunderts, bezeichnete die Vernunft als die vornehmste Kraft des Menschen und die Erkenntnis Gottes als das höchste Ziel der Vernunft. Für ihn gab es diesen Unterschied zwischen Profanwissenschaften und Theologie, den man später gerne machte, nicht. Er war der Meinung, dass jede Wissenschaft zur die Erkenntnis Gottes beizutragen hat, nicht nur die Theologie. Während sich heute mancher - und oft gerade die, die nicht allzu tief in die Wissenschaften eingedrungen sind - sich mit Berufung auf die Wissenschaft von Gott entfernt, gab es zu allen Zeiten angesehene und bedeutende Gelehrte, die von sich bekannten, dass sie über die Wissenschaft den Weg zu Gott gefunden haben
Altersweisheit
Viele stellen sich die Altersweisheit vor wie eine plötzliche Erleuchtung, die eines Tages jeden überfällt, sobald er gebrechlich geworden ist. Sie erwarten, dass sie eines Morgens mit Einsichten überschüttet werden und mit dem beglückenden Gefühl erwachen, endlich ganz wach zu sein und endlich wirklich zu verstehen, was sie ein Leben lang nicht verstanden haben. Sie glauben, dass sie dann auf einmal über den Dingen stehen können, von denen sie bisher gefangen waren; dass sie dann die Menschen durchschauen und auf die Versuchungen, auf die sie immer hereingefallen sind, nicht mehr hereinfallen; dass sie dann wie Philosophen auf die tiefsten und letzten Fragen schauen und die Welt von einer höheren Warte aus betrachten. Aber leider nehmen mit dem Alter die körperlichen Gebrechen zu, die geistige Spannkraft nimmt ab und der geistige Aufschwung bleibt aus. Dann stellt man sich die Frage: was denn die Kennzeichen der Alters‑Weisheit sind? Ob sie über jeden kommt oder manchen übergeht?
Ob es Weisheit ist, wenn man schweigt, weil man nichts mehr zu sagen hat, und sich nicht mehr an das erinnern kann, an das man sich nicht gern erinnert; wenn man mit immer weniger Gedanken auskommt, ja wenn man sich für das nicht mehr interessiert, was einem einmal wichtig erschien. Vielleicht lässt sich die Altersweisheit nur mit denen ein, die sich schon vor ihrem Altwerden mit ihr eingelassen haben. Auch die Weisheit will nicht alt werden. Ja, sie hat kein Alter.
Annoncen
Als die Brüder Montgolfier 1783 zu ihrem ersten Ballonflug aufgestiegen waren und nach einer Höhe von 2000 Metern wieder wohlbehalten auf der Erde landen konnten, brachen die Zu in einen unbeschreiblichen Jubel aus und meinten: man werde bald auch noch das Mittel finden, mit dem man den Tod besiegen kann. Diese Erwartung: Die Wissenschaft werde bald eine Krankheit nach der anderen besiegen, vielleicht sogar den Tod, regt sich noch immer. Auch die Annoncen unserer Zeit erwecken den Eindruck, man könne jede Krankheit, ja sogar seelische Nöte mit pharmazeutischen Präparaten - zum Spottpreis von nur einigen Euro - wirksam und sofort vertreiben. Erfolglosigkeit, Minderwertigkeitskomplexe, Kontaktarmut, Hemmungen und Liebeskummer sind frappierend leicht zu heilen. Man nehme das von Dr. Kauz in langjähriger Erprobung und auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelte ‘Anti-Komplex’, ‘Anti-Depressiv’ oder das ‘Kontakt-Hormon K’, das schon so vielen - wie die überaus zahlreichen Zuschriften beweisen - aus ihrer verzweifelten Lage herausgeholfen hat. Aber solche Versprechen kann niemand halten.
Dieser Glaube, dass die Medizin irgendwann einmal jedes Gebrechen heilt und alle Krankheiten ausrottet, ist eine Illusion. Es wird ihr nie gelingen, die Menschen so gesund zu machen, dass sie bei voller Gesundheit sterben oder nicht mehr sterben müssen. Dann wären wir dazu verurteilt, immer hier, in einer Welt zu sein, sie könnte uns nicht auf Dauer glücklich machen.
Atheismus
Die Natur gibt jedem die Fähigkeit zu glauben mit. Den Unglauben muss man erwerben. Mancher schafft es mit Hilfe glaubensfeindlicher Lektüre, mancher durch seinen Umgang mit Nichtgläubigen, mancher durch sein Desinteresse an Theologie. Und mancher mit Berufung auf die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft war nie einer Meinung. Und wissenschaftliche Argumente, die den Glauben widerlegen, gibt es nicht. Bacon sagt: Ein wenig Wissenschaft entfernt, viel Wissenschaft führt zur Religion hin. Und Gilbert Keith Chesterton meint, gerade die Theologie sei das Element der Vernunft, das verhindert, dass Religion nur Gefühl ist.
Schopenhauer klammerte sich an die Behauptung: "Glauben und Wissen sind wie Wolf und Schaf in einem Käfig", der Glaube werde vom Wissen aufgefressen. Die Religion mindere die Denkfähigkeit. Nietzsche musste sich zeitlebens an dem Gott, den er für tot erklärt hatte, reiben.
Ganze Völker glaubten einmal statt an Gott, an das Goldene Kalb und verehrten es. Und mancher glaubt heute an den gelehrten Esel, den allwissenden Wissenschaftler, der auf jede Frage eine Antwort hat. Er hofft, dass eines Tages ein Sokrates auftritt, für den es Geheimnisse nicht gibt, der nicht mehr bekennen muss, dass er nichts weiß, sondern von sich sagen kann: Ich weiß, was man bisher nicht wusste.
Dichter möchten nur, dass ihr Kopf bis in den Himmel hineinragt. Aber mancher möchte diesen Himmel in seinen Kopf hineinzwängen und ist enttäuscht, dass ihm das nicht gelingt.
Die Außerirdischen
Ob es Außerirdische gibt, wurde eine viel diskutierte Frage. Mancher hält die Krater auf unserem Planeten für Zeugnisse außerirdischer Landungen und mancher meint, es sei höchste Zeit, sich auf eine Begegnung mit ihnen vorzubereiten. Sogar eine Astronomen-Konferenz in Green Bank (USA) endete mit der Feststellung: Es gibt keinen Grund, an der Existenz außerirdischen Lebens zu zweifeln, es könnte 100 oder gar 1000 intelligente Zivilisationen im Milchstraßensystem geben. Das ist allerdings nur eine Vermutung, ein gewagter Gedanken-Sprung, aber kein Beweis.
Was möglich ist, ist noch nicht wirklich. Die Menschen – vor allem die Intellektuellen unter ihnen - taten sich immer schwer, ihr Nichtwissen einzugestehen. Im Mittelalter erklärte man unerklärbare Erscheinungen, Naturereignisse, Missernten und vor allem Krankheiten kurzer Hand als Hexerei.
Die Theologen erlagen häufig der Versuchung, über das, was Gott verborgen hält, Auskunft zu erteilen und beschrieben oft das Jenseits, als wären sie schon einmal dort gewesen. Und manche Wissenschaftler unserer Zeit verhalten sich nicht anders: Wenn sie bei ihrem Forschen an Grenzen stoßen, beginnen sie über das, was sein könnte, zu spekulieren, um das Eingeständnis zu umgehen, sie wüssten etwas nicht. Sicher ist bis heute nur, dass es so manche Aliens auf unserer Erde gibt: Superstars und Promis, die sich den Erdlingen gegenüber überlegen fühlen und auftreten, als kämen sie von einem anderen Stern.
Außenwelt
Innenwelt und Außenwelt lassen sich nicht trennen. Es ist nicht möglich, das, was einen Menschen in seinem Innersten bewegt, auf Dauer zu verstecken. Innenwelt und Außenwelt durchdringen sich und stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. So wie das Auftreten, die Sprache, der Blick und die Gebärde verraten, wie es um einen Menschen steht: was er empfindet oder denkt, was ihn erfreut oder bedrückt, kann man aus dem äußeren Erscheinungsbild einer Gesellschaft ablesen, in welcher Verfassung sie sich befindet. Aus ihren nervösen Zuckungen, ihren Schweißausbrüchen, ihren Hustenanfällen oder ihrer Lethargie kann man schließen, welche Krisen und Probleme sie zu bestehen hat, und an welchen Krankheiten sie leidet.
Diese Wechselwirkung zwischen außen und innen ist so intensiv, dass sich die Grenzen oft vermischen und man beide oft nicht auseinanderzuhalten vermag. Wenn ein Leibniz die Welt optimistisch sah, als die beste aller Wellen, und ein Schopenhauer auf dieselbe Welt pessimistisch blickte und sie nur als die schlechteste aller Welten sehen konnte, ist der Verdacht naheliegend, dass sich da Außenwelt und Innenwelt vermischten. Es ist die Frage angebracht, wer da wen beeinflusst hat: ob eine düstere und eine freundliche Weltsicht die Seele düster und freundlich gestimmt hat, oder ob ein düsterer und freundlicher Seelenzustand Ursache für ihre Weltsicht war? Das Unbewusste kann die Weltsicht verklären oder trüben.
Babeltürme
Der Turmbau von Babel erwies sich als Fehlprojekt und musste abgebrochen werden. Dennoch ließ sich der Mensch zu keiner Zeit abhalten, weiter Babeltürme zu bauen, weil er sich von der Idee nicht lösen kann, aus eigener Kraft etwas Gigantisches zu schaffen. Noch immer errichtet er imponierende, in den Himmel ragende Tempel, vor deren Größe sich jeder Dom und jede Kathedrale ducken muss; Babeltürme, die er – wie einst - Marduk, dem Gott des Geldes weiht.
Aus unseren Banken und Versicherungen, die einmal zweckdienliche Geld-Aufbewahrungsstätten, Lagerhäuser für Wertpapiere waren, wurden Heiligtümer, zu denen die Menschen andächtig, mit einer religiösen Ehrfurcht wie zu Wallfahrtsorten pilgern und ihre Habe bringen: alles, wofür sie gelebt und geschuftet haben, und worauf sie ihre ganze Hoffnung setzen. Viele sorgen sich mehr als um das Credo, um ihr Guthaben, den Credit.
Ein Christ muss nicht den Diogenes im Fass zum Vorbild wählen, nicht die Wüstenväter der frühen Christenheit, auch nicht Franz von Assisi, der sich für die Armut entschied und das Erbe seines Vaters ausschlug. Sein Glaube verlangt nicht, dass er ohne Geld und Eigentum auskommt und irdische Güter verachtet. Aber er verbietet ihm die göttliche Verehrung. Geld ist nichts weiter als ein Zahlungs-Mittel, mit dem man sich was kaufen und sein Leben angenehmer gestalten kann. Wer es als Sinngeber des Lebens, als höchste Instanz verehrt, ja dafür sogar seine Gesundheit opfert, verehrt aus Kupfer und Papier gemachte Götter neben Gott, und das ist Götzendienst.
Begräbnisse
Der libanesisch-amerikanische Maler, Philosoph und Dichter, Khalil Gibran, dessen Denken immer um die zentralen Fragen des Lebens kreisten, um die Liebe und den Tod, schrieb einen Satz, in dem die Hoffnungen aller Gläubigen zusammen gefasst sind: „Möglicherweise ist ein Begräbnis unter den Menschen ein Hochzeitsfest unter Engeln.“
Aber wenn der Tod für die Gläubigen kein Ende, sondern – wie sie beteuern – nur ein Wandel und ein Neuanfang ist, dürften Begräbnisse keine Trauer auslösen, sondern müssten für Gläubige ein Anlass zur Freude sein, weil für sie das Weggehen von hier, ein Eintreten in eine bessere Welt bedeutet. Sie trauern, weil sie den Sarg, aber nicht die Engel sehen.
Viele trauern über den Verlust, weil sie von jetzt an ohne den Menschen auskommen müssen, der ihnen etwas bedeutete und den sie liebten. Oft mischen sich jedoch in die Trauer andere Gefühle ein: Enttäuschung, dass der Verstorbene dem oder denen sein Vermögen vermachte, die damit nicht das Rechte anzufangen wissen; das Unbehagen, dass der Verstorbene durch seinen Tod die Hinterbliebenen zwingt, an den eigenen Tod zu denken. Die meisten sind bei Begräbnissen zufrieden, dass sie noch nicht dran sind und noch nicht in die bessere Welt aufbrechen müssen, sondern noch etwas in der weniger guten Welt bleiben dürfen. Sie warten gern.
Begreifen
In den 'unfrisierten Gedanken' des polnischen Aphoristikers Stanislaw Lec steht der kluge Satz: "Die Menschen haben Spätzündung: sie begreifen alles erst in der nächsten Generation". Es wäre ein Fortschritt, würden die nachfolgenden Generationen aus den Fehlern ihrer Vorfahren lernen und diese nicht mehr wiederholen. Aber die Hoffnung, dass die Menschheit endlich einmal gut und vernünftig wird, wird sich wohl nie erfüllen. In allen Bereichen gibt es einen Fortschritt: in Wissenschaft und Technik, nur in der Moral scheint es einen Fortschritt nicht zu geben. Nachfolgende Generationen erheben sich gern über ihre Vorfahren und entrüsten sich über deren Fehlentscheidungen. Sie bilden sich oft ein, besser und klüger zu sein. Aber es kam noch keine Generation ohne Gewalt, ohne Streit und ohne Ungerechtigkeiten aus.
Die Geschichte lehrt, dass Unterdrückung oder Kriege immer ein Übel sind. Die Geschichte könnte - wie Indira Gandhi meint - die beste Lehrmeisterin sein, wenn die Schüler nicht so unaufmerksam wären. Es mag sein, dass viele neue Fehler gemacht werden, weil man die alten zu vermeiden sucht. Die meisten Fehler macht der Mensch jedoch, weil er sich weigert, Erfahrungen zu übernehmen und darauf besteht, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Er lässt sich die Überzeugung nicht nehmen: auch wenn andere mit ihren Untaten und ihrer Rücksichtslosigkeit nicht weiterkamen, er werde die negativen Folgen zu verhindern wissen. Er komme auch auf krummen Wegen zum Ziel.
Bekehrung
Bei den biblischen Bekehrungsgeschichten kann man den Eindruck gewinnen, Gott praktiziere das Mürbemachen, wenn er Menschen zur Umkehr bewegen will: er schüchterte die gottlosen Städte Sodom und Gomorrha so lange durch Drohungen ein, bis sie von ihrem sündigen Treiben abließen. Am Anfang vieler Bekehrungsgeschichten steht oft ein Ereignis, das eine Erschütterung auslöste: Bei dem gegen die Christen wütenden Saulus war es ein Blitzstrahl, bei Ignatius von Loyola eine Kanonenkugel, die sein Bein zerschmetterte, und bei Heinrich Heine eine Krankheit, die ihn drängte, seine Aussage vom Tode Gottes als töricht zu widerrufen. Aber ein Gott, der es darauf anlegte, seine Geschöpfe klein zu halten oder gar zu zerbrechen, wäre nicht souverän. Gott muss seine Überlegenheit nicht beweisen.
Die Bekehrungsgeschichten sagen mehr über den Menschen aus als über Gott, nämlich: dass ein Mensch immer erst zu einer Lebensänderung bereit ist, wenn er seine Ohnmacht erfährt oder vor einem Abgrund steht. Ohne Leidensdruck macht er nicht wirklich ernst. Paulus ging aus seinem Bekehrungserlebnis gestärkt hervor. Und der Dichter Paul Claudel bekennt in seinen Erinnerungen, dass mit seiner Hinwendung zum Glauben eine fruchtbare Schaffensperiode begann.
Das ist das Merkmal einer echten Bekehrung: sie endet nicht in einer Depression und lässt keinen seelisch gebrochenen Menschen zurück, sondern richtet auf und leitet eine neue, eine schöpferische Lebensphase ein.
Berühmtheit
Der Mensch ist voller Widersprüche: Er fühlt sich von der Masse angezogen und zugleich abgestoßen. Er hat das Verlangen, auch die beliebten Ausflugsziele aufzusuchen, auch das zu lesen, was man gelesen haben muss, auch das anzuziehen, was man gerade trägt und auch die heute üblichen Ansichten zu vertreten. Mancher möchte gar nicht anders als die anderen sein. Aber jeder spürt auch das Verlangen, sich von der Masse abzusetzen und nicht wie die anderen zu sein. Es regt sich in uns auch der Wunsch, Aufmerksamkeit zu erregen, überlegen und etwas Besonderes zu sein.
Mit der Berühmtheit ist das allerdings so eine Sache. Sie gleicht einer Lawine, meint Hermann Hesse, die der am heftigsten zu spüren bekommt, der darunter gerät. Sie engt seine Bewegungsfreiheit ein, weil man nun alles, was er redet oder tut, in die Öffentlichkeit zerrt. Wer im Mittelpunkt steht, lockt die Voyeure an, die nicht nur auf ihn schauen, wenn er öffentlich auftritt. Sie schauen auch über den Zaun in seinen Garten, und wenn er nicht im Garten sitzt, durch jedes Fenster, und wenn er die Gardinen nicht schnell genug zuzieht, sogar ins Schlafgemach hinein. Er ist der ständigen Beobachtung ausgesetzt.
Nicht weniger gefährlich sind seine Verehrer. Sie würden es ihm übel nehmen, wenn er sich nicht überlegen zeigen würde. Er ist deshalb versucht, sich nicht zu geben wie er ist, sondern wie sie, die Verehrer, das erwarten. Wer sich auf ein Podest stellen lässt, verliert seinen Bewegungsspielraum. Will er seine Freiheit zurückgewinnen, muss er vom Podest herunter springen.
Die Masse will Ikonen: sie will anbeten. Aber Anbetung tut keinem gut, nicht einmal einem Heiligen. Der darf sich jedenfalls Verehrung erst gefallen lassen, wenn er längst gestorben ist.
Beweise
Beweise stehen in hohem Ansehen, aber man kann damit nur selten überzeugen. Wer lässt sich durch das Argument, dass die Welt nicht aus dem Nichts entstanden sein kann, vom Dasein Gottes überzeugen? Und welcher Süchtige gibt seine Sucht auf, obwohl er weiß, dass Drogen der Gesundheit schaden? Argumente sind oft ohnmächtig, weil sich der Mensch lieber von seinen Gefühlen leiten lässt und nicht vom Verstand.
Auch ein Nichtschwimmer weiß, dass Wasser trägt. Er sieht es ja an den Schwimmern. Aber was hindert ihn, dass auch er sich aufs Wasser legt? Es ist gewiss nicht der Zweifel an den Naturgesetzen, der ihn davon abhält, sondern eine irrationale Angst, dass das, was möglich ist, ihm nicht gelingt. Er misstraut sich selbst, ob er das, was andere können, auch kann.
Wenn sich mancher auf die Forderungen der Bergpredigt nicht einlässt, dann stehen dem keine Vernunftgründe entgegen. Die Vernunft weiß sehr wohl: wenn alle bereit wären, ihre Habe mit anderen zu teilen, keine Gewalt anwenden und Feinden verzeihen würden, hätten wir eine bessere Welt. Sein Gefühl sperrt sich dagegen. Er fühlt sich überfordert, er komme dann vielleicht zu kurz und werde an die Wand gedrängt.
Entscheidend ist nur selten, was der Kopf denkt, sondern das, was das Gefühl empfindet. Gegen die Gedanken, die ein Hirn ausbrütet, lassen sich immer Argumenten finden. Die Ängste und Bedenken aber, die im Unterbewusstsein sitzen und sich tief in die Seele eingegraben haben, lassen sich nur schwer vertreiben. Auf die von der Bergpredigt geforderte Lebensweise wird sich nur der einlassen, der die Angst überwinden kann, er sei dem nicht gewachsen.
Biblische Geschichten
Die Bibel erzählt viele Geschichten nicht zu Ende. Wir wüssten gern, wohin Adam nach seiner Vertreibung ging, und wie Eva mit ihren Schuldgefühlen fertig wurde? Was aus Salome wurde? Ließ Herodes sie - damit sie nicht wieder einen Kopf verlangt - bei Gelagen nie mehr tanzen? Ja, welcher Mann hatte den Mut, mit dieser Frau, die so etwas verlangt, die Ehe einzugehen? Ging die Samariterin, die im Laufe ihres Lebens fünf Männer hatte und doch keinen, nach dem Gespräch mit Jesus noch eine Ehe mit einem dieser Männer ein oder lebte sie mit einem sechsten Mann zusammen? Wann traute Nikodemus sich nicht nur nachts, sondern auch am hellen Tag, Jesus aufzusuchen? Zweifelte Thomas nie wieder, oder äußerte er neue Zweifel: “Wenn ich nicht sehe, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommt, glaube ich nicht“? Wie viele ungerechte Urteile fällte Pilatus noch? Oder quittierte er aus Reue über seine Fehlentscheidung seinen Dienst? Ließ sich der Hauptmann, der unter dem Kreuz ausgerufen hatte: “Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn!“, bald danach taufen? Und wie lange verbreiteten die Wächter, die das Grab Jesu bewacht hatten, die Lüge, sein Leichnam sei gestohlen worden, während sie schliefen?
Der Evangelist Johannes erklärt am Ende seines Evangeliums: "Vieles wurde nicht aufgeschrieben, die Welt könnte die Bücher nicht fassen" - Aufgeschrieben wurde nur, was für die Beziehung zu Gott und für die Lebens-Gestaltung wichtig ist, nicht aber, was nur der Befriedigung unserer Neugier dient.
Bibelverständnis
Jahrhunderte ging man von der naiven Vorstellung aus, die Erschaffung der Welt sei wie ein Protokoll von einem, der dabei war, aufgezeichnet worden. So errechnete der angelsächsische Benediktinermönch Beda Venerabilis (673-735) aus den Angaben der hebräischen und lateinischen Bibel - das Datum der Erschaffung auf den 18. März3952 vor Christus. Noch 1583 legte der protestantische Humanist Justus Scaliger, der von Papst Gregor XIII. mit der Erstellung einer zuverlässigen Chronologie beauftragt worden war, das Schöpfungsdatum auf das Jahr 3950 fest, und der anglikanische Theologe James Ussher datierte 1650 die Schöpfung der Welt auf das Jahr 4004 vor Christus.