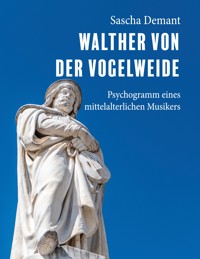
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der wissenschaftlichen Abhandlung über das Leben von Walther von der Vogelweide legt Sascha Demant den Wirkungskontext des Dichters im Mittelalter vor. Anhand vieler Stücke aus der Feder des mittelalterlichen Minnesängers rekonstruiert der Autor die Lebensstationen, Ziele, Wünsche, Fantasien und Psyche des Künstlers, der stets danach trachtete, als Minnesänger fest an den Wiener Hof zu kommen, um sich vom Leben eines Fahrenden verabschieden zu können. Auch wenn er begabter war als viele seiner Mitstreiter, war ihm ein Aufstieg in die höheren Kreise nicht vergönnt. Demant zeichnet die Auswirkungen dieser Umstände auf das Leben und Schaffen Walthers von der Vogelweide chronologisch und unter Einbezug zahlreicher Quellen nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Prolog
1.1 Die Quellen
1.1.1 Der Begriff Musiker und Künstler für Walther von der Vogelweide
1.2 Der Begriff Psychogramm in Bezug auf Walther von der Vogelweide
2. Der Lebensweg
2.1 Die Jahre von etwa 1170 bis 1198: Kindheit und Ausbildung zum Musiker in Österreich, die Abstammung und die Herkunft von Walther von der Vogelweide
2.1.1 Die gesellschaftliche Anerkennung durch den Adel und der Name von der Vogelweide
2.2 Bis zum Jahr 1198: der Minnesänger in Wien, die Frau in der Minne
2.3 Ab 1198: Weggang aus Wien, Einführung des Spruchgesangs, der Hof von Phillip von Schwaben
2.3.1 Der Musiker und sein Publikum Stichwort: Politik und Reichslage bzw. Zeitkritik
2.4 1199–1201: mit Phillip in Magdeburg, der Zorn gegen das politische Agieren der hohen geistlichen Würdenträger
2.4.1 Der Musiker bringt seinen Zorn unter, Thema Geistlichkeit
2.5 Das Jahr 1201: Weggang von Phillip, das Gönnerproblem und die Armut, Neuanfang bei Hermann I. von Thüringen
2.5.1 Der Musiker und die Armut
2.6 Ab 1201: Am Hof Hermann I. von Thüringen, die Zustände dort, der Ethiker
2.6.1 Walther von der Vogelweide, der Ethiker
2.7 Das Jahr 1203: im Gefolge Wolfgers von Erla, die einzige schriftliche Erwähnung von Walther von der Vogelweide, sein Status als Fahrender bzw. Nichtadliger, Wien als Ziel
2.7.1 Walther von der Vogelweide, der Fahrende, seine Stellung innerhalb der Spielmänner
2.8 Ab 1204/1205: Zurück in Thüringen beim Landgrafen, Auseinandersetzung mit Gerhard Atze, Abrechnung in der Kunst, Leben auf der Straße, wieder Wien als Ziel der Festanstellung, von der Sublimierung zum Selbstbewusstsein in der Kunst
2.8.1 Der Musiker nutzt seine Kunst zur Abrechnung
2.8.2 Der Musiker sucht eine „Festanstellung“ und Heimat
2.8.3 Der Musiker schreibt über zwischenmenschliche Beziehungen, die Sublimierung in der Kunst: Liebe und Freundschaft
2.8.4 Er ist selbstbewusst
2.9 1212 bis 1213: am Hof Ottos IV., in Begleitung von Dietrich von Meißen, Weißensee in Thüringen, vom Zorn gegen die Geistlichkeit bis zum Spiel mit dem Publikum, Aufritte außerhalb des Hofs
2.9.1 Der Musiker und sein Publikum, Walther von der Vogelweide nutzt das Spiel mit dem Publikum
2.10 Zwischen 1213/1214–1217: Abkehr von Otto IV., Hinwendung zu Friedrich II., weitere Wanderschaft nach Thüringen, Wien und Kärnten, die Konkurrenz und das Plagiat
2.10.1 Der Musiker und die Konkurrenz
2.11 Die Jahre 1216/1217 bis 1219: wieder Wien, das Ständeproblem und häufige Aneckung bei den Auftraggebern
2.11.1 Das Problem der festen Ständeordnung
2.11.2 Walther von der Vogelweide und die höfische Gesellschaft, er eckt an
2.12 Die Jahre Ende 1219/1220: wieder zurück bei Friedrich II., in Frankfurt, er bekommt sein Lehen, die Wanderschaft geht trotzdem weiter, jetzt Montabaur (Taunus), der andere Spielmann
2.13 Die Jahre ab 1224/1225: bei Erzbischof Engelbrecht von Köln, in Nürnberg, diesmal gewaltsamer Verlust des Gönners, die Einstellung für den Kreuzzug
2.13.1 Der Musiker und sein Publikum, Thema Kreuzzug
2.14 Die Jahre 1227/1228: Festhalten an Friedrich II., ungebrochener Zorn gegen Rom, das fragliche Schauspiel beim Vortrag, bei Heinrich VII.
2.14.1 Der Musiker setzt Rollen ein, um sein Thema anschaulich zu machen, das Schauspiel in der Musik
2.15 Die Jahre ab Ende 1227/1228: der alternde Musiker, weiter am Hof Heinrichs VII., Stereotyp Künstler?, die Kreativität
2.15.1 Resümee des Charakters, Walther von der Vogelweide als Stereotyp Künstler?
2.15.2 Ein weiterer Punkt im musikalischen Schaffen: die Kreativität
2.16 Um das Jahr 1230: Tod, Grab in Würzburg
3. Epilog
4. Die QR-Codes zu den Rekonstruktionen
5. Literaturverzeichnis
5.1 Primärquellen
5.2 Sekundärquellen
5.3 Internetquellen
2. Der Lebensweg
2.1 Die Jahre von etwa 1170 bis 1198: Kindheit und Ausbildung zum Musiker in Österreich, die Abstammung und die Herkunft von Walther von der Vogelweide
Für Walther von der Vogelweide lässt sich eine Rekonstruktion des Lebens nur in Umrissen zeichnen, weil eine enge Biografie fehlt. Innerhalb seiner Spruchdichtung bringt er jedoch seine Person ein, wodurch sich ungefähre Daten ermitteln lassen.55 Leider beginnt seine Spruchdichtung erst mit seinen Wanderjahren. Dadurch ist vom Lebensbeginn wenig bis gar nichts bekannt.
Seine Kindheit und Jugend verbrachte er im heutigen Gebiet von Österreich, Geburtstort und Geburtslandschaft sind umstritten56 und boten immer wieder Platz für Spekulationen.57 Darauf kann hier nicht näher eingegangen werden, weil kein Ansatz zu befriedigenden Ergebnissen geführt hat. Auch die Herkunft seines Namens ist unbekannt. Dazu noch mehr später im Text, nur eins vorweg: eine Vogelweide konnte bisher nicht ausgemacht werden (ausführlicher unter: Walther Vogelweide und sein Name).58
Geboren wurde er wohl nach 1170, ab 1190 war er als Sänger tätig.59 In Österreich erlernte er das Handwerk des Dichters und Sängers:60
„In Österreich lernte ich singen und sagen, / dort will ich mich zuerst beklagen.“
„ze Oesterrîche lernde ich singen unde sagen, / dâ will ich mich allerêrst beklagen.“61
Eine Ausbildung zum Musiker gab es schon im Hochmittelalter. Dazu gehörten auch profane Musik62 und das „Töne finden“63. Dies ist nur eine vage Umschreibung, weil es keine Quellen zu Art und Dauer der Ausbildung gibt.64 Zusätzlich kann für Walther von der Vogelweide von einer klerikalen Ausbildung ausgegangen werden,65 bei der auch die antike Lehrmeinung vermittelt wurde:66
„Ich trabe einher, wie es sich gehört, mit drei Arten von Sangesweisen, / der hohen und der niederen und der mittleren, / so daß mir die Kunstkenner für jede Danke sagen mögen.“
„Ich drabe dâ her vil rehte drîer slahte sanc: / den hôhen und den nidern und den mittelswanc, / daz mir die rederîchen iegeslîche sagen danc.“67
Den Titel „Meister“ konnte man durch Können und Ansehen erwerben.68 Der Begriff kommt erst langsam im 13. Jahrhundert auf und dient zur Abgrenzung von Könner und Stümper und zeigt das Vorhandensein von Gelehrsamkeit und Fachkundigkeit.69 Einzelne Berichte von Zeitgenossen erschließen das Können von Walther von der Vogelweide, so Ulrich von Singenberg (1175/1185–1230/1235):
„min meister claget sô sére von der vogelweide“70
Oder Gottfried von Straßburg71 über Walther von der Vogelweide:
„Ihrer aller Meisterin kann es, / die von der Vogelweide. / Ei, wie die über die Heide / hinschallt mit ihrer lauten Stimme!72 /
Welche Wunder sie vollbringt! / Wie kunstreich sie musiziert! / Wie sie ihren Gesang variiert – […] / Sie ist Hofmeisterin an diesem Hofe. / Sie soll alle Nachtigallen anführen.“73
„ir meisterinne kan ez wol, / diu von der Vogelweide. / hî wie diu über heide / mit hôher stimme schellet! / waz wunders sî stellet! / wie spaehe s’organieret! / wie s’ir sanc wandelieret – […] / diust dâ ze hove kameraerîn. / diu sol ir leitaerinne sîn!“74
Die Instrumente eines Minnesängers. Rekonstruktion der Fidel mit Bogen nach zeitgenössischen Abbildungen und archäologischen Funden. Die Harfe wurde aus der Vizelingeschichte entnommen. Für alle Rekonstruktionen siehe: Exkurs 2
Über die Person Walther von der Vogelweide lässt sich demzufolge nur sagen, dass er geachtet und sein Können geschätzt wurde.75 Weiteres, z. B. über seine Jugend oder sein Aussehen, erwähnen die Zeitgenossen nichts. Er selbst berichtet ebenfalls wenig von seinem Aussehen, macht nur unscheinbare Angaben, wie:
„Ich bin verschlafen wie Esau, / mein glattes Haar ist mir struppig geworden.“
„Ich bin verlegen als Êsaû, / mîn sléht hâr ist mir worden rû.“76
oder:
„Ich bin nicht der schönste aller Männer, / das ist nicht zu leugnen.“
„ich bin aller manne schœnest niht, / daz ist âne lougen.“77
Die Nachwelt wiederum wurde durch die Miniaturen geprägt, die sein vermeintliches Aussehen suggerieren. Allen voran ist die Große Heidelberger Liederhandschrift oder Codex Manesse zu nennen.78 Sie entstand zwischen 1300 und 1340, also weit nach der Lebenszeit von Walther von der Vogelweide. Die manessische Handschrift zeigt kein Porträt von ihm, auch ist die Pose aus der Tradition übernommen.79 Adlige Attribute, wie Helm und Schwert, sind ihm erst von späteren Generationen zugeschrieben worden, die ihm dem Stand des Adels zurechneten.80 Von einer adligen Herkunft spricht aber weder er selbst noch seine Zeitgenossen, die ihn unspezifisch „Herr“ nannten:
„Herr Vogelweide hat vom Braten gesungen81. / Dieser Braten hier war dick und lang, / seine Dame, der er so gewogen war, / wäre satt davon geworden.“
„her Vogelweide von brâten sanc: / dirre brâte was dicke und lanc; / ez hete sîn vrouwe dran genuoc, / der er sô holdez herze ie truoc.“82
Das mittelhochdeutsche „her“ ist keine Statusbezeichnung, auch ist die Bezeichnung „von der Vogelweide“ wahrscheinlich nicht adelig.83 Wolfram von Eschenbachs bissige Bemerkung verdeutlicht den Status von Walther von der Vogelweide, vor allem, wenn man bedenkt, dass von Eschenbach der ausgewiesene Ritter ist und dies auch selbst bezeugt.84 Ein anderer Adliger zur Zeit von der Vogelweides, Ulrich von Singenberg, bestätigt von Eschenbach. Auch er sendet parodistische Spitzen gegen Walther von der Vogelweide in seiner literarischen Überlieferung, die dessen Standesansprüche infrage stellen.85 Ganz im Gegensatz zu den zeitgenössischen Epikern nennt von der Vogelweide seine adlige Herkunft nicht, sodass sie als unwahrscheinlich gelten kann. Auch sonst wird der Unterschied zwischen von Eschenbach und von der Vogelweide sichtbar.86 Postuliert wurde für Walther von der Vogelweide eine Position in der Aufsteigerschicht der Ministerialen, was sich ebenfalls nicht beweisen lässt.87 Dazu Hahn: „Minnesang scheint eher als globales Symbol höfischer Kultur (denn als ‚sozialpsychologisches Protokoll‘ einer inferioren Sondergruppe) an die großen deutschen Höfe übernommen zu sein, im Interesse, auf Veranlassung, sogar unter produktiver Mitwirkung von deren Rangspitzen.“88
Sein weiterer Lebensweg zeigt aber, dass er immer versuchte, die Anerkennung des Adels zu erlangen.89 Es ist die Gesellschaft, zu der er gehören wollte, worauf auch die Rekonstruktion eingeht. Als Person des öffentlichen Lebens90 musste er auf sein Aussehen achten, durfte aber, durch die mittelalterlichen Kleidervorschriften, nicht übertreiben.91 Er konnte sich auch nicht auf die Stufe der Bauern stellen und musste dies auch äußerlich bekunden. Weder durfte der Ehrgeiz durchschimmern noch sollte man sich selbst als Tagelöhner degradieren.92 Beides konnte den Spott des Publikums und der Mitmusiker hervorrufen.93 Letztere trugen den Spott in ihrer Dichtung weiter.
Kleidung greift noch viel tiefer. Sie zeigt die Gesinnung. Schafft man es hierbei, die goldene Mitte, das mittlere Maß zu treffen?94 Eine Einstellung, die bei Walther von der Vogelweide nicht unwichtig ist (siehe: Walther von der Vogelweide – der Ethiker, die Mâze). Ein etwas konservativerer Kompromiss in Kleidungsfragen sind da die schlichteren Farben Blau und Schwarz, die man auch am Hof duldete.95 Sie könnten seine Wahl gewesen sein, weil er gern die Mitte traf und meist eher konservativ in der Einstellung zum Leben war. Insofern lässt sich dem Codex Manesse trauen.
Die Rekonstruktion ist spekulativ, was seine Kleidung betrifft. Anders verhält es sich bei seinem Status als Sänger und Künstler. Wie im Prolog beschrieben, wird bei Walther von der Vogelweide von einer Künstlerpersönlichkeit ausgegangen, was durch seine Zeitgenossen (siehe Gottfried von Straßburg) und von ihm selbst bestätigt wird. Er spricht von sich selbst als Künstler96 und schreibt für die Kunstkenner.97 Er gleicht modernen Dichtern, deren Position ihnen selbst bewusst ist.98
Eine Rekonstruktion der Person Walther von der Vogelweide in möglicher Kleidung. Seine Kleidung wird durch seine Einstellung dem Hof bzw. der adligen Lebenswelt im 13. Jahrhundert gegenüber im Allgemeinen rekonstruiert. Seine Körpergröße betrug wahrscheinlich etwa 1,67 m.99 Für die Rekonstruktion siehe: Exkurs 1
Die Kunstform Minnesang hat das Interesse von Walther von der Vogelweide entfacht100 und ihn sein Leben lang begleitet.101 Hier kann er Individuelles sowie Persönliches ausdrücken und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Publikums bekommen, weil die Kunstform Minnesang dem Zeitgeschmack entsprach.102
Den Minnesang muss er in Österreich erlernt und lieben gelernt haben. Vorbilder sind nach der Forschung z. B. Heinrich von Mohrungen103 und Reinmar der Alte104. Letzterer war jedenfalls anfangs die Identifizierungsfigur,105 weil er am österreichischen Hof willkommen war,106 wodurch von der Vogelweide in seiner Frühphase sah, womit man es am Hof schaffen konnte.107 Er zollte Reinmar dem Alten Anerkennung für dessen Kunst, schrieb darüber aber erst nach dessen Tod:
„Wahrlich, Reinmar, Du machst mich traurig – / […] ich klage um Deine edle Kunst; – daß sie / dahingegangen ist. / Du wußtest die Freude der ganzen Welt zu mehren, / […] Ich traure um Deinen wohlberedten Mund und / Deinen wahrlich lieblichen Gesang.“
„Dêst wâr, Reinmâr, dû riuwest mich / […] ich klage dîn edelen kunst, daz si ist verdorben. / dû kundest al der werlte fröide mêren, / […] mich riuwet dîn wol redender munt und dîn vil / süezer sanc.“108
Walther von der Vogelweide entwickelte sich weiter,109 nachdem der noch junge Künstler gesehen hatte, wie man zum Hofdichter werden konnte.110 Grundlage war für ihn seine gelebte Kunst und was man durch sie erreichen konnte – ein Emporsteigen am Hof:
„Reinmar, wieviel erlesene Kunst geht mit Dir dahin! / Du solltest zu Recht immer dafür gerühmt werden.“
„Reinmâr, waz guoter kunst an dir verdirbet! / dû solt von schulden iemer des geniezen.“111
2.1.1 Die gesellschaftliche Anerkennung durch den Adel und der Name von der Vogelweide
Die gesellschaftliche Anerkennung112 zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Leben und Werk von Walther von der Vogelweide.113 Sie wird hier deswegen als erstes Charakteristikum genannt, weil sie eine Hauptantriebsfeder des Musikers sein kann und dessen persönliche Leitlinie anzeigt.114 Die Anerkennung vonseiten des Adels war sein Lebensziel, sowohl in finanzieller Hinsicht115 als auch in der Ständehierarchie. Hier wollte und musste der Musiker Erfolg ernten.116 Sein ständiges Bemühen in dieser Richtung und vor allem sein Scheitern ist immer wieder Quelle für seine Kunst.117 Man liest bei ihm sehr schnell, dass eine menschliche Lücke gefüllt werden sollte oder, anders gesagt: Es „ist der wunde Punkt Walthers, um den fast alle direkten Interaktionen mit dem Publikum kreisen“118. Seine Kunst orientierte sich häufig an Themen, die zum adligen Allgemeingut gehörten.119 Er fragte sich: Womit kann ich bei Hof Eindruck hinterlassen?120 Am Aufstieg in der Gesellschaft arbeitete er lebenslang, was er später im Erhalt seines Lehens ausdrückt. In seiner Liedlyrik lässt er durchklingen, dass er sich der höfischen Gesellschaft zugehörig fühlt:121
„Wenn ich mich selbst rühmen darf, / so bin ich insoweit ein höfisch gebildeter Mann, / als ich so manche Unziemlichkeit ertrage, / obwohl ich sie ahnden kann.“
„Ob ich mich selben rüemen sol, / sô bin ich des ein hövescher man, / daz ich sô mánige unfúoge dol, / sô wol als ichz gerechen kan.“122
Weit höher war dabei der Respekt, die Achtung seiner Person gegenüber zu sehen, noch vor der finanziellen Absicherung:123
„Besitz war immer genehm, jedoch kam die Ehre / vor dem Besitz.“ „guot was ie genæme, iedóch sô gie diu êre / vor dem guote.“124
Er wollte einen gesellschaftlichen Aufstieg, eine „Aufnahme unter die hovewerden“125. Im Mittelalter ein Begriff, der mit einem gewissen Lebensstil und Selbstbewusstsein verbunden ist. Die hövescheit zeigt den Grad der Bildung des gesitteten Wesens an, die Oberschicht nahm ihn nur für sich in Anspruch.126 Eine Art Benimmregel, Erkennungsmerkmal und Statussymbol für den Adel. Wer ihn hat, ist oben angekommen, jedenfalls in den Augen von Walther von der Vogelweide. Die Hoftauglichkeit konnte er durch seine Kunst vollziehen, indem er die Hövescheit lobpreist und auch für sich reklamiert. Dann bedeutet auch im Mittelalter: Wer Erfolg in der Kunst hat, hat Erfolg im Leben.127 Walther von der Vogelweide erreichte es aber nur teilweise, z. B. in Bezug auf den Bekanntheitsgrad, weil die Gesellschaft noch nicht bereit war.128 Er blieb weiter ein Fahrender. Gleichgesetzt mit dem Handwerker,129 versuchte er, eine Bestätigung für seine Kunst zu finden, trotz der Hindernisse. Sein Können sollte der Schlüssel sein.130
Es war sein Ziel im Leben.131 Die Grundlage seines Strebens, sein Hauptanliegen und der Dirigent für alle Entscheidungen im Leben.132 Es setzte die Energie frei, die alle anderen Charakterzüge mitbestimmte,133 für sein lebenslanges Streben. Er wollte ein Aufsteiger sein, vom Adel auf Augenhöhe gesehen werden, den Weg von unten nach oben schaffen.134 Er formulierte seine Ziele auch selbst:
„Drei schwierige Ziele habe ich ins Auge gefaßt, / könnte ich eines davon erreichen, / so stünde es gut um meine Angelegenheiten. / […] Gottes Gnade und die Minne meiner Dame, um die bemühe ich mich, daß ich sie gewinne. / Das dritte hat sich meiner zu Unrecht manchen Tag / erwehrt: / das ist der freudenreiche Hof zu Wien. / Ich werde nimmer ruhen, bis ich den verdiene, / da er so vieler Tugenden mit so großer Beständigkeit/pflegte.“
„Drîe sorge hab ich mir genomen, / möht ich der einer zende komen, / sô wære wol getân ze mînen dingen, / […] gotes hulde und mîner frouwen minne, / dar úmbe sorge ich, wie ich die gewinne. / daz dritte hât sich mîn erwert unrehte manigen tac: / daz ist der wünneclîche hof ze Wiene. / in gehirme niemer unz ich den verdiene, / sît ér sô maniger tugende mit sô stæter triuwe pflac.“135
Deswegen übernimmt er viele Tugenden des Adels als seine Wesenszüge, es ist seine „soziale Stellungnahme“136 zum Aufstieg auf der sozialen hochmittelalterlichen Leiter137. Sein Beruf Sänger ist dieser Aufnahme nicht ganz abträglich. Er kann den gleichen Status einfordern wie Gelehrte oder Adlige:138
„Außer daß ich über ein wenig Kunstfertigkeit verfüge, / ist meine Schönheit ein Nichts. / Kunstfertigkeit besitze ich nicht viel, / doch ist sie sehr anerkannt, / so daß sie vielen edlen Menschen / immer zur Verfügung stehen soll.“
„wán daz ich ein lützel fuoge kan, / sô ist mîn schœne ein wint. / fuoge hân ich kleine, / doch ist si genæme wol, / sô daz si vil guoten liuten sol / iemer sîn gemeine.“139
Bei „fuoge“140 handelt es sich um einen Sammelbegriff, der mehrere Kunstfertigkeiten vereint. Es sind damit das musikalische Können und die Beherrschung der höfischen Sitten gemeint. Gerade die „hövescheit“ ist es, die es für Walther von der Vogelweide zu erringen gilt. Er verfolgte mehrere Ansätze, um seine „Legitimationsbasis“141zu erreichen,142 u. a. hat er durch die Einführung der Spruchdichtung sein Repertoire erweitert, was ein Anpassen an die Wirklichkeit war, um sein Ziel zu erreichen.143 Er musste sich beweisen, immer wieder an seinen Kunstwert erinnern, weil er nicht von Anfang an am Hof integriert war.144 Dabei ist als Hauptgrund, wofür der Hof ihn brauchte, die Freude zu nennen. Die konnte er mit seinem musikalischen Beitrag liefern (die er schon von Reinmar dem Alten kannte):
„Unter den Leuten hat niemand / auf höfischere Weise Hoffnung auf Freuden als ich. / Wenn mich sehnsuchtsvoller Kummer bedrängt, / dann erscheine ich fröhlich und tröste mich selbst. / Auf diese Weise habe ich mich oft betrogen / und der Gesellschaft zuliebe manche Freude / vorgelogen. / Dieses Lügen war aber lobenswert!“





























