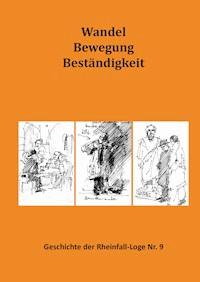
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
„Wandel Bewegung Beständigkeit“ Das Buch bietet im ersten Teil einen kurzgefassten Ueberblick über die Geschichte des weltweiten Odd Fellow Ordens. Im zweiten ausführlicheren Teil wird die Geschichte der lokalen Rheinfall-Loge Nr. 9 Schaffhausen in den letzten 140 Jahren dargestellt, mit besonderem Augenmerk auf die letzten 40 Jahre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Odd Fellows das soziale Netzwerk mit 250 Jahren Tradition
Inhalt
Vorwort
Unser Dank
Der weltweite Orden der Odd Fellows
Herkunft und Geschichte der Odd Fellows
Woher kommt der Name?
Die Odd Fellows – ein weltlicher Orden
Merkmale eines weltlichen Ordens
Die Lehre der Odd Fellows
Grad der Freundschaft
Grad der Liebe
Grad der Wahrheit
Die Lagergrade
Die Organisation der Odd Fellows
Vorurteile gegenüber den Odd Fellows
Geschichte der Rheinfall-Loge Nr. 9
Die letzten vierzig Jahre
Die ersten fünfzig Jahre
Die zweiten fünfzig Jahre
Was sind schon 100 Jahre?
Die jüngere Zeit
Das Logenleben
Die Gross-Loge und wir
Die neue Generation
Im Zeichen der Freundschaft
Eine farbige Figur
Die musische Periode
Zeit ohne Zeitzeugen
Solide Führung in schwieriger Zeit
Herz und Verstand
Helfer in Zeiten der Not
Bewältigung einer Krise
Zwischenhalt beim Wirtschaftskomitee
Das Comeback
Poesie und Philosophie
Zwei Obermeister
Der Betreuer des Logensitzes
Die aktive Generation
Stärkung des Fundaments
Die Idee
Aussensicht und Innensicht
Das Archiv
Tragende Säulen
Haushalt
Unser Logensitz
Das Amt des Schatzmeisters
Rheinwiese Petri
Gemeinnützige Aktivitäten
Die Frauen
Die Munot-Loge
Die Odd Fellows Frauen
Ausblick
Anhang
Quellen und Literatur
Vorwort
Es gibt im Raum Schaffhausen eine Vereinigung von gegenwärtig etwa neunzig Männern; die Jüngsten sind noch keine dreissig, die Ältesten über neunzig. Sie haben völlig verschiedene berufliche Hintergründe; Techniker und Handwerksmeister, ETH- und HTL-Ingenieure, Kaufleute, Unternehmer, Lehrer aller Stufen, Ökonomen, Banker, Beamte. Viele sind im Ruhestand, andere mitten oder erst am Anfang ihrer Karriere. Sie haben unterschiedliche Interessen und Neigungen; einige sind Technik-Freaks, andere den Künsten zugeneigt, wieder andere der Philosophie. Sie haben keine einheitliche politische Ausrichtung, auch keine einheitliche Konfession.
Wir sprechen von der Rheinfall-Loge Nr. 9, einer Loge im Orden der Odd Fellows, in vollständiger Schreibweise vom Independent Order of Odd Fellows I.O.O.F.
Was vereint diese Männer, was hält so verschiedenartige Menschen – natürlich in ständig wechselnder Besetzung und Anzahl – seit bald 140 Jahren zusammen? Sie sind in den Netzwerken, in den Systemen, in der Ordnung, die sich die Menschen dieser Welt geben, eingebunden, wie alle anderen. Sie spüren den Druck der politischen und gesellschaftlichen Korrektheit, sie erfreuen sich der Fortschritte und Erleichterungen der modernen Technik und leiden unter deren Auswüchsen. Sie geniessen die Freiheiten, die ihnen angeboten werden, sie tun ihre Pflichten und freuen sich des Lebens so weit wie das eben geht. Sie sind nichts Besonderes.
Aber, sie spüren, dass die ganzen Bedingungen und Regeln, die wir über diese Welt gestülpt haben, nur eine Decke sind, und dass sich unter dieser Decke eine andere Ebene befindet, die auch im Fluss, im Wandel ist, aber nicht den jeweiligen Strömungen an der Oberfläche folgt, die der Wahrhaftigkeit näher liegt und uns viel stärker in unserem Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst als wir es wahrhaben wollen. Zwar sind unsere Rationalität, unser Wissen, unsere Ausbildung, unsere Regulierungen dazu da, sie umzusetzen. Und all das uns umgebende ständige Argumentieren auf jeglichem Gebiet spricht diese rationalen Instrumente und Systeme an. Und trotzdem werden unsere Entscheide von einer unteren, uns weniger bewussten Ebene beeinflusst, dann in die gängigen rationalen Muster eingekleidet und so an die Adressaten geleitet, seien es andere, oder sei es die eigene Person, die dann danach entscheidet und handelt. In unserer oberen Bewusstseinsschicht sind wir manchmal Apparatschiks, folgen den vom Zeitgeist gemachten Regeln, weil wir nicht anders können. Auf der unteren Ebene, der Grundebene, sind wir Menschen, Menschen mit Gefühlen, mit Prägungen, die wir nicht loswerden, im positiven Fall mit emotionalen Höhenflügen, die mit nüchternem Verstand nicht immer zu begründen sind und die wir deshalb mit Coolness verbergen, weil wir sie im täglichen Leben kaum zeigen dürfen.
Die Odd Fellows sind Menschen, die diese Dualität fühlen, sie ahnen oder sogar davon wissen, die sie nicht ständig negieren mögen und deshalb bei unseren Treffen, wie es in unserem Ritual heisst, „den Alltag mit seinen Sorgen und Mühen draussen lassen“ wollen, ausserhalb des Sitzungsraumes. So können wir mindestens temporär und untereinander Mensch sein. Damit das geht, braucht es eine gewisse Vertraulichkeit, es braucht Spielraum, es braucht Verlässlichkeit und Diskretion. Das gewähren wir uns.
Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, vielleicht das einzige, aber es hat Gewicht!
Wir wissen, dass nicht nur edel ist, was wir auf der Grundebene unseres Bewusstseins vorfinden. Zum Menschsein gehört auch das Böse, das Negative, das Zerstörerische, das Egoistische. Wir wissen aber auch, dass es dem Menschen gegeben ist, an seinem Ich zu arbeiten. Wir wissen, dass er – und da gehört der Gebrauch der Ratio, der Vernunft, dazu – in der Lage ist, seine Grundausstattung zu modellieren, ohne oberflächlichen Stromlinien des Gutmenschentums oder dem gerade vorherrschenden Korrektheitsmodell zu folgen. Und dafür haben wir Leitbegriffe. Die Begriffe sind Freundschaft, Liebe, Wahrheit.
Es ist wohl wenigen gegeben, ohne Freundschaft auszukommen und als Einzelgänger ein befriedigendes Leben zu führen. Wir sind uns dessen bewusst und pflegen die Freundschaft. Gerade die Freundschaft unter Ungleichartigen bringt oft die schönsten Begegnungen. Wir übersetzen den Begriff Liebe in Nächstenliebe, ein Streben nach einem Handeln, das auch das Wohl des Nächsten zum Ziele hat – in der Erkenntnis, dass es niemandem auf die Dauer gut geht, wenn er nicht auch seine Umgebung an seinem Wohlbefinden teilhaben lässt. Wir streben nach Wahrheit und brauchen gerne das Wort Wahrhaftigkeit, weil wir wissen, dass die letzte und einzige Wahrheit zu erkennen, uns wohl nicht beschert ist. Wahrhaftigkeit können wir anstreben, indem wir uns vornehmen, andere und zuerst uns selbst nicht hinters Licht zu führen, auch dann, wenn die Wahrheit nicht so erfreulich ist, wie wir es gerne hätten.
Dieses Buch soll über uns berichten. Da uns nicht jedermann kennt, enthält es auch einige grundlegende Elemente des Woher und Wohin unseres Ordens, sowie die Stellung unserer Loge in diesem Orden. Dann wird die Geschichte unserer Loge erzählt und über einige Highlights aus deren finanzieller und materieller Vergangenheit und Gegenwart berichtet. Schliesslich wird ein Abschnitt statistische Daten und Fakten aufzeigen, wie es eine Chronik täte. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Stück unserer Logengeschichte in Form eines Büchleins aufgeschrieben wurde. Aber seit 1977, als es die hundert Jahre zu feiern galt, ist das nicht mehr geschehen. Und das wollen wir jetzt nachholen. Der Zeitpunkt scheint uns auch deshalb geeignet, weil wir offen sind für Persönlichkeiten, die den Wunsch verspüren, sich uns anzuschliessen und weil wir auch keinerlei Gründe sehen, aus unserem Bunde irgendein Geheimnis zu machen. Deshalb wendet sich dieses Werk nicht bloss an unsere Mitglieder, sondern auch an die Öffentlichkeit.
Unser Dank
gilt den zahlreichen Brüdern unserer Loge, die an dieser Schrift mitgewirkt haben, sei es als Auskunftspersonen, Interviewpartner oder sonst wie in einer hilfreichen Funktion.
Namentlich danken wir für das Lektorat des Textes Bruder Hans Brunner herzlich, ebenso Bruder Jack Vögeli, der uns bei der Organisation der Finanzierung wesentlich unterstützt hat. Unser Dank gilt Myly Raimondi für ihre Arbeit an der graphischen Gestaltung.
Es würde zu weit führen, alle übrigen Mitwirkenden einzeln und namentlich aufzulisten. Doch unser Dank gilt ihnen genau so, wie den namentlich Genannten.
Für Zuschüsse an die Kosten der Drucklegung und Veröffentlichung des Buches danken wir den Sponsoren aus der Bruderschaft und der Gesellschaft Rheinwiese Petri (GRP). Unser verbindlicher Dank gilt auch der Gross-Loge des Ordens der Schweizerischen Odd Fellows, der einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung leistet.
Schaffhausen, 1. Juli 2016
Rheinfall-Loge Nr. 9
Der weltweite Orden der Odd Fellows
von Arpad Stephan Andreànszky
Anlässlich des 125-Jahr Jubiläums der Rheinfall-Loge Nr. 9 im Jahre 2002 wurde auf eine Festschrift bewusst verzichtet. Ein formeller Beschluss darüber ist nirgends zu finden, aber alle Zeitzeugen bestätigen, man sei sich darüber einig gewesen, dieses Mal „keine miefige Vereinsschrift“ herausgeben zu wollen. Es herrschte um das Jahr 2000 weltweit eine irrationale, diffuse Aufbruchs- und Erwartungshaltung, die zugleich mit Befürchtungen, wie der Angst vor dem Zusammenbruch der globalen Elektroniksysteme untermischt war. Die Menschen und die Gesellschaft erwarteten auf den Jahrtausendwechsel hin grosse und grundlegende Veränderungen. Aus dieser Stimmung heraus distanzierte man sich von hergebrachten Gepflogenheiten und verzichtete bewusst auf die sonst übliche Jubiläumsschrift mit der Geschichte der vergangenen 25 Jahre.
Statt einer hergebrachten Jubiläumsschrift versuchte also die Schaffhauser Loge neu, ihre Präsenz und Tätigkeit in der Öffentlichkeit mit einem Benefizkonzert zu markieren, dessen Erlös von 10'000 Franken der Gassenküche gespendet wurde. Ferner empfing man die offiziellen Logenvertreter aus der ganzen Schweiz auf der Petriwiese zu einem Sommerfest, und für die Angehörigen und Mitglieder wurde im Herbst eine gemeinsame Wanderung auf dem Appenzeller Witzweg organisiert.
Das letzte Dokument zur Logengeschichte liegt mit dem Datum 1977 somit fast 40 Jahre zurück. Offenbar möchte man aber nicht bis zum nächsten runden Jubiläum (150 Jahre im Jahr 2027) warten, deshalb wurde die vorliegende Darstellung ohne einen solchen offiziellen Anlass eines runden Jubiläums in Angriff genommen. Den Anstoss gaben vielmehr Anfragen aus den Reihen der Brüder.
Zwar soll diese Schrift in erster Linie dazu dienen, die historische Lücke an Berichten zum Jubiläumsjahr 2002 zu füllen und die Dokumentation der Logengeschichte bis zur nächsten Festschrift (2027) sicherzustellen, aber wir möchten sie ausser unseren eigenen Mitgliedern auch anderen Interessierten zugänglich machen. Deshalb haben wir uns entschlossen, auch die Geschichte und die Grundelemente des Ordens in knapp zusammengefasster Form darzustellen. Dabei stützen wir uns auf das bestehende Schrifttum und vor allem sehr dankbar auf das Sammelwerk von Ernst Born, „Glossar zum Orden“.
Herkunft und Geschichte der Odd Fellows
Der Anfang des modernen Odd Fellow-Ordens lässt sich zwar fest mit der Gründung der Washington Loge Nr. 1 durch Thomas Wildey in Baltimore auf den 26. April 1819 datieren, seine Wurzeln und Ursprünge reichen aber zweifellos viel weiter zurück, bis zu den Bauhütten und Gilden des Mittelalters. In den Schriften über den Odd Fellow-Orden finden sich verschiedenste Deutungen und Mutmassungen über die Herkunft und das Alter des Ordens.
Bruderschaften von Steinmetz-Gesellen sind schon aus dem 13. Jh. bekannt. Aus ihren regelmässig erhobenen „Büchsengeldern“ bestritten sie die Kosten angemessener Beerdigungen für ihre Brüder, pflegten sie, wenn sie krank waren und richteten ihnen die Hochzeit aus. Detaillierte Ordnungen der Steinmetzen haben sich einige erhalten, so 1397 aus Trier, 1412, 1430 und 1435 aus Wien, und schliesslich die berühmte Regensburger Hüttenordnung von 1459.
Eine weitere Annahme oder ungesicherte Überlieferung besagt, nach dem grossen Brand von London von 1666 hätte man für den Wiederaufbau der Stadt unzählige Bauleute benötigt, die aber wegen den geltenden Zunftbestimmungen nicht hätten in die Zünfte aufgenommen werden können. Diese überzähligen oder „hinzugefügten Gesellen“ seien dann die ersten „Odd Fellows“ (von „added“, hinzugefügt) gewesen und sie hätten in Ermangelung des sozialen Schutzes durch die Zünfte eigene Beistands- und Hilfsorganisationen gegründet. Das ist zwar nicht schlüssig beweisbar, aber doch sehr wahrscheinlich, denn heute noch heisst einer der wichtigsten Grundsätze der Odd Fellows: „Wir begleiten unsere Toten auf ihrem letzten Weg und betreuen ihre Witwen und Waisen“. Der ursprüngliche Gedanke der Solidarität, des gegenseitigen Beistandes war zweifellos ein wichtiger, ja zentraler Aspekt in der frühen Geschichte der Odd Fellows.
Die in den alten Hüttenordnungen vorhandenen Sitten, Symbole und Grundsätze waren teilweise Allgemeingut und wurden auch von neuen Gemeinschaften übernommen, so zum Beispiel die drei Grade oder Stufen: Lehrling – Geselle – Meister; die Symbole: Zirkel – Winkelmass – Hammer – die verschlungene Schnur – drei Säulen; die Zahlen: 3 – 5 – 7 – 9, die Farben: Weiss – Blau – Rot – Gold.
Auch die Bezeichnung Loge geht auf die Treffpunkte der Steinmetzen zurück: „stonemason’s lodge“ hiess der Ort, wo Steinmetzen und Maurer zusammenkamen und arbeiteten. Die Ortsbezeichnung wurde später zum Namen der Körperschaft.
In der ersten Hälfte des 18. Jh. mehren sich die Zeugnisse für die Existenz von „Odd Fellows“ genannten Gruppierungen. Daniel Defoe, der Autor des „Robinson“, soll über eine Gesellschaft, die sich Odd Fellows nannte, geschrieben haben, die Stelle war freilich bis jetzt noch nicht auszumachen. Im Jahre 1723 wurde in England ein Orden mit dem Namen „Antient Order“ gegründet, vermutlich als Nachfolge-Organisation von früheren ähnlichen Vereinigungen. Aus diesem „Antient Order“ entstanden im späteren 18. Jh. verschiedene von einander unabhängige Odd Fellows-Gruppierungen, die sich schliesslich 1814 zu „The Manchester Unity of Independent Order of Odd Fellows I.O.O.F.“ zusammenschlossen. Diese Vereinigung entwickelte sich im Laufe des 19. Jh. zu einem gut organisierten Versicherungsinstitut – also auch hier der Solidaritätsgedanke. Im „Gentlemen’s Magazine“ wird 1745 eine Loge der Odd Fellows erwähnt, in der man behagliche und anregende Abende verbringen könne. Einem Protokoll der „Loyal Aristarcus Lodge No 9“ mit dem Zusatz „Orden der Odd Fellows“ vom 12.03.1748 ist zu entnehmen, dass diese bestrebt war, alle schon bestehenden Odd Fellow-Logen zu vereinen. Quellen aus 1780 berichten, dass eine Loge der Odd Fellows an einem Abend in unzeremonieller Weise den Prince of Wales, den späteren König Georg IV. von England, in den Orden eingeführt habe. Es sind dies die ältesten bekannten Nennungen des Namens Odd Fellows.
Tatsächlich war König Georg IV. Mitglied der Odd Fellows, wie übrigens später auch Sir Winston Churchill.
Vor 1800 vereinigten sich einzelne englische Logen unter dem Namen „Improved Order of Odd Fellows“. In Amerika wurde 1827 mit der Wilhelm-Tell-Loge sogar eine deutschsprachige Odd Fellow-Loge gegründet. Zahlreiche weitere folgten, wobei Ritual und Satzungen in die deutsche Sprache übersetzt wurden. Die Ordensbezeichnung lautete: „Unabhängiger Orden der Sonderbaren Brüder, UOSB“. Nach der Einführung des Ordens in Deutschland störte man sich dort vorerst an der englischen Bezeichnung Odd Fellow und nannte sich – für Deutschsprachige wenig sensibel – „Unabhängiger Orden der Sonderbaren Brüder“. Man stellte aber rasch fest, dass diese deutsche Übersetzung im englischen Sprachgebiet viel weniger abstossend wirkte als in Deutschland und benützte bereits ein Jahr später wieder die englische Bezeichnung. Deutsch als Sprache des Ordens-Rituals in den USA und in England wurde erst im Ersten Weltkrieg aus politischen Gründen aufgegeben.
Mit der Gründung der Washington Loge Nr. 1 in Baltimore – notabene durch einen ausgewanderten Engländer – verschob sich der Schwerpunkt der Odd Fellow-Bewegung in die USA und gewann ein eigenes geistiges Profil. Ritual und Ordenslehre betonten die gelebte Toleranz gegenüber den Mitmenschen und die tätige Hilfe an bedürftige Brüder und Dritte. In der sich rasant entwickelnden jungen amerikanischen Gesellschaft fand die Bewegung guten Nährboden und wuchs rasch. 1841 löste sich die amerikanische Gross-Loge von der englischen Manchester-Unity und bildete eine unabhängige Gross-Loge. Beim Tode des Gründers Thomas Wildey im Jahre 1861 zählte die nordamerikanische Loge gegen 400'000 Mitglieder.
Schon 1869 war beschlossen worden, den neuen Orden auch in Europa auszubreiten, und 1870 konnte daraufhin die Württemberg Loge Nr. 1 in Stuttgart als erste Loge auf deutschem Gebiet gegründet werden. 1871 folgte mit der Helvetia Loge Nr. 1 in Zürich die erste Schweizer Gründung. Weitere europäische Logen entstanden in rascher Folge: 1877 in den Niederlanden, 1878 in Dänemark, 1884 in Schweden, 1887 in Frankreich, 1896 in Island, 1898 in Norwegen, 1911 in Belgien. Nach der Wende von 1989 folgten einige Neugründungen in den Baltischen Staaten, in Polen, in Ungarn und in der Tschechischen Republik. In den romanischen Ländern schien es der Gedanke des Odd Fellow - Ordens immer etwas schwerer gehabt zu haben als im germanisch geprägten Mittel- und Nordeuropa. So gingen denn sämtliche Logen in Frankreich in Le Havre, Paris, Strassburg und Marseille von 1926 – 2002 alle wieder ein.
Auch in Deutschland schien einmal das Ende bevorzustehen: Die nationalsozialistische Herrschaft beeinträchtigte den Bestand und die Entwicklung der deutschen Logen aufs Schwerste. Um der angedrohten Zwangsschliessung und Enteignung durch den Staat zu entgehen, beschloss die Deutsche Grossloge am 2. April 1933 in Berlin ihre Selbstauflösung mit der Begründung, man wolle die Mitglieder nicht gefährden. Am 18. August 1946 wurde mit Erlaubnis der alliierten Militärregierung die Württemberg-Loge Nr. 1 in Stuttgart wieder eingesetzt. In der Schweiz hatte die sog. Fonjallaz-Initiative ein Verbot der Logen und logenähnlichen Organisationen gefordert, die Gesetzesinitiative wurde jedoch in der Volksabstimmung vom 28. November 1937 vom Schweizervolk mit deutlichem Mehr abgelehnt.
Die Grossloge der Deutschen Odd Fellows erhielt den Freibrief 1872, die Schweizerische 1874, was die Unabhängigkeit von übergeordneten Organisationen und damit weitgehende Eigenständigkeit bedeutete. Gebunden ist man lediglich an die Grundbestimmungen des Freibriefes; sie sind die Grundlage und die Garantie für den universellen, globalen Charakter der Odd Fellow-Bewegung.
Die praktische Arbeit findet im Sinne dieses Freibriefes und nach der Devise: „Global denken, lokal handeln“, jeweils in den örtlichen Logen statt, und die eigentliche Substanz des Ordens stellen denn auch die lokalen Logen mit ihren vielfältigen Tätigkeiten dar.
Woher kommt der Name?
Wie schon oben darauf hingewiesen, hatte sich die deutsche Übersetzung von „odd“ mit „sonderbar“ als ungünstig erwiesen, hat doch das Adjektiv „sonderbar“ im Deutschen einen verwunderten, missbilligenden Klang, während das Bedeutungsfeld im englischen Original viel weiter gefächert ist und keineswegs einseitig negativ besetzt scheint; „odd“ kann „ungezählt“, „vereinzelt“, „gelegentlich“, „übriggeblieben“, aber auch „ungefähr“ heissen. In Verbindung mit Zahlen hat es die Bedeutung von „etwas mehr als“. Eine „odd number“ ist eine ungerade Zahl; bei Abstimmungen heisst der zum Stichentscheid berechtigte Vorsitzende „the odd man“. „Odd jobs“ sind Gelegenheitsarbeiten, ein „odd fellow“ ist ein seltsamer Kauz, „oddity“ heisst Seltsamkeit, Eigenartigkeit oder auch ein Unikum. „Take the odds“ schliesslich bedeutet, eine ungleiche Wette eingehen. „Odd“ bezeichnet offenbar insgesamt die Eigenschaft, ausserhalb einer festgefügten Menge zu stehen; also scheint die zentrale Bedeutung doch am deutlichsten „hinzugefügt“ zu sein.
Allgemein bekannt und auch akzeptiert ist daher heute die Ansicht, „odd“ sei von „added“, „hinzugefügt“, abzuleiten. Die Odd Fellow-Logen hätten die überzähligen notleidenden Hilfsarbeiter aufgenommen, welche in den grossen, altüberlieferten Organisationen keine Aufnahme fanden.
Dagegen gibt es tatsächlich auch eine Herleitung aus dem Namen eines Arbeitsinstrumentes auf den Baustellen.
Die Manchester Unity schreibt in einer Broschüre über den Orden: Theoretische Ursprünge schliessen die Worte Hod und Ode ein. Das erstere bezieht sich auf Handlanger im Baugewerbe, hod carrier, das letztere führt auf den Brauch zurück, Oden in den Ritualen des Ordens zu verwenden.
In einem Brief des Schweizer Bruders Adolf Arnold an den damaligen Gross-Sire von 1991 wird ausgeführt, auf englischen Baustellen sei bis in die 50er Jahre ein Baugerät namens hod zu sehen gewesen, das zum Pflastertragen verwendet worden sei. Die Arbeiter hiessen entsprechend hodmen oder hodfellows. Er weist auch auf folgenden alten Bildvermerk zu einer ehemaligen Odd Fellow’s Hall hin:
„Odd Fellows incidentally was originally Hodfellows, a friendly society of those associated with bricklaying“.
Die Odd Fellows waren somit ursprünglich hodfellows, d.h. Pflasterträger, die sich in einer Gesellschaft zusammengeschlossen hatten. Die Bezeichnung friendly society deutet darauf hin, dass es sich dabei um eine Vereinigung zur gegenseitigen Hilfeleistung handelte.
Das „h“ im Anlaut wird in englischen Dialekten und in der Umgangssprache bei niederen sozialen Schichten oft unterdrückt. Das war sicher bei hodfellows der Fall. Damit entstand dann od fellows, das geschrieben keinen Sinn ergibt, weshalb es zu odd fellows umfunktioniert wurde.
Die Bedeutung „sonderbarer Kauz“ kam wahrscheinlich den Gründern entgegen, wurde doch damit der wahre Sachverhalt verschleiert und nur Eingeweihte konnten den Ausdruck deuten.
Nach einer Überlegung eines dänischen Bruders könnte „odd“ jedoch auch von „oath“ stammen, was Eid oder Schwur bedeutet. Fellow ist eine Person, mit der man eine Gemeinschaft hat. Odd Fellow bedeutet demnach viel mehr „Eidgenosse“ als „komischer Kauz“. Möglich ist aber auch, dass „odd“ eine Kurzform von „od and wed“ (Eid und Pfand) war und „Odd Fellow“ eine Selbsthilfeorganisation bedeutet, deren Mitglieder miteinander durch ein Gelübde verbunden sind.
Keine dieser Vermutungen und Mutmassungen ist mit letzter Sicherheit zu belegen. Es macht aber den Anschein, dass die Interpretation von den „hinzugefügten Gesellen“ am meisten verbreitet und am besten akzeptiert ist. Fest steht aber mit Sicherheit die handwerkliche Herkunft und damit die brüderliche, solidarische, soziale Komponente des Ordens.
Die Odd Fellows – ein weltlicher Orden
Alle Orden des Abendlandes, ob religiös oder später weltlich, lassen sich auf den Heiligen Benedikt von Nursia zurückführen, der 529 n.Chr. das Kloster Monte Cassino gründete und mit seiner Benediktinerregel die erste verbindliche Ordnung und Struktur für solche Gemeinschaften schuf. Die verschiedenen Orden des Mittelalters versuchten alle entweder die ursprüngliche Benediktinerregel zu reformieren oder durch spezielle Zielsetzungen zu ergänzen, wenn die gesellschaftliche Entwicklung neue Aufgaben mit sich brachte.
So entstanden im 12. Jh. die Ritterorden zum Schutz der Pilger, die zum Heiligen Grab nach Jerusalem unterwegs waren, die Bettelorden im 13. Jh., um das Bedürfnis zahlreicher auch ärmerer Stadtbewohner nach kirchlicher Betreuung in ihrer Alltags- oder Muttersprache zu befriedigen, im 16. Jh. die Kampforden wie die Jesuiten gegen die Reformation und im 19. Jh. schliesslich Dutzende von Orden, die speziell Krankenpflege, Mädchenerziehung, Gesellenbetreuung und Schulung und Betreuung von Jugendlichen als Zweck und Ziel hatten.
Neben den religiösen Orden entstanden ab dem 12. Jh. auch weltliche Orden, in denen die Fürsten ihre wichtigsten Gefolgsleute und Anhänger zusammenzufassen und an sich zu binden suchten; bekannte Beispiele sind der spanische Calatrava-Orden, der britische Hosenbandorden oder der burgundische Orden vom Goldenen Vlies. In der modernen Zeit haben sich Orden, wie Pour le Mérite oder Légion d’Honneur zu ehrenvollen und prestigeträchtigen staatlichen Auszeichnungen von besonders verdienten Persönlichkeiten entwickelt, und der ursprüngliche Hintergrund ist verloren gegangen.
Das Wesen eines Ordens, ob religiös oder weltlich, besteht darin, eine weltanschauliche Gemeinschaft zu bilden, gemeinsame Ideen und Überzeugungen als Grundlage der Lebenshaltung ihrer Mitglieder zu vermitteln und gemeinsame ideelle Ziele zu verfolgen. Orden begnügen sich also nicht damit, wie etwa Vereine oder Clubs, lediglich einen Vereinszweck zu definieren und spezielle Tätigkeiten auszuüben, z.B. eine Sportart zu betreiben oder Wohltätigkeit zu üben, sondern sie erfassen die ganze Grundhaltung und Lebensführung ihrer Mitglieder.
So bemühen sich die Odd Fellows, ihr Leben nach den Grundwerten von Freundschaft, Liebe und Wahrheit auszurichten.
Religiöse wie weltliche Orden haben bestimmte Leitideen und Strukturen, die auch in der Lehre und im Brauchtum der Odd Fellows deutlich zu erkennen sind.
Merkmale eines weltlichen Ordens
Grundlage eines jeden Ordens ist der Gedanke, Menschen mit gleicher Gesinnung zu einer strafferen, engeren Gemeinschaft zu verbinden.
Deshalb formuliert man gemeinsame Leitideen und Vorstellungen, die man in Form einer Devise festhält. „Ora et labora“, bete und arbeite bei den Benediktinern, „Freundschaft, Liebe und Wahrheit“ bei den Odd Fellows. Gegen aussen führt man ein Wappen, ein Signet oder modernerweise ein Logo und demonstriert damit die sogenannte „Corporate Identity“. Rückzug in ausgezeichnete, besondere Räume zu festgelegten Zeiten und Rituale und festgelegte Abfolgen von Handlungen dienen der Vergewisserung innerhalb der Gemeinschaft.
Trugen die Mönche ein spezielles Gewand, das ihren Status sofort kenntlich machte, tragen die Ordensbrüder während den rituellen Sitzungen eine Regalie und in der Öffentlichkeit ein diskretes Abzeichen. Die permanente Lebensgemeinschaft in einem Kloster ist säkular ersetzt durch regelmässige Sitzungen. Herrschte in den Klöstern strenge Klausur, schliessen sich die OF Brüder zu ihren Sitzungen in einem Raum ein, aus dem der Alltag ausdrücklich ausgeschlossen ist.
Leisteten die Mönche einen lebenslangen Profess, legen die Brüder ihrerseits ein feierliches Versprechen ab, die Ordensgrundsätze zu beachten und zu befolgen. Feierten die Mönche heilige Messen, halten die Brüder rituelle Sitzungen ab. Bekannten sich die mittelalterlichen Mönche zum christlichen Glauben und zur katholischen oder griechisch-orthodoxen Kirche und ihren festgelegten Dogmen, stellen es die OF Brüder jedem Einzelnen anheim, die Konfession und die Richtung seiner religiösen Überzeugung festzulegen. Dies ist das Erbe der Aufklärung, des Pantheismus und des Toleranzgedankens, wie diese Ideen im 18. Jh. entwickelt wurden. Nicht umsonst wurde bis vor wenigen Jahren in den Lehren zum Lager die Ring-Parabel aus Lessings „Nathan der Weise“ als Musterbeispiel für gelebte Toleranz und pantheistischen Gottesglauben vermittelt.
Da liegen denn auch die Berührungspunkte zu den Freimaurern.
Eine Fernwirkung früherer religiöser Orden ist auch der globale, universale Charakter der weltlichen Orden und ihre hierarchische Organisation, die ja in erster Linie die Homogenität der Ordenslehre sicherstellen soll. Der sogenannte „Freibrief“ gilt weltweit und bildet überall die Grundlage der Ordenstätigkeit, wie es früher die gemeinsame Ordensregel bei den religiösen Orden tat. Die Bezeichnungen der höchsten Ränge und Funktionen scheinen aus dem früheren Sprachgebrauch von Ritterorden entlehnt worden zu sein: Gross-Sire, Gross-Marschall, Gross-Sekretär, Gross-Schatzmeister. Besassen die früheren Orden rangmässig unterschiedliche Klassen, teilen die OF ihre Lehre in Grade oder Stufen ein.
Die Lehre der Odd Fellows
Wie schon oben darauf hingewiesen, gründet die OF-Bewegung in einem Bedürfnis nach gegenseitigem Beistand und Hilfe und folgt religiösen und ethischen Grundsätzen, wie sie in der Zeit der Aufklärung im 18. Jh. formuliert wurden. Diese Grundlagen entwickelte Thomas Wildey 1819 zu einer praktischen Ordenslehre weiter, die in ihren Grundzügen heute noch gilt.
Diese Ordenslehre ist daher keine Heilslehre im religiösen Sinne, sie ist auch kein systematisches, geschlossenes, philosophisches oder ideologisches System und auch kein Instrument irgendwelcher spiritueller Spekulation. Vielmehr ist sie eine Anleitung zu einer Haltung, die sich zu ganz bestimmten Idealen bekennt und ihre Verwirklichung als Fernziel anstrebt. Diese Ideale sind umschrieben mit der Devise „Freundschaft, Liebe und Wahrheit“.
Dementsprechend ist die sogenannte Ordenslehre in Grade eingeteilt, es sind ihrer neun, nämlich der Einführungsgrad, die drei Logengrade Freundschaft, Liebe, Wahrheit, die drei Lagergrade L1 Patriarchen-Grad, L2 Grad der Goldenen Lebensregel, L3 Königspurpur-Grad und die zwei Grosslogengrade GL1 Grad des Dienens und GL2 Grad der Verantwortung.
Für die Praxis spielen die ersten vier Logengrade die entscheidende Rolle; die Lagergrade werden jeweils in einer Sitzung erteilt und die Grosslogengrade erwerben sich nur wenige Mitglieder.
Grad der Freundschaft
In der sogenannten Lehre zum Grad der Freundschaft wird der Odd Fellow angehalten, darüber nachzudenken, wie weit er in seinem Verhalten zu gehen bereit ist, um einen Freund vor Gefahr zu schützen und ihm allenfalls tätig zu helfen.
Als Beispiel wird die alttestamentliche Geschichte von Jonathan, dem Sohn König Sauls und David, dem armen Hirten, aus dem Buch Samuel (1. Samuel 20, 20 ff) angeführt.
Jonathan spricht zu David:
„Ich aber werde übermorgen mit Pfeilen nach seiner Seite schiessen, als ob ich für mich nach einem Ziel schösse. Dann aber werde ich den Burschen schicken: „Geh, suche den Pfeil!“ Sage ich zu dem Burschen: „Sieh der Pfeil liegt herwärts von dir, hole ihn!“ so komm, denn es steht gut für dich, und es hat keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Sage ich aber zu dem Jüngling: „Sieh der Pfeil liegt hinwärts von dir!“ so gehe, denn der Herr heisst dich gehen.“
Jonathan, Sohn und Erbe des Königs Saul, ist mit David eng befreundet und rettet David vor der Eifersucht und dem Mordanschlag seines Vaters, obwohl ihn dies sein Königserbe kostet, denn nach Saul wird nun David König, nicht Jonathan.
Soll und kann man als Freund wirklich so nobel und uneigennützig sein, und wenn nicht, wie weit kann man dann in der Realität gehen? Bei dieser überhöhten und idealisierten Erzählung geht es sicher nicht um eine Nachahmung im Wortsinn. Aber es geht um den Geist, um die Haltung, die dem Odd Fellow als Idealbild vor Augen geführt wird. Sicher stehen in der heutigen sachlichen Welt auch keine heroischen Entscheidungen solchen Ausmasses an. Aber geduldiges Zuhören, aufmerksame Anteilnahme, echtes Mitgefühl mit dem Geschick des Freundes und Sorge um sein Wohlergehen sind auch heute noch die Pfeiler und die Substanz jeder echten Freundschaft.
Das jeweilige Gradengespräch mit einem erfahreneren Bruder dient der Besinnung, der Reflexion und der Selbstprüfung: Ist dieser Weg der richtige für mich, will ich ihn so gemeinsam mit den Ordensbrüdern weitergehen?
Auf Grund mehrfacher schmerzlicher Erfahrungen zu Ende des 19. Jh. werden aber neu eintretende Brüder auch sehr deutlich davor gewarnt, an unklaren, unsicheren oder allzu riskanten Geschäften anderer Brüder teilzunehmen oder Bürgschaften einzugehen, die für sie und für ihre Familien grosse Risiken oder gar Gefahren darstellen könnten.
Grad der Liebe
Schon die Spätantike entwickelte neben dem platonischen Liebesbegriff, dem „Eros“, die abstraktere „Agape“, die nicht durch das Verlangen nach ihrem Gegenstand bestimmt ist, sondern ihr Wesen in selbstloser Hingabe hat. Agape war ursprünglich eine christliche Tischgemeinschaft zwischen Reich und Arm. Unter dem lateinischen Namen Caritas ist die Haltung heute noch als Inbegriff der selbstlosen, fürsorglichen Hinwendung zum Mitmenschen bekannt. Caritas liebt nicht das, was an sich selbst schon liebenswert ist, sondern sie schafft Wert dadurch, dass sie liebt.
Zur Verdeutlichung dieser zugegebenermassen schwierigen Forderung nach caritativer Grundhaltung wird das neutestamentliche Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas 10, 25) erzählt und gedeutet.
„Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel Räubern in die Hände; die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und liessen ihn halbtot liegen. Zufällig aber ging ein Priester jene Strasse hinab; und er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit an den Ort, sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der unterwegs war, kam in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen mit ihm und trat hinzu, verband seine Wunden, indem er Öl und Wein darauf goss, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am folgenden Tage nahm er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege ihn! Und was du mehr aufwenden wirst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.“





























