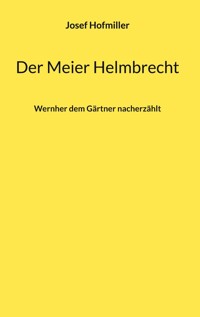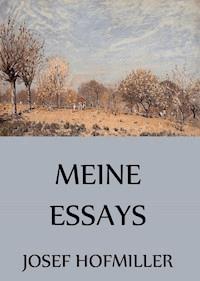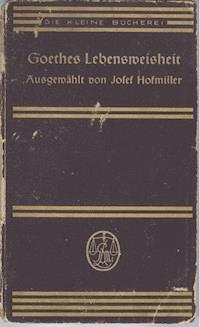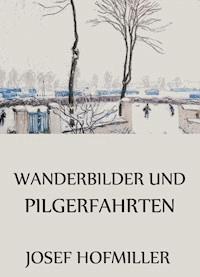
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses kleine Buch will auf seine Weise werben für die Schönheit der Heimat. Daß ihre herrlichsten Schöpfungen vielen Bayern so gut wie unbekannt sind, auch gebildeten und feinen Menschen, sogar solchen, die schon viel und weit gereist sind, ist Tatsache. Man frage einmal in seinem Bekanntenkreise herum, wer die Amalienburg kennt, oder die Reichen Zimmer der Residenz, oder Blutenburg, oder die Wies bei Steingaden, Niederaltaich, Ottobeuren, Altomünster, Schongau mit Altenstadt, sogar Städte wie Burghausen, Passau, Straubing, Landshut, ja selbst Augsburg, Nürnberg, Bamberg, Würzburg, von Dinkelsbühl und Rothenburg gar nicht zu reden! Dabei ist die Amalienburg schöner als die Trianons in Versailles; ist süddeutscher Barock feiner, lebendiger, kraftvoller, reicher an Einfällen als französischer, insonderheit Pariser; ist die Wies baulich ungefähr ein ähnliches Juwel wie Mozarts "Figaro" musikalisch; ist Ottobeuren nur mit den ganz großen Klosteranlagen in Österreich zu vergleichen: Melk, Sankt Florian, Kremsmünster, Göttweig, Admont; und wenn Burghausen in Tirol läge, wäre es jedem Hochzeitsreisendenpaar in Erinnerung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wanderbilder und Pilgerfahrten
Josef Hofmiller
Inhalt:
Josef Hofmiller – Biografie und Bibliografie
Wanderbilder und Pilgerfahrten
Vorwort
Ingolstadt
Seeon, Baumburg, Rabenden
Kloster Au und Gars
Das Idyll Oberberghausen
Altbayrischer Bauernadel
Im Chiemgau
Württemberg als Reiseland
Das deutsche Wirtshaus
Alte deutsche Städte
Würzburg
Südtirol
Die Wachau
Deutsche Reiseziele nach dem Krieg
Pilgerfahrten
Burghausen
Freising
San Gimignano
Die Wieskirche bei Steingaden
Ottobeuren
Memmingen
Vom Wandern
Wanderbilder und Pilgerfahrten, J. Hofmiller
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849628208
www.jazzybee-verlag.de
Josef Hofmiller – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, Essayist und Nietzsche-Forscher, geboren am 26. April 1872 in Kranzegg im Allgäu, verstorben am 11. Oktober 1933 in Rosenheim. Eigentlich Josef Max Maria Hofmiller. Sohn eines Lehrer. Besuchte das Dom-Gymnasium Freising und das Wilhelmsgymnasium München, wo er 1890 sein Abitur ablegte. Begann schon in jungen Jahren die Werke Schopenhauers und Nietzsches zu lesen und studierte folglich Theologie und Philosophie, später Germanistik und Neuphilologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1894 legt er dort das das Staatsexamen als Gymnasiallehrer für Französisch ab, zwei Jahre später folgt der Abschluss in Englisch. 1902 promoviert er zum Dr. phil. Bis zu seinem Tod unterrichtet er in verschiedenen Positionen an Schulen und Gymnasien in Freising, München und Rosenheim.
Wichtige Werke:
VersucheLetzte VersucheZeitgenossenWohltäter der MenschheitWege zu GoetheFontanes LebenskunstAltbayerische SagenBayernbüchleinDer König reist durch sein BayernlandVon Dichtern, Malern und WirtshäusernWanderbilder und PilgerfahrtenÜber den Umgang mit BüchernWanderbilder und Pilgerfahrten
Ein Pilgrim
von Conrad Ferdinand Meyer
's ist im Sabinerland ein Kirchentor – Mir war ein Reisejugendtag erfüllt – Ich saß auf einer Bank von Stein davor. In einen langen Mantel eingehüllt, Aus dem Gebirge blies ein harscher Wind – Vorüber schritt ein Weib mit einem Kind, Das, zu der Mutter flüsternd, scheu begann: »Da sitzt ein Pilgerim und Wandersmann!«
Mir blieb das Wort des Kindes eingeprägt, Und wo ich neues Land und Meer erschaut, Den Wanderstecken neben mich gelegt, Wo das Geheimnis einer Ferne blaut, Ergriff mich unersättlich Lebenslust Und füllte mir die Augen und die Brust, Hell in die Lüfte jubelnd rief ich dann: »Ich bin ein Pilgerim und Wandersmann!«
Es war am Comer- oder Langensee, Auf lichter Tiefe trug das Boot mich hin Entgegen meinem ew'gen stillen Schnee Mit einer andern lieben Pilgerin – Rasch zog mir meine Schwester aus dem Haar, Dem braungelockten, eins, das silbern war, Und es betrachtend, seufzt' ich leis und sann: »Du bist ein Pilgerim und Wandersmann.«
Mit Weib und Kind an meinem eig'nen Herd In einer häuslich trauten Flamme Schein Dünkt keine Ferne mir begehrenswert, So ist es gut! So sollt' es ewig sein... Jetzt fällt das Wort mir plötzlich in den Sinn Der kleinen furchtsamen Sabinerin, Das Wort, das nimmer ich vergessen kann: »Da sitzt ein Pilgerim und Wandersmann.«
(Widmung Hofmillers an seine Frau in einem Exemplar der »Wanderbilder«)
Vorwort
Zur Erstausgabe der »Wanderbilder«
Dieses kleine Buch will auf seine Weise werben für die Schönheit der Heimat. Daß ihre herrlichsten Schöpfungen vielen Bayern so gut wie unbekannt sind, auch gebildeten und feinen Menschen, sogar solchen, die schon viel und weit gereist sind, ist Tatsache. Man frage einmal in seinem Bekanntenkreise herum, wer die Amalienburg kennt, oder die Reichen Zimmer der Residenz, oder Blutenburg, oder die Wies bei Steingaden, Niederaltaich, Ottobeuren, Altomünster, Schongau mit Altenstadt, sogar Städte wie Burghausen, Passau, Straubing, Landshut, ja selbst Augsburg, Nürnberg, Bamberg, Würzburg, von Dinkelsbühl und Rothenburg gar nicht zu reden! Dabei ist die Amalienburg schöner als die Trianons in Versailles; ist süddeutscher Barock feiner, lebendiger, kraftvoller, reicher an Einfällen als französischer, insonderheit Pariser; ist die Wies baulich ungefähr ein ähnliches Juwel wie Mozarts »Figaro« musikalisch; ist Ottobeuren nur mit den ganz großen Klosteranlagen in Österreich zu vergleichen: Melk, Sankt Florian, Kremsmünster, Göttweig, Admont; und wenn Burghausen in Tirol läge, wäre es jedem Hochzeitsreisendenpaar in Erinnerung.
Seitdem die ersten dieser Wanderbilder erschienen, ist manches für die Entdeckung dieser schönen Städte geschehen. Einige Hilfsmittel seien hier angeführt:
An erster Stelle seien die beiden Baedeker-Bände »Südbayern« und »Nordbayern« genannt, beide an Richtigkeit und Genauigkeit der Angaben in jeder Beziehung unübertroffen. Kunstgeschichtlich unentbehrlich ist Hans Karlinger: Bayrische Kunstgeschichte, deren I. Band Altbayern und Bayrisch Schwaben behandelt. Ganz reizend sind die drei Bände des leider viel zu früh verstorbenen Hans Mayr: Bayrische Wanderschaft, Alte bayrische Erde, Vertrautes Land. Volkskundlich ist von höchstem Werte Leoprechtings »Lechrain«, wie auch Strobl »Altbayrische Mittel und Bräuch«, und »Altbayrische Feiertäg«.
Über Ingolstadt ist eine Darstellung von Hermann Schmidt mit guten Bildern erschienen. Das schönste Werk über Südtirol ist das von Josef Julius Schätz mit über 200 Bildern in Kupfertiefdruck.
Aber die Hauptsache ist: nicht Bilder anschauen, sondern die Sachen selbst aufsuchen. Nicht lesen, sondern gehen. Nicht immer nur fahren, sei es Bahn oder Kraftwagen, sondern gehen, wandern. »Gehören« tut uns ein Ort nur, wenn wir ihn zu Fuß aufgesucht (bei großen Städten ist es etwas anderes) und mindestens einmal dort übernachtet haben. Nur wer das Inntal zwischen Mühldorf und Rosenheim zu Fuß gegangen ist, weiß Au, Gars, Rott, Wasserburg ganz zu würdigen. Und nur wer von Freilassing an über Laufen und Tittmoning zu Fuß nach Burghausen wandert, kommt hinter die letzten Schönheiten des Rupertiwinkels. Vor allem die Wies wirkt nur als Wallfahrt so zauberhaft: eine ordentliche Tagesleistung, aber wie wird sie belohnt!
Rosenheim, Juni 1928
Josef Hofmiller
Ingolstadt
(1927)
Es gibt zwei extreme Möglichkeiten, eine bisher unbekannte Stadt zu genießen: man bereitet sich auf sie gründlich vor oder gar nicht. Ich bin für die zweite. Denn je mehr man von einer Stadt vorher weiß, desto deutlicher wird das falsche Bild, das man sich von ihr macht, und einen desto schwereren Stand hat die Wirklichkeit, es zu verwischen. Verbinden wir nicht ohnehin schon unbewußt mit dem bloßen Klang eines Orts eine bestimmte Vorstellung?
Wir saßen in Eichstätt, das eine Sache für sich ist, ein betörender Anachronismus, ein Mondscheinidyll am hellichten Tag, das aus lauter Plätzen zu bestehen scheint, die wie ein geistreiches Impromptu ineinander überquellen, geistlich und halb südlich wie Salzburg – aber ich will ja über Ingolstadt schreiben. Wir saßen also in Eichstätt, und wollten am nächsten Morgen durch die Eichendorff-Landschaft des Altmühltals, aber das malerische Spitzwegnest ließ uns nicht los, wir machten mit unserem Plan das Gescheiteste, was man mit Plänen überhaupt machen kann, nämlich wir schmissen ihn um und blieben noch da. »Eigentlich könnten wir Ingolstadt bei der Gelegenheit erledigen«, sagte ich zu meinem Begleiter, »ein zweites Mal kommt man doch nicht mehr hin.« »Das möchte ich nicht einmal so ganz gewiß behaupten«, erwiderte er und lächelte sonderbar. »Kennen Sie's denn?« »Was heißt kennen? Dort war ich. Nicht nur einmal. Ich möchte vorher lieber nichts sagen. Morgen werden Sie ja selber sehen...«
*
Zuerst geht es über aufgelassenes Festungsgelände, das erst städtebaulich erschlossen werden muß. Auf einmal ist man am unteren Graben und sieht die drolligen halbrunden Türme mit der alten Mauer: »Das ist ja nicht übel! Kommt noch mehr dergleichen?« »Dergleichen können Sie haben, so viel Sie wollen. Warten Sie nur ab!« Man geht weiter, es wird immer hübscher, Straßen, Häuser, Giebel, an was erinnert das nur? An Augsburg, aber doch wieder anders, gewissermaßen ein altbayerisches Augsburg, eine Art Kreuzung zwischen Augsburg und Landshut... Aber man hat nie die rechte Aufmerksamkeit, solange man nicht weiß, wo man übernachtet; also zuerst in den nächstbesten anständigen Gasthof, daß man endlich den Rucksack losbringt.
Der Rucksack liegt auf Nummer 42, es kann losgehen! »Wollen Sie noch irgend etwas Besonderes sehen oder versparen wir uns das bis morgen?« »Lieber nicht, heut möcht' ich bloß die Stadt selber sehen.« Wir gehen durch Straßen, Gassen, über Plätze, alles famos, es könnte gar nicht hübscher sein, ich muß immer wieder an Augsburg oder Landshut denken, Giebel an Giebel, Treppengiebel, durchbrochene Zinnengiebel, Blendfassaden, Flacherker, die nicht in der Achse stehen, Biedermeierpforten, Rokokoranken – auf einmal, ein wenig erhöht, die Obere Pfarr: Donnerwetter! so etwas von meilenweiter Beherrschung der Stadt, der Gegend, gibts nicht leicht, man sieht sie längst, vor man (von München her) nach Ingolstadt kommt, und sieht sie noch, bis sich der Zug in den Jura hineingräbt. Wie das altersgraue Gemäuer dasteht, mit zwei aggressiv übereck gestemmten Türmen, geduckt, wie ein riesenhaftes mythisches Tier vor dem Sprung, nichts als gebändigte Masse, konzentrierte Wucht, das ist unerhört! Mit Mühe verkneift man sich, daß man gleich hineinrennt, und geht noch zum Kreuztor hinaus: abermals Donnerwetter! Die Überschneidungen allein sind ja wert, daß man herfährt! Ehe man umkehrt, zieht man seinen Baedeker heraus. Der Stadtplan ist klar auf den ersten Blick: die eine Hauptstraße von Ost nach West, vom Alten Schloß bis zum Kreuztor, die andre von Süd nach Nord, vom Donautor bis zur Kasernenstraße, genau im Mittelpunkte der Stadt schneiden sie sich, nach rechts und links gabeln schmalere Straßen ab wie die Zweige einer Fichte, von unten nach oben laufen ebenfalls schmälere, wie die Äste einer Linde, die sich ausbreitet: der organisch gewachsene Plan einer mittelalterlichen Stadt, alle Straßenzüge leicht geschwungen, keine schnurgeraden Parallelen, nicht die end- und trostlosen Perspektiven des neunzehnten Jahrhunderts mit einer Leere, einem Nichts, lauter Luft am Ende, – da ist ja im wesentlichen noch nichts verdorben, das ist ja das Sandtnersche Relief vom Nationalmuseum!
Unbewußt ist es ausgesprochen. Was man erwartete, war eine verödete Kaserne. Was man findet, erstaunt, entzückt, auf Schritt und Tritt verblüffter und vergnügter, ist das Relief Jakob Sandtners aus dem Jahre 1573, nicht mehr ganz unversehrt an den Rändern natürlich, obwohl auch da noch viel mehr steht, als man sich hatte träumen lassen, aber der Kern, das Straßennetz in einer Weise erhalten, daß man sich nur immer und immer wieder fragt: Warum sagt einem das kein Mensch? Wie ist es menschenmöglich, daß über eine so seine alte Stadt so albern absprechende Urteile in Schwang sind?
Wir sind in der Stadt noch planlos kreuz und quer umeinandergelaufen bis zum Dunkelwerden und Müdewerden. Mein Begleiter lachte immer wieder über die Überrumpelung: dieses Ingolstadt hatte mich tatsächlich überrumpelt, es war genau das Gegenteil wie bei Ravensburg, wo einer dem andern die Phrase vom oberländischen Rothenburg weitergibt, – wenn man dann hinkommt, stehen die alten Türme einschichtig und sinnlos da, weil keine Stadtmauern mehr dazwischen sind, lauter neue Häuser, sauber, nüchtern und langweilig. Aber Ingolstadt! Man hat sich ein städtebaulich unmögliches Soldatenlager eingebildet, und entdeckt eine charaktervolle alte bayrische Stadt, so edel, so bedeutend wie Landshut: Bürgerstadt, nicht nur Herzogsstadt.
Dabei nicht im geringsten das, was die Italiener città morta heißen: eher ist dieses Ingolstadt in Bezug auf Verkehr, Läden, Auslagen ein kleines Nürnberg. Anfangs meint man sogar, es lebe straßenspektakulös über seine Verhältnisse, aber wer könnte sich heute den Luxus von so viel zwecklos herumfahrenden Lastautos leisten? Ich habe diesen Spektakel gern, wenn er auch den Morgenschlaf verscheucht, denn dieser pumpernde Verkehr kündet unmißverständlich: »Ich bin nicht unterzukriegen, ich wachse, ich gedeihe, und wenn ich nicht mehr Bayerns erste Militärstadt bin, so bin ich dafür eine moderne Stadt, die sich reckt und streckt, und eine prachtvolle alte Stadt dazu.« Das ist es, was an Nürnberg erinnert: das Leben der Straße. Natürlich sind die pensionierten weltentrückten Nester wie Rothenburg oder Dinkelsbühl in ihrer traumhaften Zeitlosigkeit entzückend, aber wenn in dieser alten Herzogsveste der Autolärm früh um 6 Uhr loshupt und abends erst um 7, ½ 8 still wird, dann jubelt das bayerische Herz über den ungestüm pochenden Pulsschlag dieser unserer Zeit mitsamt ihren Unzulänglichkeiten, jawohl; ihren Scheußlichkeiten, zugegeben; aber die Stadt freut einen gerade nochmal so viel: Nicht unterzukriegen! nicht unterzukriegen! Das ist es.
Wir sprachen abends noch lang über diese Dinge in einem gemütlichen Kreise von einheimischen Herren. Einer übernahm am nächsten Morgen die Führung, ausgezeichnet, noch nicht leicht habe ich in so kurzer Zeit so viel Unvergeßliches gesehen.
Es war Markttag. Markttag, gar der Wochenmarkt in einer alten Stadt, ist immer etwas fabelhaft Malerisches, es braucht nicht die Piazza Erbe in Verona zu sein, die Menzel gemalt hat, es genügt schon die Karolinenstraße in Augsburg bis zum Perlach, oder der Hauptmarkt in Nürnberg, vom Erker im ersten Stock des Kaffeehauses an der Plobenhofstraße aus, oder diese Ludwigsstraße in Ingolstadt: an Obst, Gemüse, Geflügel, Butter, Schmalz, Eiern, Blumen – welches Angebot! was für Prachtgockel und Gänse, lebendig und tot, vor allem aber die Blumen, die vielen, vielen Blumen, rechts und noch mehr links, nicht nur Blumenstöcke, nein, der holde, höchst nötige Luxus von Schnittblumen! Wenn wir an unsere Jugend zurückdenken: wie lang hat es gedauert, bis in München fast das ganze Jahr im Freien Schnittblumen verkauft wurden! Jetzt, wo man nur hinkommt; wenigstens in der guten Jahreszeit. Man hat den Verbrauch von Seife als Gradmesser der Kultur bezeichnet. Ich glaube, der Verkauf von Schnittblumen ist ein besserer. Je mehr die Menschen das Bedürfnis fühlen, sich Blumen auf den Tisch zu stellen, desto kultivierter werden sie innerlich, und wär's bloß ein Sträußchen Schlüsselblumen. Heut gehen wir mit Stolz, mit Genugtuung durch die Straße, die uns schon gestern so gefreut hat: das alles würde doch nicht angeboten, würde nicht von Gärtnern und Bauern hereingefahren, wenn es nicht gekauft würde! (Wirklich war um Mittag fast alles weg.) Diese jubilierenden Farben der Äpfel, Birnen, Pflaumen, Trauben, der unübersehbar bunten Blumen, rufen sie nicht dem Auge dasselbe zu, wie die Motorräder, die Lastautos, die Autobusse dem Ohr: »nicht unterzukriegen, im Gegenteil, jetzt erst recht...«
Ich möchte den Leser nicht ermüden mit Aufzählung der interessanten Kirchen, die wir absolvierten, ehe wir zum Schloß kamen. Aber dieses Schloß – es stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert – ist wiederum allein schon die Reise wert. Es sind die schönsten Profanräume der Gotik, die ich gesehen habe; am ehesten noch zu vergleichen mit denen von Burghausen, aber schwingender, gewissermaßen musikalischer. Früher hat man nichts davon gewußt, weil sie Waffendepots waren so gut wie unzugänglich, außerdem vollgestopfte Magazine. Der Staat, er sei gelobt und gepriesen, hat der Stadt den Bau zur Einrichtung eines Museums und einer Gemäldegalerie überlassen. Geplant ist auch ein großer Konzertsaal. Wenn alles fertig ist, ist es eine der größten Sehenswürdigkeiten von Deutschland. Schon was jetzt erschlossen ist, Hallen, Dielen, Säle im Erdgeschoß und ersten Stock, ist herrlich. Die Räume sind nur weiß getüncht, so daß nichts wirkt als Linien und Wände, das Spiel des Lichtes auf der kühlen Fläche, das bezaubernd schöne Verhältnis von Höhe, Breite, Tiefe, das Herauswachsen der gedrungenen eckigen Pfeiler aus den noch derberen Sockeln, ihr elastisches Verzweigen in die Rippen der Gewölbe, wo sich alles stützt, stemmt, spannt, schneidet, weitet, die schmalen Türen mit den gekehlten Einfassungen, phantastischen Krabben-Rahmungen, manche schon hart an der Renaissance, einer herben, spröden, nordischen Renaissance, dann wieder Mittelpfeiler mit Schraubenhohlkehlen (wie im Mortuarium des Eichstätter Doms), Durchblicke in steile Wendeltreppen, Ausblicke auf die Türme und Giebel der Stadt, auf den nahen »Herzogskasten« – es ist so schön, daß man ganz vergißt, die ausgestellten Sachen anzusehen, mit einem so wohligen Gefühl schwebt man aus einem Gelaß und Gemach ins andere, das ist alles altbayrisch, kraftvoll und doch zierlich, einfach und dennoch festlich; man fühlt: das gehört zu uns, und wir gehören dazu.
Dann standen wir in der Neuen Franziskanerkirche – man braucht nur den ersten Blick hineinzuwerfen und weiß schon: Johann Michael Fischer. Die Harmonie des Zentralbaus sagt es, die abgeschrägten Ecken, sogar die Formen der Brüstungen und Geländer sagen es, vor allem aber sagt es das ihm eigentümliche in sich selber ruhende Gefühl für Raum, Verhältnisse, Ausmaße, das ihm sicher ganz unbewußt war, und das dennoch, förmlich körperlich, auf den Beschauer beglückend überströmt, gleichviel, ob St. Anna im Lehel oder Berg am Laim, Rott oder Zwiefalten, Altomünster oder Ingolstadt.
Und dann, ja dann kam erst die überwältigende Überraschung: Das Innere der Oberen Pfarr mit dem Hochaltar von Hans Mielich. Sie ist von den mächtigen spätgotischen Kirchen Altbayerns unstreitig die mächtigste, als Raum bedeutender als die Münchener Frauenkirche. Das Mittelschiff ist gewaltig überhöht über die Seitenschiffe, und wie die neun Paar schlanker Rundsäulen es tragen, wirkt es als lichtvoller Baldachin. Etwas Merkwürdiges ist in den sechs westlichen Chorkapellen zu sehen: Gewölberippen mit dem Schlußstein, nicht wahr, das ist gewissermaßen die steinerne Schreinerarbeit der Gotik, es kann sehr fein sein, es kann sogar phantastisch sein, aber es löst sich nicht los von seiner Unterlage, vor allem hängt es nicht in der Luft wie ein Venezianer Lüster. Hier ist beides der Fall. Man muß sich vorstellen, daß sich die Rippen selbständig gemacht haben, sie sind mit dem Gewölbe nur noch an den Endpunkten verbunden, hängen droben wie Dorngerank, das sich überwächst, durchzweigt, verknotet, und von diesem Dorngerank, das ist das Tollste, hängen doldenhafte Märchen herunter wie steinerne Silberdisteln. Dieses spätgotische Filigran spielt virtuos mit Formen, die man nur in Holztechnik für möglich hielte, oder in Metalltechnik; es ist sozusagen gedrechselt, oder ziseliert, es geht weit hinaus über alles, was ein paar Jahrhunderte später das Rokoko in Stuck riskiert.
Aber schließlich landet man doch vor dem großartigen Hochaltar Hans Mielichs, der wiederum in seiner Art einzig ist. Man denke: ein Altar mit Doppelflügeln wie der Isenheimer oder der Blaubeurer, aber ohne geschnitzten Mittelschrein, lauter Tafeln, in der Mitte das große Stifterbild, um das herum und auf je zwei Seitenflügeln vorne und hinten fast hundert kleinere, in der Größe der landläufigen gotischen Bilderfolgen, etwa des Blaubeurer Johanneszyklus, hier in Ingolstadt das Marienleben darstellend und des Heilands Erdenwallen. Der Altartypus ist rein gotisch, die Anordnung der Gemälde ist gotisch, die Gemälde selber sind deutsche Renaissance, das Gebälk und Rahmenwerk des Aufbaus hat schon etwas Barockes, dabei ist alles aus einer Zeit; eine Stunde vergeht wie nichts, wenn man den Mesner bittet, Leuchter und alles Bewegliche wegzuräumen, den Altar ganz zu schließen, dann die Seitenflügel halb und endlich ganz auseinanderzuklappen: Farbenleuchtend und goldschimmernd entfaltet sich lautlos Wunder um Wunder, man denkt an die eingelegten Köstlichkeiten der Zierschreine und Prunktische der Zeit, erlesene Kleinarbeiten von genauester Bestimmtheit und Durchbildung des Formalen, handwerklich von vollkommener Redlichkeit, zusammengehalten durch einen rein konstruktiven und dekorativen Grundgedanken, ein ins Riesenhafte vergrößerter Tischaltar eines Augsburger Goldschmieds mit aufgelegten Email-Miniaturen.
Ich übergehe die vielen Einzelschönheiten der hohen Kirche, Fenster, Grabmale, Schnitzwerke; es hat keinen Sinn, das aufzuzählen. Nur von dem Betsaal der Maria Viktoria möchte ich noch sprechen, in dem wir uns von den übermächtigen Eindrücken der Oberen Pfarr erholten, einem geistreichen, schön-rhythmischen Raum, der an die Kaisersäle in Ottobeuren oder St. Florian anklingt, oder an den Münchener Bürgersaal, ein raffiniert beherrschtes und abgewogenes Stück kirchlicher Salonarchitektur, elegant, repräsentativ wie ein Thronsaal, dabei von einer vornehmen Behaglichkeit, daß man unwillkürlich auf den ketzerischen Einfall kommt: hier müßte das G-moll-Quintett von Mozart gut klingen.
Wie wir zu guter Letzt vor dem niedlichen Restaurant im Park saßen, dessen Rabatten und Alleen meisterhaft in aufgelassenes Festungsgelände hineinkomponiert sind, ergriff unser liebenswürdiger Führer ernst das Wort und sagte ungefähr: »Ich habe Ihnen ja nur das Allerwichtigste zeigen können. Es ist unendlich viel da. So viel aber werden Sie gemerkt haben: es fällt uns nicht ein, zu verkümmern, weil das Militär nicht mehr da ist. Gewiß, wir tun uns schwer. Aber wer im heutigen Deutschland tut sich leicht? Wir wollen uns nicht leicht tun, wir sollen uns nicht leicht tun. Wir haben einen energischen und weitblickenden Bürgermeister. Was unser Stadtbaurat kann, davon habe ich Ihnen nur ein paar Proben gezeigt. Sie haben den Sparkassenneubau gesehen, Sie haben gesehen, was er aus dem Treppenhaus der alten Universität gemacht hat. Was unser Stadtgartendirektor leistet – bitte, schauen Sie sich um: was Sie sehen, ist sein Werk. Aber wir fühlen uns trotzdem, Gott sei Dank, immer noch am Anfang. Wir wollen aus Ingolstadt eine Stadt machen, so blühend, so schön, daß keiner sagen kann, er kenne Bayern, wenn er Ingolstadt nicht gesehen hat. Und jetzt stoßen wir an aufs Wiederkommen!«
Ich glaube, herzlicher, begeisterter, überzeugter können nicht leicht drei Gläser zusammenklingen: »Vivat, floreat, crescat, die alte Schanz!«
Seeon, Baumburg, Rabenden
(1921)
Das kleine Dorf Rabenden liegt etwa zwei Stunden landeinwärts von Seebruck, dem nördlichsten Uferorte des Chiemsees, und ungefähr ebensoweit westlich von der netten Stadt Trostberg. Wer von Mühlberg nach Trostberg fährt und zu Fuß weiterwandert, über Altenmarkt, Baumburg, Rabenden, Seeon, den ganzen westlichen Teil des Chiemsees entlang, immer die Berge vor Augen, bis zum Winkel Schafwaschen-Rimsting, erhält landschaftlich immer schönere Eindrücke. Künstlerisch bleibt der edelste doch wohl die kleine Dorfkirche von Rabenden mit ihrem berühmten Altar.
Die alte romanische Basilika von Seeon liegt reizend mit ihrem Stufenaufgang zwischen niedrigen Häuschen und Schloß, dahinter der schlichte Kirchengiebel: Portal, Madonnenstatue und Fenster übereinander, und die zwei alten achteckigen Türme mit ihren Hauben, die an den Turm von Frauenchiemsee erinnern. Aber innen ist sie ein geschichtlich anziehendes, aber künstlerisch unerfreuliches Gemisch: spielerische spätgotische Gewölbe, an einer Wand eine blasse Spur mittelalterlicher Fresken, eine gotische Flachkuppel, wenigstens fürs Auge, alles barockisiert, die Farben nicht ohne Reiz, braune Rokokobeichtstühle, hilflose moderne Altäre, der übliche miserable Fabrik-Kreuzweg, zopfige Orgelbrüstung, die romanischen Säulen viereckig übermörtelt (an einer Stelle freigelegt), barock übermalt, weiß überkalkt. Am einheitlichsten wirkt der romanische Vorraum mit vorzüglichen Grabplatten aus Salzburger Marmor, wie allerorten im Rupertigau, wahre Meisterwerke darunter – wer sammelt sie, wer gibt sie heraus?
Nicht minder anziehend liegt die frühere Augustinerstiftskirche von Baumburg, weithin sichtbar und herrschend auf grüner Höhe über der Vereinigung des Tales der Traun mit dem der Alz. Der Raum ist weit und heiter, die barocken Schmuckstücke muß man nicht zu nah auf Stoff und Gestaltung hin ansehen, sondern sich des hellen, hohen Innern freuen und das Unzulängliche hinaus denken, die hölzernen Altäre, die Stucksäulen, die gestikulierenden weißen Heiligen. Was bleibt, ist immer noch bedeutend genug: die farbenfeinen Barockfresken des Gewölbes, der sinnvoll ausgesparte weiße Grundton der Wände, die rosageäderten Pilaster, die gelben Gurten, die eingezogenen Streben, das gute Verhältnis zwischen der Breite der Bögen im Schiff und der etwas größeren vorne, die Logen-Oratorien rechts und links – alles handwerklich tüchtig und gescheit, viel Verstand, der Instinkt geworden ist, gute Tradition noch im Oberflächlichsten. Ein malerisches Ding ist auch der kurze Kreuzgang auf der Südseite: rotmarmorne Grabplatten wiederum an heller Wand, Wappen, Köpfe, ein Ritter in voller Rüstung, darüber die weißen Kreuzgewölbe, dazwischen eine braune Tür, ein paar Blattpflanzen bringen ein wenig Grün hinein – alles hell und reinlich im nachmittägigen Licht; nicht zu vergessen des kapellenartigen Vorbaues aus Haustein: ein halbrundes Tempelchen für sich, von zierlichen Verhältnissen, Portal, je drei Säulen auf beiden Seiten vortretend, durch kleine Voluten mit der Halbkuppeltrommel verkröpft, klug und sicher der gegiebelten Stirnwand vorgesetzt.
Aber Rabenden übertrifft doch alles. Von außen eine Dorfkirche, wie man sie im Chiem- und Rupertigau aus den dunkelgrünen Nagelfluhblöcken dutzendweise findet. Auf dem grünen Rasen des Friedhofes über vierzig alte schmiedeiserne Grabkreuze in Reihen: ein ungewohntes Bild für den, der oberbayerische Friedhöfe kennt, wo Protzigkeit der Besteller und Geschmacklosigkeit der Handwerker meist nur alberne steinerne Hoffart zuwege bringen. Außerhalb des Gottesdienstes ist die Kirche zugesperrt: es ist in den letzten Jahren arg viel gestohlen worden aus unseren Landkirchen; aber der Bauer am Friedhofseingang läßt gern aufsperren. Das Innere ist äußerst schlicht; Grundriß, Größe, Verhältnisse annähernd wie in Blutenburg: Hochaltar, zwei auf den Seiten. Aber der Hochaltar, Salzburger Schule um 1570, ist einer der schönsten nicht nur Altbayerns. Von Renaissance ist in Südbayern auf dem Lande nicht allzuviel zu spüren; die Berührung beider Welten, der gotischen und des neuen Stils, ist gelegentlich köstlich fein, wie im Wolfdietrich-Sakramentshaus der nahen Wallfahrtskirche von Feichten. Aber im allgemeinen folgt auf unsere späte Gotik meist unvermittelt das Barock. Die Schnitzereien dieses so späten Altares sind prachtvoll; die Figuren so gut wie die Blutenburger, das Maß- und Rankenwerk fast so fein wie das vom Moosburger Kastulusaltar. Der Altar ist ein Schrein, der über einer Predelle steht, mit vier Flügeln, zwei starren und zwei beweglichen, seitlich rückklappbaren Türen und einem hohen geschnitzten Aufsatz mit Jesus, Maria und Johannes. Wenn er geschlossen ist, zeigen die unbeweglichen Flügel rechts und links je zwei Heilige, und die geschlossenen Schreintüren außen die vier großen Kirchenväter, wie auf der Rückseite des um 50 Jahre früheren Törring-Altars, der in St. Koloman ob Tengling am Tachinger See steht. Die Predelle weist rechts und links je einen Engel, der das Wappen der beiden Stifter hält: des Propstes von Brannenburg und des Pfarrherrn von Truchtlaching. Den Schrein selbst füllen drei hervorragend gut geschnitzte stehende Figuren auf Postamenten, über ihnen die zierlichsten spätgotischen Baldachine: Jakobus in der Mitte mit Pilgerstab und Muschelhut zwischen Simon und Judas Thaddäus. Die inneren Schranktüren zeigen je zwei Tafelbilder übereinander: Geburt und Tod Mariens, Geburt Christi und Anbetung der Könige. Auf der Rückseite ist das Weltgericht gemalt: in der Mitte der Heiland mit den posaunenden Engeln, links die Seligen, rechts der Höllenrachen. Ich habe mich schon öfter gefragt, ob spätgotische Altäre mit so kunstvoll bemalter Rückseite nicht auf Zapfen drehbar waren, so daß auf Allerseelen die Seiten vertauscht werden konnten. Bemerkenswert ist auch der Seitenaltar rechts, aus derselben Zeit und Schule, der den hl. Eustach darstellt, und der wandermüde Jakobus in der Ruhe an der Wand daneben. Unter ihm ist eine römische Gedenkplatte eingelassen, die die Duumvirn Pomponius Constans und Markus Ursinius ihrem kaiserlichen Gebieter Alexander Severus gewidmet haben, im Jahre 229, an der Nordgrenze des großen Römerreiches. Es ist noch mehr Antikes in der Gegend, oft an den weltabgeschiedensten Orten, wie in der kleinen Kirche von Freutsmoos, jenseits der Alz.
Der schöne Altar ist im allgemeinen gut erhalten; das Waschblau der gemalten Hintergründe hat das 19. Jahrhundert auf seinem kunstverständigen Gewissen. Das Verweilen in diesem einsamen Dorfgotteshaus tut sonderbar wohl. Gute Gotik, auch die späteste, ist immer sachlich, rechtschaffen und eigenartig; sie blendet nicht und macht nichts vor; dabei hat sie eine so andächtige Liebe zum unscheinbarsten, oft unsichtbaren Detail, so viel handwerkliche Treue und Charakter, daß das brillanteste Barock daneben nicht aufkommt. Aus dem unscheinbaren Kirchlein geht man erquickt hinaus wie nach einem Bad.
Kloster Au und Gars
(1921)
Das südliche Bayern ist reich an wenig gekannten Aussichtswarten, die in ihrer Art neben den berühmteren des Gebirges bestehen, wofern sie sie nicht an jener feineren landschaftlichen Schönheit, die man vorzugsweise »malerisch« nennt, übertreffen. Aber der Mühlberg bei Waging ist so wenig überlaufen wie der Kolomanshügel ob Tengling, beide mit schönstem Blick auf den friedsamen Waginger See; und nicht viel besuchter sind die Aussichten des Alztales: die Höhe über Altenmarkt, die Kirche von Baumburg, die Siegertshöhe über dem reizenden Trostberg und Schloß Wald. Am unbekanntesten verhältnismäßig ist das landschaftlich herrliche Inntal zwischen Rosenheim und Passau. Seine schönste Sehwarte, der Stampfl über Kloster Au, wird am seltensten aufgesucht und ist doch von all den genannten Höhen die herrschendste.
Denn wenn die Isarweite bei Wolfratshausen der ideale Willroider ist, so ist die riesige und einsame Innlandschaft vom Stampfl aus mit dem Namen eines Malers überhaupt nicht mehr zu bezeichnen, nicht einmal mit dem Hans Thoma. Sie steht, solange nicht einer den Beweis des Gegenteils erbringt, mit ihrer auf Details verzichtenden Größe jenseits des Malbaren, als Ganzes nicht mehr zu fassen und noch als Ausschnitt jedes Bild sprengend. So weit das Auge reicht, schwarzgrüner Wald und lichtgrüne Auen und dazwischen immer wieder eine blinkende Krümme der zahllosen, fast seeartigen Windungen des Inns mit gelben Steinwänden oder flaschengrünen Randspiegelungen, darüber ein Himmel, der in seiner unspannbaren Tiefe und Wolkenpracht dem Maler ein Entzücken und eine Verzweiflung zugleich ist, höher als der höchste Toni Stadler und breiter, unsagbar breiter, als die spätesten Haider.
Zu Füßen des Stampfl liegt das Kloster Au mit seiner Kirche; gegen Norden stießen Wald, Strom und Auen in den dunklen MühIdorfer Hardt, südlich schieben sich Hügel vor, die dem unendlichen Bild Halt verleihen und hinter denen das zweite der eingezogenen Augustiner-Chorherrenstifte liegt, von denen hier die Rede ist, Gars, nach Nord und West zu durch Steilhänge vor Wind und Kälte, nach Osten durch den Strom vor unerwünschter Annäherung geschützt wie Au, durch ähnliche Lage zu ähnlichen Geschicken vorherbestimmt, beide aus Anfängen sagenhafter Einsiedelei zu mönchischen Gütern und Ansehen gelangend, durch die Jahrhunderte wiederholt zerstört, zu neuem Glanze erhoben, vom Staat enteignet, jahrzehntelang öde, um dieselbe Zeit, wenn auch nicht ihrer ursprünglichen Bestimmung, so doch ähnlichen Aufgaben zurückgegeben und heute im Nachsommer ihrer tausendjährigen Schicksale ausruhend.
Beide sind die Gründungen jenes verschollenen Tassilo, dessen Gestalt, gleich derjenigen der Welfen, durch eine einseitig auf die Wittelsbacher eingestellte Geschichtsdarstellung uns nie recht sichtbar wurde, und Schöpfungen des Benediktinerordens, dessen Bedeutung für alles, was wir im wörtlichen und übertragenen Sinne Kultur nennen, nicht zu ermessen ist. Nicht weniger als sechzig größere und kleinere Mönchssiedlungen unterstellt Tassilo dem Stifte St. Peter in Salzburg, wie denn überhaupt von Anfang an in diesen Grenzlanden zwischen Mönchsberg und der Feste Oberhaus bayerische und ostmärkische Geschicke, aller zeitweiligen Trennung zum Trutz, immer wieder in eins stießen, weil es in der Tat derselbe Schlag und Stamm ist, der hüben und drüben wohnt, das gleiche Haus baut, die gleiche Sprache redet, die nämliche Tracht trägt, dieselben Lieder singt und dieselben Schicksale duldet.