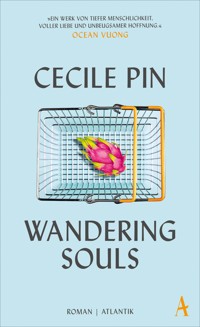
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Werk von tiefer Menschlichkeit, voller Liebe und unbeugsamer Hoffnung.« Ocean Vuong Dieser unvergessliche Roman erzählt die Geschichte der drei Geschwister Anh, Thanh und Minh, die nach Ende des Vietnam-Krieges Ende der Siebzigerjahre mit ihrer Familie in die USA fliehen wollen. Sie stranden in einem Lager in Hongkong, wo sie vergebens auf ihre Eltern warten. Plötzlich liegt es an der sechzehnjährigen Anh, für ihre Geschwister das Versprechen einer besseren Zukunft wahr werden zu lassen. Gemeinsam gelangen die drei nach England. Geplagt von der Schuld der Überlebenden und ohne die schützende Hand der Eltern, müssen sie in dem fremden Land lernen, auf sich selbst zu vertrauen, ohne sich einander zu verlieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cecile Pin
Wandering Souls
Roman
Aus dem Englischen von Maria Hummitzsch
Atlantik
Die gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gerschom; denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande.
2. Mose 2:22
Während ich ihre kleinen Körper beobachtete, fragte ich mich, wo genau in derartig kleinen Gefäßen die Trauer beherbergt wird.
Die roten Stellen
Maggie Nelson
Teil I
1November 1978 – Vung Tham, Vietnam
Es gibt die Abschiede und dann das Herausfischen der Leichen – alles dazwischen bleibt Spekulation.
In den Jahren darauf ließ Thi Anh die entsetzlichen Erinnerungen an das Boot und das Lager aus sich herauströpfeln, bis sie nur noch ein Flüstern waren. Diesen letzten Abend jedoch hielt sie mit aller Macht fest, angefangen bei dem Duft von dampfendem Reis in der Küche bis hin zu der Berührung der Haut ihrer Mutter, als sie sie das letzte Mal umarmte.
Ihre Mutter, erinnerte sie sich, kochte gerade ihr Lieblingsgericht, karamellisiertes Schweinefleisch mit Eiern, und summte Tous les garçons et les filles von Françoise Hardy. Zwar hatten die Franzosen Vietnam vor fünfundzwanzig Jahren verlassen, ihre Musik aber war noch immer präsent, Yéyé-Melodien erklangen in den Häusern des Dorfes Vung Tham. Im Zimmer nebenan packte Anh ihren Rucksack und überlegte, was sie mitnehmen und was sie zurücklassen sollte. »Pack nur das Nötigste ein«, hatte ihr Vater gesagt. »Auf dem Boot ist nicht viel Platz.« Sie drückte die Schuluniform an sich, ehe sie sie einsteckte, den Faltenrock und die weiße Bluse mit den Ärmeln, die deutlich zu kurz waren für ihre sechzehnjährigen Arme.
Ihre Brüder Thanh und Minh taten im Zimmer gegenüber das Gleiche, ihre Sachen lagen quer über den Fliesenboden verstreut, und sie hörte, wie sie miteinander stritten. Sie mussten sich einen Rucksack teilen, und Thanh fand, dass Minh weniger einpacken dürfe als er, da seine Kleidung etwas größer ausfiel, weil Minh dreizehn war und er zehn. »Deine Sachen nehmen viel mehr Platz weg. Es ist nur gerecht, dass ich mehr einpacken darf als du.« Ihre Mutter folgte dem Lärm und betrat das Zimmer, im Schlepptau den Geruch von karamellisiertem Fleisch. Als Thanh ansetzte, ihr die Angelegenheit zu erklären, versagte ihm die Stimme; durch den Ärger in ihrem Gesicht verpuffte sein banales Problem. »Tut mir leid«, murmelte er, und Minh grinste triumphierend. »Nicht so wichtig.«
Durch die offene Zimmertür sah Anh ihren jüngeren Bruder Dao, der den Streit von seinem Futon aus verfolgte. Ängstlich nestelte er an seiner Decke, das große blaue T-Shirt viel zu groß für ihn, ein Erbstück von Thanh. Anh wusste, dass er es nicht mochte, wenn sich seine Brüder stritten, aus Angst, eine Seite wählen zu müssen und den anderen zu verärgern. Von allen ihren Geschwistern machte sich Anh um Dao die meisten Sorgen. Sie machte sich Sorgen, wie sein Leben in Amerika aussehen und ob er trotz seiner Schüchternheit Freunde finden würde, wenn sie erst einmal dort wären. In den vergangenen Monaten hatte sie immer wieder versucht, ihn aus seinem Schneckenhaus zu locken, und ihn ermuntert, mit den anderen Dorfkindern am Banyanbaum Murmelspiele zu spielen. »Bitte nicht«, hatte er jedes Mal gesagt und sich halb hinter ihr versteckt. »Ich will lieber bei dir bleiben.« Ihre Mutter zog ihn vom Bett hoch, und mit den ausgestreckten Händen hielt er sich an ihr fest. »Komm, Dao«, sagte sie und nahm ihn auf den Arm. »Deine Brüder müssen noch zu Ende packen.« Gemeinsam verließen sie das Zimmer, und als sie bei Anh vorbeigingen, fragte ihre Ma: »Bist du fertig? Ich könnte deine Hilfe mit dem Abendessen gebrauchen.«
»Ja, Ma«, sagte Anh und stopfte die noch übrigen Kleidungsstücke vom Bett in den Rucksack. Kaum war sie den beiden in die angrenzende Küche gefolgt, setzte ihre Mutter Dao ab. »Kann ich auch helfen?«, fragte er. Die Mutter strich ihm zärtlich die Haare aus dem Gesicht und sagte: »Nein, für kleine Jungen gibt es heute Abend nichts zu tun. Du kannst zu deinem Vater ins Wohnzimmer gehen.« Dao nickte enttäuscht, und nachdem er Anh kurz aus seinen runden Augen angesehen hatte, ging er ins Wohnzimmer. Anh vermutete, dass ihre Mutter kurz allein mit ihr in der Küche sein wollte, um vor dem Aufbruch ihrer ältesten Tochter noch ein paar Augenblicke mit ihr zu erhaschen.
Ihr kleinster Bruder, das Baby Hoang, schlief in seinem Bettchen, beruhigt von den rhythmischen Kochgeräuschen, den scheppernden Pfannen und brutzelnden Ölen. Anh rührte im Schweinefleisch, während ihre Mutter leicht zittrig fermentierten Kohl klein schnitt. Es fühlte sich an wie eine Theaterszene; ein gewöhnlicher Abend unter der Woche, die Küche ihre Bühne, die Töpfe und Pfannen ihre Requisiten. Doch während die beiden in dem engen Raum hantierten, vermieden sie es, sich anzuschauen, und statt ihres üblichen Geschnatters hörte man nur gelegentlich eine Anweisung. »Pass auf, dass du auch die Reste am Boden erwischst«, oder: »Gib noch ein bisschen Nước chấm dazu.« Mehrere Male sah Anh, wie ihre Mutter den Mund öffnete, als wollte sie etwas sagen oder etwas loswerden, das sie bedrückte, doch immer entfuhr ihr nur ein Seufzen.
Ihre jüngeren Schwestern Mai und Van deckten den Tisch und jonglierten vorsichtig Stapel mit Schüsseln und Tellern in den kleinen Händen, ihre langen Haare wehten hinter ihnen her, und das Tapsen ihrer nackten Füße war kaum zu hören. Währenddessen wiederholten sie den Schulstoff des Tages. »Vier mal vier ist sechzehn; vier mal fünf ist zwanzig; vier mal sechs ist vierundzwanzig«, trällerten sie mit Singsangstimmen, bis eine von ihnen einen Fehler machte und die andere sie korrigierte. »Achtundzwanzig, nicht sechsundzwanzig«, sagte Van auf dem Weg zurück in die Küche zu Mai. Anh tat das Fleisch auf, wobei Dampf aus der Pfanne aufstieg, und reichte jeder eine Schale. Van und Mai trugen gern das Essen zum Tisch, denn so konnten sie ein wenig naschen, wie die Krümel auf ihren weißen Westen verrieten. Als sie außer Sichtweite waren, hörte Anh, wie Mai sagte: »Nicht so ein großes Stück«, woraufhin Van nur zischte: »Sei still.«
Hinten im Wohnzimmer saß ihr Vater mit gesenktem Kopf vor dem Familienaltar, während Dao von dem abgewetzten Ledersofa aufmerksam zu ihm hinübersah. Der Altar war mit gerahmten Bildern ihrer Großeltern geschmückt. Auf dem einen standen Ông nội und Bà nội mit der frisch geborenen Van im Arm vor ihrem Haus und schauten ernst in die Kamera. Im Hintergrund scharrten die Hühner der Nachbarn in der trockenen dunklen Erde Vung Thams, und zwischen ihrem Küchenfenster und der davor stehenden Palme baumelte die aufgehängte Wäsche. Auf einem anderen posierte Bà ngoại auf der Hochzeit ihrer Tochter neben einer verzierten Treppe, kleine Absätze am Fuß, einen Dutt im Haar. Und ein drittes zeigte eine Nahaufnahme von Ông ngoại, auf der er mit den weißen Zähnen und den leicht ergrauten Haaren wie ein alter Hollywoodstar aussah. Nach dem Fall von Saigon und dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten waren die vier in den vergangenen drei Jahren einer nach dem anderen gestorben, als wäre ein Windstoß durch welkes Laub gefahren. Zu diesem Zeitpunkt waren sie schon alt und schwach gewesen, und ihr Tod war nicht überraschend gekommen. Doch das schnelle Ende brachte Anh ins Grübeln, ob der Krieg eine Mitschuld trug und ob die Hoffnung ein Quell des Lebens war und ihr Versiegen ein Vorbote des Todes?
Mit dem Ärmel wischte Anhs Vater den Staub vom Porträt seiner Mutter und untersuchte im Kerzenlicht den Rahmen. Als es ihm schließlich sauber genug erschien, stellte er das Bild vorsichtig zurück zu den anderen und entzündete ein Räucherstäbchen. Er betete mit dem Stäbchen in der Hand, und kurz darauf kam ihre Mutter aus der Küche und kniete sich zu ihm. Auch sie entzündete mit einem Streichholz ein Räucherstäbchen, und während ihre Eltern gemeinsam beteten, hörte Anh, wie sie neben Thanhs und Minhs auch ihren Namen murmelten und um eine gute Reise für sie baten und um eine ruhige See. Dao stand vom Sofa auf, stellte sich neben sie und zog an der Bluse seiner Mutter. »Kann ich auch eins haben?«, fragte er, und sie reichte ihm ihr Räucherstäbchen und nahm sich ein neues. Zaghaft schloss er sich dem Gebet ihrer Eltern an, alle drei auf den Knien, unter den Augen ihrer Vorfahren. Wenig später erhob sich ihr Vater und klatschte in die Hände. »Zeit fürs Abendessen«, sagt er.
Das Abendessen blieb ihr in Erinnerung. Der Mondschein, der das Zimmer in sanftes Licht tauchte, die Gerüche von gedünstetem Kohl und Räucherstäbchen, die sich vermischten. Das aus dem Bettchen dringende leise Schnarchen des kleinen Hoang und ihre Mutter, die wegen seines unruhigen Schlafs immer wieder nach ihm sah. Der Tisch, an dem normalerweise lautes Gelächter und Geschrei herrschte, war in nervöses Schweigen gehüllt. Der matte Blick ihres Vaters ging alle paar Minuten hinunter auf seine Uhr. Ihre Mutter schnitt Daos Fleisch in kleine Stücke und ermahnte ihn, dass er langsam lernen müsse, wie man die Stäbchen richtig benutze. »Du bist kein Baby mehr«, sagte sie, als er den Kopf verlegen senkte.
»Ist schon okay«, flüsterte Thanh ihm zu. »Mit den großen Stücken kämpfe ich auch manchmal.« Mai und Van, die sonst mit Geschichten von ihrem Schultag übersprudelten, schoben das Essen hin und her, tasteten es jedoch nicht an. Auch wenn sie nicht ganz verstanden, was auf dem Spiel stand, verrieten ihnen die angespannten Gesten ihrer Eltern, dass dieser Abend ungewöhnlich und bedrückend war.
Um das Schweigen zu durchbrechen, bat Anh ihren Vater, den Plan ein letztes Mal zu wiederholen, und Minh stöhnte auf. »Noch mal? Den kennen wir doch schon auswendig.« Das stimmte. Es war ein einfacher Plan, den ihr Vater ihnen unzählige Male vorgetragen hatte und den sie sich jeden Abend vorm Einschlafen aufsagte, als würde sie für eine Prüfung lernen. Thanh, Minh und sie würden heute Abend nach Đà Nẵng aufbrechen, von wo sie ein Boot nach Hongkong bringen sollte. »Dort werdet ihr einige Zeit in einem Lager für Leute wie uns verbringen«, sagte ihr Vater, während Dao versuchte, seine Stäbchen so gut wie möglich zu kontrollieren, auf halbem Weg zwischen Mund und Schüssel jedoch Fleischstücke fallen ließ. Ihre Schwestern hatten den Kopf in die Hände gestützt, gelangweilt von dieser schon tausendmal gehörten Geschichte. Den Bootsführer habe er bereits bezahlt, zwölf Goldstücke pro Person. »Darum müsst ihr euch also nicht mehr kümmern«, sagte ihr Vater. »Wir anderen stoßen dann in ein paar Wochen im Lager zu euch, und dann machen wir uns zusammen auf den Weg nach Amerika und treffen in New HavenOnkel Nam.«
Er erklärte den Plan immer ohne den Hauch eines Zweifels, und Anh fragte sich, ob er seine Sorgen überspielte oder tatsächlich so zuversichtlich war. Sie beobachtete, wie er zwischen spärlichen Happen Reis und Fleisch ein weiteres Mal die Reise beschrieb und mit dem Finger eine Karte auf den Tisch zeichnete. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, seine Autorität anzuzweifeln oder wie viel er tatsächlich wusste. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, dass sein Bruder und die Schmuggler ihm Lügen aufgetischt und die gewaltigen Risiken unterschlagen haben könnten. Vor Kriegsende hatte ihr Onkel Nam mit seiner Frau und den beiden Kindern die gleiche Reise unternommen und in ihrem Vater den Wunsch entfacht, Vietnam zu verlassen. Was zunächst nur ein Funke gewesen war, entwickelte sich schon bald zu einem Flächenbrand, genährt von jedem Brief von Nam mit einem Stempel der amerikanischen Flagge und Details aus seinem opulenten neuen Leben voller gigantischer Supermärkte, Fords und Chevrolets. Aus der Idee ihres Vaters war eine Obsession geworden, die ihn taub für die Bedenken ihrer Mutter machte und blind für die Härten der Reise.
Da Anh, Minh und Thanh die drei Ältesten waren, hatten ihre Eltern beschlossen, dass sie auf einem separaten Boot vorfahren sollten, was die Familie in zwei Hälften teilte. Nie wäre Anh in den Sinn gekommen, dass diese Teilung das erste Anzeichen einer Gefahr war und der erste Hinweis darauf, dass ihr Vater wusste, eine Hälfte könnte untergehen.
Kaum war die Dämmerung hereingebrochen, küsste Anh den kleinen Hoang auf die Stirn und nahm Mai, Van und Dao, alle schon im Halbschlaf und reif fürs Bett, zum Abschied in den Arm. Sie hätte sie gern noch länger festgehalten und so eng an sich gedrückt, dass ein Stück ihrer Seele in ihr Herz eingedrungen wäre. Doch sie wusste, vor ihr lag eine lange Nacht, und das Boot in Đà Nẵng würde nicht auf sie warten, also ließ sie los und wandte sich an ihre Mutter.
»Pass auf deine Brüder auf«, sagte ihre Ma und reichte ihr drei Pakete Proviant mit den Resten des Abendessens. In die noch freie Hand drückte sie ihr ein kleines Familienfoto, das ihr Nachbar beim letzten Tết aufgenommen hatte. Anh nahm das Bild und betrachtete ihre ernsten Mienen. Dicht gedrängt saßen sie alle in ihren besten Áo dàisauf dem Wohnzimmersofa, Mai, Van und Anh einheitlich in Rosa und die Jungen in hellem Blau. Ihre Eltern befanden sich rechts und links außen, ihre Mutter hochschwanger mit Hoang. Mai und Van saßen auf dem Schoß ihrer Eltern, Dao in der Mitte auf dem von Anh, den Kopf zur Seite geneigt, damit er sie nicht verdeckte. Thanh und Minh saßen rechts und links von ihnen, die Arme um ihre jüngeren Schwestern gelegt. Sie hatten sich sehr bemüht, der Bitte ihres Vaters nachzukommen, sich nicht zu bewegen oder zu blinzeln, da sie sich keine zweite Aufnahme leisten konnten. Angestrengt starrte Anh auf jedes der Gesichter, aus Angst zu weinen, wenn sie aufhören würde, sich zu konzentrieren. »Wir sehen uns in ein paar Wochen«, sagte ihre Mutter, woraufhin Anh den Blick von dem Foto löste und es in den Rucksack steckte.
Sie umarmte ihre Eltern ein letztes Mal und wartete, dass Thanh und Minh das Gleiche taten. Sie erinnerte sich später an die stoische Haltung, die sie alle eingenommen hatten, daran, wie sie geglaubt hatte, dass jedes Aufblitzen einer Emotion es ihnen unmöglich machen würde, einander gehen zu lassen. »Bleibt immer zusammen, egal, was passiert«, sagte ihr Vater, und durch die Dringlichkeit in seiner Stimme verstand sie, dass es keine Bitte war, sondern ein Befehl. Er klopfte Minh ein letztes Mal auf die Schulter und strich Thanh sanft über den Kopf, den Blick auf seine zwei ältesten Söhne gerichtet, als sähe er sie zum ersten Mal, nahm ihre Gesichtszüge in sich auf und prägte sie sich ein. »Seid gut zu eurer Schwester.«
Dao, den Daumen im Mund, klammerte sich an seine Mutter, und Mai gähnte kurz, während sie ihnen zaghaft zum Abschied winkte. »Hast du Angst?«, fragte Van Anh, als sie besorgt und misstrauisch in die Nacht hinaussah, die ihre drei älteren Geschwister erwartete, die wenigen Sterne, die über ihrem Dorf wachten, die Blätter an den Bäumen, die sich zum Zirpen der Grillen im Wind wiegten. »Es ist so dunkel draußen.«
Anh zögerte kurz. »Nein«, sagte sie. »Alles wird gut, du wirst schon sehen.« Und ihr Leben lang bedauerte sie, dass die letzten Worte, die sie an ihre Familie gerichtet hatte, eine Lüge gewesen waren, falsche und nutzlose Worte der Besänftigung. Nachdem sie ihren Eltern ein letztes Mal zugenickt hatte, nahm sie Thanh und Minh an die Hand, und zusammen verließen sie ihr Zuhause und nahmen die staubige Straße nach Norden. Ihre Familie schaute zu, wie die drei ältesten Kinder fortgingen, bis die Schwärze der Nacht sie völlig verschluckte und nur noch die Schatten von Vung Tham zu sehen waren.
Drei Monate später stand Anh an einem Strand an der Südküste Hongkongs, ihre Füße im Sand heiß trotz der frühmorgendlichen Brise, die Hand des Polizisten aufdringlich, aber zugleich beruhigend auf ihrer Schulter. Ein Arzt zog die Laken zurück, die die ordentlich im Sand aufgereihten Leichen vor ihnen bedeckten, eines nach dem anderen. Ihr Blick huschte über die Gesichter, die darunter zum Vorschein kamen, bis sie auf die leblosen Körper ihrer Eltern und Geschwister niedersank. Sie bestätigte dem Polizisten und dem Arzt, dass sie zu ihnen gehörten. Später im Leben ärgerte sie sich manchmal, dass man ihre Familie überhaupt herausgefischt hatte. Ohne Leichen hätte es unzählige Möglichkeiten gegeben: die Möglichkeit des Lebendigseins, der Wiedervereinigung und des Glücks.
Dao
Das Boot war überfüllt und stank. Ich saß bei meinem Vater auf dem Schoß. Ich hatte Meerwasser in die Augen bekommen, weshalb sie brannten, und meine nassen Sachen klebten mir auf der Haut, weshalb ich fror. Meine Schwestern saßen rechts und links neben meiner Mutter und klammerten sich an ihre Arme, in denen sie meinen kleinen Bruder Hoang festhielt.
Vier Tage davor waren wir in tiefschwarzer Nacht aus Vung Tham weggegangen und hatten uns auf den langen Weg nach Norden gemacht. Als wir nach einem Tag an die Küste von Đà Nẵng kamen, waren unsere Füße voller Blasen und bluteten so doll, dass es den Boden von dem Boot beim Einsteigen rot färbte.
Natürlich habe ich Geistergeschichten gehört, als ich noch am Leben war.
Es gab den Geist von meinem Großvater Ông ngoại,
dem wir zu Hause Mangostanfrüchte
und Zigaretten
neben das Porträt und die brennenden Duftstäbchen auf den Altar legten.
Es gab Thần làng, den Dorfgeist,
dessen nasse Kleidung noch immer tropft,
was die Kinder hören, wenn sie am Ufer des Sees spielen,
der ihn vor hundert Jahren
verschluckt hat.
Aber ich habe mir Geister immer als alte, weise und lustige Wesen mit langen Bärten und runzliger Haut vorgestellt. Siebenjährige Geister gab es nicht in meiner Phantasie,
und trotzdem bin ich hier.
Ich erinnere mich an kaum was von meinem Tod. In der Nacht davor gab es einen Sturm; von den krachenden Wellen schaukelte das Boot, und die Schreie meines Babybruders erstarrten. Ich erinnere mich, wie uns der Bootsführer am nächsten Tag sagte, dass wir vom Kurs abgekommen und nach Süden gedriftet seien und einen Tag länger bis Hainan brauchen würden.
Ich erinnere mich an Fischer,
die eine fremde Sprache sprechen,
die Klingen ihrer Messer glänzen
in der Morgensonne.
Dann kam die Schwerelosigkeit, als ich meinen Körper verließ und die Schwerkraft mich. Ich trieb auf einem Meer aus Weiß, bis mein kleiner Bruder und mein Vater zu mir stießen und meine Schwestern und meine Mutter. Dann löste sich das Weiß auf wie Nebel, wenn er das Tageslicht aufziehen sieht,
und ich konnte das Boot von oben sehen,
nur dass es jetzt in den Wellen versunken war
und überall drumherum Leichen trieben.
2Dezember 1978 – Südchinesisches Meer
Acht Tage nachdem sie Vung Tham verlassen hatten, trieben Anh, Thanh und Minh mit eingefallenen Wangen und tiefliegenden Augen an die Südküste von Hainan, ihre Kleidung vom Sturm des Vortags in Fetzen gerissen und durchnässt. Minhs Arm blutete vom Herumgeworfenwerden in der rauen See, und Anh hatte ihm aus einem T-Shirt einen Verband gemacht. Zusammen mit den dreißig anderen Insassen stieg sie aus dem Boot und tat ein paar verlorene Schritte, ehe sie sich in den warmen Sand legte, im Versuch, das Zittern zu stoppen. Als sich ihre Brüder zu ihr setzten und die Sonne ihr Gesicht berührte, sah sie die Palmen entlang der Küste und das ruhige blaue Wasser, das sie in der Nacht zuvor fast getötet hatte. Weiße Klippen und grün bewachsene Berge säumten den Horizont, und sie erkannte, dass sie an einem Ort voller Schönheit gestrandet waren. »Ich hatte keine Ahnung, dass China so aussieht«, sagte Minh.
Ein Dutzend Dorfbewohner kam aus dem Landesinneren mit Flaschen und Werkzeugen herbei. Sie rannten zum Bootsführer, der ihnen, so Anhs Vermutung, ein Säckchen mit Goldmünzen gab. Im Gegenzug machten sich ein paar an die Reparatur des Boots, während andere Wasser an die Passagiere verteilten. Anh bemerkte eine alte Frau, die vor einem Haus stand und aus der Ferne zu den dreien herübersah. Ihr Blick war freundlich, und Anh stellte sich vor, wie sie wohl auf sie wirkten, zusammengerollt und zitternd, ihre Kleidung zerfetzt und die Augen vom Meerwasser gerötet. Sie richtete sich auf, sodass sie im Sand saß, und streckte den Rücken durch, doch als sie wieder hinübersah, war die Frau verschwunden.
Später döste Anh, bis eine sanfte Berührung an der Schulter sie weckte. Die alte Frau stand mit einer Schüssel Rambutans über sie gebeugt und reichte sie ihr mit demselben mitleidsvollen Gesichtsausdruck von eben. Sie richtete Worte an sie, die Anh nicht verstand, und Anh begriff, dass sie und ihre Brüder es geschafft hatten, dass sie sich nun auf fremdem Land befanden und weiter von zu Hause entfernt waren als je zuvor. Während die Männer und Passagiere mit der Reparatur des Bootes beschäftigt waren, schlängelten sich die ersten Anzeichen von Heimweh in ihr dahin wie giftige Schlangen. Ihre Brüder saßen im Sand und aßen die Früchte, der Saft tropfte ihnen aufs Kinn. Vorsichtig nahm Anh das Familienfoto aus dem Rucksack. Das Wasser hatte das Bild durchtränkt, und die Hälfte der Farbe war verschwunden, ebenso wie ihr Gesicht und das ihrer Brüder, ersetzt durch weiße und gelbe Streifen, die sich quer über das Bild zogen. Unter den schwarzen Flecken, die den Rest des Bildes übersäten, waren ihre Eltern und Mai und Van kaum noch zu erkennen. Wie betäubt starrte sie auf ihre entstellten Gesichter, als könnte sie sie so zurückholen, ehe sie das durchweichte Foto wieder in den Rucksack steckte, sehr bemüht, die Ecken nicht zu knicken.
Nach dem Verspeisen der Früchte waren die Reparaturen abgeschlossen, und im Bemühen, das gute Wetter zu nutzen, scheuchte der Kapitän alle zurück zum Boot. Die Menschen rings um Anh erhoben sich mit wiederbelebter Hoffnung vom Sand, das Schlimmste nun hinter ihnen. Sie sah Väter, die ihre schlafenden Kinder trugen, eine Mutter, die ein Schlaflied summte, während sie ihr Baby mit der wenigen Milch stillte, die sie noch hatte. Anh und ihre Brüder standen auf, und als sie an Bord gingen, hielt Anh umsonst Ausschau nach der Fremden, die ihnen mit Freundlichkeit begegnet war. Mit Bedauern fuhr sie ab, ohne sich verabschieden zu können.
Zwei Tage später erreichten sie die Küste von Hongkong, ihr verrottetes und geborstenes Boot krachte am Südufer der Insel Lantau würdelos auf den Strand. Ein Polizeiboot steuerte sie an, die Beamten an Board schrien. »Wo kommt ihr her?«, fragten sie den Bootsführer. Sie sprachen Englisch, was Anh zum Teil verstand, weil ihr Vater in Vung Tham Englisch unterrichtet hatte. Nach einem kurzen Wortwechsel untersuchten die Polizisten die Insassen mit Erste-Hilfe-Sets in der Hand. Einer von ihnen, der weder schroff noch freundlich war, nahm Minh den Verband ab und trug eine Salbe auf dessen Wunde auf, von der Minh vor Schmerzen das Gesicht verzog. Der Polizist erneuerte den Verband und schenkte den Geschwistern ein paar trockene Kekse und einen Packen Milch, dessen Inhalt sie hastig hinunterstürzten.
Sie wurden in einen Bus verfrachtet und zu einer Werft gebracht, überdacht mit langen Balken und zerfledderter grauer Plane, durch deren Löcher man den Himmel schimmern sah. Der Gestank aus Schweiß und Dreck und die Menschenmassen dort überwältigten Anh. Sie zitterte wieder, die Feuchtigkeit und die Kälte des Orts drangen ihr in die Knochen. Auf dem Boden lagen dicht an dicht Männer und Frauen jeden Alters auf behelfsmäßigen Matten. Manche schliefen, andere spielten Karten und sahen beim Eintreten der Neuankömmlinge auf. Ärzte liefen in der Werft umher, horchten die Lungen ab und schauten den Untergebrachten in den Mund. Zwischen den Metallpfeilern, die den Raum durchzogen, hingen Wäschestangen mit nasser Kleidung, Wassertropfen trafen in einem symphonischen Rhythmus auf den Boden. Es mussten über hundert Menschen gewesen sein, und trotzdem herrschte drückende Stille, jeder Schritt der Geschwister hallte durch den riesigen Raum. Ein Polizist brüllte auf Kantonesisch. Er zeigte in eine Ecke, wiederholte seine Worte und zog jedes einzelne in die Länge, als würde die Langsamkeit ihnen helfen, ihn zu verstehen. Und als sie sich noch immer nicht in Bewegung setzten, sondern ihn nur verängstigt anstarrten, verdrehte er die Augen und führte sie zu einer Wand im hinteren Teil der Werft.
Dort erwartete sie eine zerfledderte Matte, auf die Anh ihren Rucksack fallen ließ. Neben ihnen saß eine vierköpfige Familie. Der Vater hielt das jüngste Kind im Arm, die Mutter schluchzte, und die Tochter streichelte ihr still den Kopf. Auf der anderen Seite der Geschwister saß ein junger Mann Anfang dreißig. Er sah zu, wie sie sich auf ihrer Matte niederließen und die neue Umgebung in sich aufnahmen. Anh spürte, wie er ihre nervösen Bewegungen beobachtete, die Art, wie sie langsam die Matte abtasteten und sich auf den Rand setzten. Der Polizeibeamte kam wieder zurück und brüllte ihr Wörter entgegen, die sie nicht verstand.
»Er will wissen, woher ihr seid«, sagte der junge Mann, der neben ihr saß. Anh drehte sich zu ihm um. Sie bemerkte eine große Narbe auf seiner Stirn, die seine Augenbraue in zwei Hälften teilte.
»Vung Tham«, sagte sie. »Südliches Zentralvietnam.«
Der Mann dolmetschte für sie, und der Beamte nickte, kritzelte etwas auf ein Blatt Papier und ging.
»Sprechen Sie Kantonesisch?«, fragte Minh, und der Mann lachte.
»Na klar. Das tun viele von uns. Wir sind Hoa.«
»Wo sind wir?«, fragte Anh und versuchte, ihre Angst zu verbergen.
»Wir sind in Quarantäne«, sagte er. »Man behält euch für zwei Wochen hier. Und was danach kommt, keine Ahnung.«
Die vier verstummten. Die Brüder schauten erwartungsvoll zu Anh, wie Soldaten, die auf den nächsten Befehl warten. Aber auch sie war unsicher, was sie mit dieser neuen Information anfangen sollte. Von diesem Teil hatten ihr ihre Eltern nichts erzählt, von Werften und Matten mit Kotspuren oder davon, wie ohrenbetäubend laut das kollektive Schweigen einer Menschenmenge ist. Sie betrachtete die Menschen um sich herum und begriff, dass sie eine von ihnen geworden war, obdachlos, stinkend und schwach, ein Überträger von Krankheiten, und dass man sie nun als Ungeziefer ansah. Eine Frau kam und besprühte ihnen die Haare mit weißem Pulver, von dem sie husten mussten.
»Zum Entlausen«, sagte sie und ging schon weiter zur nächsten Gruppe Neuankömmlinge.
»Kein Grund, so traurig zu gucken«, sagte der junge Mann, als er Anhs, Thanhs und Minhs morbide Gesichter sah. »Schätzt euch glücklich, dass ihr es geschafft habt. Manchmal lassen sie unsere Boote nicht mal an Land.« Er schubberte sich die Haare, und Schuppen rieselten heraus.
»Was passiert, wenn sie es nicht tun?«, fragte Thanh mit seiner piepsigen Stimme. Der Mann zuckte mit den Schultern und schaute weg.
»Sie müssen den ganzen Weg zurück nach Vietnam fahren.«
Anh starrte auf einen gelben Fleck in einer Ecke der Matte. Der Mann schaute wieder zu den Kindern, diesmal mit mehr Mitgefühl, den Hauch eines Lächelns im Gesicht.
»Alles wird gut«, sagte er. »Hustet nur ja nicht vor den Polizisten. Und wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann macht ihr das hier, wenn ihr sie seht.«
Er kniff sich in die Wangen, und sie erstrahlten in sattem Rosa. Anh war sich nicht sicher, ob sie nicken oder lachen sollte, ob es ein Scherz war oder eine Frage von Leben und Tod. Die Mutter links von Anh stieß einen lauten, durchdringenden Schrei aus. Alle drehten sich um und starrten sie an. Die Tochter streichelte ihr weiter über den Kopf, und ihr Mann versuchte nervös, sie zu beruhigen, sein Blick glitt ängstlich von links nach rechts.
»Warum weint sie?«, fragte Thanh den Mann, dessen rosa Wangen wieder erblassten. Der Mann schaute gequält. »Ihr Baby ist letzte Nacht gestorben«, sagte er. Er sah zu Boden, nestelte mit den Fingern. Er fuhr auf seiner Matte herum, drehte den Kindern den Rücken zu und beendete das Gespräch.
Minh rutschte näher an Anh heran und flüsterte ihr ins Ohr, damit Thanh ihn nicht hören konnte: »Was, wenn sie das Boot von Ma und Pa nicht an Land lassen?«
Sie nahm seinen Arm und kontrollierte, wie die Wunde unter dem Verband heilte.
»Dazu wird es nicht kommen«, sagte sie. Und nach einer Pause sagte sie es noch einmal, mehr zu sich selbst als zu ihrem Bruder. »Dazu wird es nicht kommen.«
Minh stellte ihre Beteuerung nicht in Frage, vielleicht weil er die Antwort erhalten hatte, die er sich wünschte; die Logik dahinter interessierte ihn nicht. Sie besahen sich die Lage in der Werft: die noch immer schluchzende Mutter und die Polizisten, die auf dem Gelände patrouillierten und gelegentlich ein Fremdwort brüllten. Ein anderer, freundlicher Polizist kam zu ihnen. Er hielt einen Stapel Kleidung in der Hand und reichte ihn Anh. »Hier«, sagte er. »Die halten euch warm.«
»Danke«, flüsterte Anh und nahm die Kleidung entgegen. Minh legte sie eine Anzugjacke um die Schulter, und Thanh gab sie einen kratzigen Pullover.
»Wir sollten versuchten zu schlafen«, sagte sie und zog sich eine graue Strickjacke über. »Wir haben auf dem Boot nicht viel Schlaf bekommen.«
Anh sah ihren Brüdern das Entsetzen an und dass auch sie sich fragten, wie sie die nächsten zwei Wochen in dieser Werft leben sollten – ihr Gehirn von dem desolaten Zustand wie betäubt –, während sie auf ihre Eltern und Geschwister warten würden. Thanh legte den Kopf auf Anhs grummelnden Bauch, und Minh umschlang ihren Arm. Es dauerte nicht lange, da waren sie alle eingenickt und schliefen.
22. November 1979 – Insel Koh Kra, Thailand
Berichten zufolge wurden 17 vietnamesische Flüchtlinge, darunter auch Kinder, auf der Insel Koh Kra im Golf von Thailand von Fischern ermordet. Mutmaßlich waren diesen Monat 500 thailändische Fischer über einen Zeitraum von 22 Tagen an der Vergewaltigung von 37





























