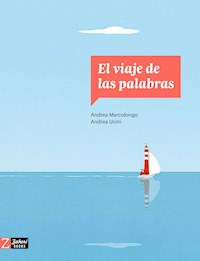10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Altgriechisch ist ebenso außergewöhnlich wie erstaunlich und nicht die tote Sprache, für die wir sie halten – das hat Andrea Marcolongo erkannt. Ihr kluges und überraschendes Buch über die Sprache der antiken Griechen ist kein Lehrbuch und keine Grammatik, sondern eine Liebeserklärung an die Fähigkeit des Altgriechischen, unsere Wahrnehmung zu verändern. Es ist eine Entdeckungsreise zu den faszinierenden Besonderheiten dieser Sprache, die das damalige Weltbild maßgeblich beeinflusst haben. So kannten die antiken Griechen zum Beispiel keinen Zeitdruck, da Wörter wie früh, spät, gestern oder morgen keine Rolle spielten. Oder sie hatten die Möglichkeit, der Zweisamkeit mit dem Dual eine ganz eigene Bedeutung zu geben. Andrea Marcolongo bringt uns die Magie des Altgriechischen nahe und zeigt uns, was wir von den antiken Griechen lernen können, selbst wenn wir ihre Sprache nicht sprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Livorno,
für Sarajevo,
für mich
Übersetzung aus dem Italienischen von Andreas Thomsen
ISBN 978-3-492-99064-6
Deutsche Erstausgabe
© 2016, Gius. Laterza & Figli
mit Unterstützung von Maria Cristina Olati
Titel der italienischen Originalausgabe: »La lingua geniale«, bei Editori Laterza, Bari/Rom, 2016
© Piper Verlag GmbH, München, 2018
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: iStockphoto und Archiv Büro Jorge Schmidt
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Vorwort
Einführung
Wann, jemals, niemals. Der Aspekt
Anmerkungen
Das Schweigen des Altgriechischen. Klänge, Akzente, Spiritus
Anmerkungen
Drei Geschlechter, drei Numeri
Die Fälle oder ein geordnetes Durcheinander der Wörter
Anmerkungen
Ein Modus namens Wunsch. Der Optativ
Anmerkungen
Und wie übersetzt man nun?
Das Altgriechische und wir. Eine Geschichte
Bibliografie
Dank
Anmerkungen
Textnachweise
Vorwort
Keine Geschichte ist einzigartig und ausschließlich persönlich, denn in jeder Geschichte sind andere verborgen, die sie zu einer Art Gemeingut machen, sie mit der Welt und folglich auch mit der Literatur verbinden. Ebenso verhält es sich mit der Geschichte dieses Buches.
Warum Altgriechisch genial ist ins Deutsche übersetzt zu sehen ist für mich wie ein Wunder und versetzt mich noch immer in Erstaunen, wenn ich an die Monate im Frühling 2016 zurückdenke, als ich daran schrieb. Meine Verbindung zum Piper Verlag begann bereits damals, denn es war ein Buch von Piper, das ich in den Händen hielt, während ich begann, mein erstes eigenes zu verfassen.
Ich stand kurz vor meinem dreißigsten Geburtstag und las allabendlich in dem erstmals von Piper im Jahr 1961 veröffentlichten Meisterwerk Ingeborg Bachmanns Das dreißigste Jahr. Es war vor allem ein Absatz, den ich immer wieder in mein Notizbuch schrieb und mir in Erinnerung rief:
»Nie hatte er einen Augenblick befürchtet, daß der Vorhang, wie jetzt, aufgehen könne vor seinem dreißigsten Jahr, daß das Stichwort fallen könne für ihn, und er zeigen müsse eines Tages, was er wirklich zu denken und zu tun vermochte, und daß er eingestehen müsse, worauf es ihm wirklich ankomme. Nie hat er gedacht, dass von tausendundeiner Möglichkeit vielleicht schon tausend Möglichkeiten vertan und versäumt waren – oder daß er sie hatte versäumen müssen, weil nur eine für ihn galt.«1
Heute bin ich einunddreißig und weiß, dass von den tausend Möglichkeiten nur eine einzige für mich bestimmt war, nämlich endlich Schriftstellerin zu werden und die Geschichte meiner größten Liebe zu erzählen. Der Liebe zum Altgriechischen.
Niemals hätte ich gedacht, dass diese Geschichte einmal bei Piper erscheinen würde.
»Übersetzen« bedeutet, den Leser an die Hand zu nehmen und ihn über seine eigene Gedankenwelt hinaus- und durch eine unbekannte Sprache hindurchzuführen, um den Zauber der fremden Worte zu entschleiern und sie Wirklichkeit werden zu lassen.
Darum empfinde ich es als wahrhaft magisch, meine eigenen italienischen Worte über das Altgriechische, das Virginia Woolf 1905The Magic Language nannte, nun im Gewand einer anderen, der deutschen Sprache zu sehen.
Es ist, als hätte die einzigartige Weltsicht der antiken Griechen – ihre besondere Art, mit der Zeit umzugehen, Wünsche auszudrücken, von der Liebe zu sprechen, oder ihre Fähigkeit, mithilfe der Sprache Geschlechterschranken zu überwinden – eine weitere Reise angetreten, die sie dieses Mal durch Deutschland führt.
Auch dank des Deutschen, das bis heute vier Fälle und das Neutrum bewahrt, setzt das Altgriechische seinen Weg wie einst Odysseus fort. Es ist nun schon über zweitausend Jahre unterwegs und kann noch immer etwas beitragen zur Suche nach dem Zuhause unserer Worte, das wir heute so oft nicht mehr finden: unser sprachliches Ithaka.
Kein Reisender kommt ans Ziel, ohne sich mit der Vielfalt auseinanderzusetzen, die ihm unterwegs begegnet. Und obwohl es dem Deutschen in mancherlei Hinsicht recht nahesteht, unterscheidet sich das Altgriechische dennoch ganz wesentlich von allen anderen Sprachen dieser Welt. Darum übt es auch eine so große Anziehungskraft auf uns aus, wie eine Liebe, die wir nie gelebt, aber stets herbeigesehnt haben.
Es spielt keine Rolle, ob ihr Altgriechisch könnt oder nicht. Dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, die nach Worten suchen, um sich selbst in der Gegenwart zu verorten. Es ist also kein herkömmliches Handbuch und enthält auch keine von oben herab erteilten Lektionen. Es ist vielmehr eine Syntax der Seele, vermittelt durch eine sehr alte und zugleich zeitlos moderne Sprache.
Mit diesem Buch ist das Altgriechische, das ich immer geliebt habe, zu mir zurückgekehrt. Und nun kehrt es auch zu euch, den Lesern zurück, in eure Art zu denken, in eure Worte und täglichen Gesten. Es kommt zurück und war eigentlich niemals wirklich fort, denn klassisch bedeutet nicht antik, klassisch ist etwas, das niemals aufhört, uns etwas zu sagen zu haben, wie es der italienische Schriftsteller Italo Calvino ausdrückte. Und in diesem Buch hat das Altgriechische euch eine Menge zu sagen – und zu fragen.
Warum Altgriechisch genialist soll etwas zeigen, das mir klar geworden ist, als ich mich als junges Mädchen ins Altgriechische verliebte und es zum Kompass für mein Leben erkor, um mich von ihm durch die Freuden und das Leid einer widersprüchlichen Welt führen zu lassen: Es gibt keine toten oder lebenden Sprachen, aber es gibt fruchtbare – so fruchtbar wie das Altgriechische, das Teil eurer eigenen Muttersprache und damit Teil von euch selbst geworden ist.
Am Ende der Lektüre werdet ihr vielleicht so etwas wie Heimweh empfinden. Nicht unbedingt nach dem antiken Athen, aber nach einer Art, die Welt zu sehen und sie in Worte zu fassen, so klar, so scharf, so aufrichtig und so sehr auf das menschliche Maß zugeschnitten, wie es nur das Altgriechische vermochte.
»Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele«, sagt Platon. Ich hoffe, dass auch ihr bei der Lektüre meiner neuartigen Geschichte des Altgriechischen auf unverfälschte und aufrichtige Weise mit euch selbst sprechen könnt.
Sarajevo, den 14. August 2017
Einführung
Das Meer verbrennt die Masken,
Von salzenen Feuern entflammt.
Menschen voller Masken
Lodern am Strand.
Widerstehen wirst Du allein
Den Bränden des Karnevals.
Ohne Masken Du allein
Verbirgst die Kunst des Seins.
Giorgio Caproni,
aus Cronistoria
»Um so merkwürdiger ist es dann, dass wir wünschen, Griechisch zu lernen, versuchen, Griechisch zu lernen, ewig uns hingezogen fühlen zum Griechischen und ewig uns irgendeine Vorstellung vom Sinn des Griechischen zurechtmachen, aus welch abstrusen Fetzen und Resten allerdings, von wie entfernter Ähnlichkeit mit dem wirklichen Sinn des Griechischen, wer vermag das zu sagen«, schreibt Virginia Woolf.2 »Da wir in unserer Unwissenheit in jeder Klasse von Schuljungen auf der hintersten Bank säßen, da wir ja nicht wissen, wie die Worte klangen oder wo genau wir zu lachen hätten«.3
Auch ich bin merkwürdig – sehr merkwürdig.
Und ich bin ihr dankbar, meiner Merkwürdigkeit, denn sie hat mich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben, ohne dass es einen konkreten Anlass dafür gegeben hätte. Wie alle schönen Dinge des Lebens ist es einfach so passiert. Es ist ein Buch über das Altgriechische, um das ich mich stetig bemüht habe und von dem ich nun erzählen möchte.
Und zwar euch. Denn auch wenn ich noch immer eine Hinterbänklerin bin, weiß ich inzwischen immerhin, wo wir lachen müssen.
Tote Sprache und lebende Sprache.
Qual des Gymnasiums und Abenteuer des Odysseus.
Übersetzung oder Hieroglyphen.
Tragödie oder Komödie.
Verstehen oder Missverstehen.
Liebe oder Abneigung, vor allem.
Aufstand mithin.
Griechisch zu begreifen ist keine Frage der Begabung, sondern der Streitbarkeit – genauso wie das Leben.
Ich schrieb diese Zeilen, weil ich mich als junges Mädchen ins Altgriechische verliebt habe. Alles in allem ist es die längste Liebe meines Lebens.
Inzwischen bin ich eine erwachsene Frau und möchte versuchen, denjenigen etwas von dieser Liebe zu geben (oder zurückzugeben), die dem Altgriechischen gleichgültig gegenüberstehen. So gut wie allen also, die sich während ihrer Schulzeit damit abmühen mussten. Und ich möchte erreichen, dass sich diejenigen, die diese Sprache im Grunde gar nicht kennen, ebenfalls in sie verlieben.
Ja, in diesem Buch geht es in erster Linie um Liebe. Um die Liebe zu einer Sprache und zu jenen, die sie sprechen. Oder, da niemand mehr sie spricht, zu all jenen, die sie studieren – ganz egal, ob nun gezwungenermaßen oder weil sie schlicht von ihr fasziniert sind.
Ob ihr Altgriechisch könnt, ist dabei nicht von Bedeutung. Es wird nämlich weder Prüfungen noch Hausaufgaben geben – nur Überraschungen. Und zwar viele. Es ist auch nicht wichtig, ob ihr ein altsprachliches Gymnasium besucht habt. Wenn nicht, umso besser. Wenn es mir gelingt, euch mit meiner Fantasie durch das Labyrinth des Griechischen zu führen, werdet ihr die Welt und euer Leben am Ende dieses Weges auf eine neue Weise betrachten. Ganz unabhängig davon, welche Sprache ihr sprecht.
Wenn ihr doch eines besucht habt, dann noch besser. Wenn es mir nämlich gelingt, Fragen zu beantworten, die ihr euch niemals gestellt habt oder die immer unbeantwortet geblieben sind, dann werdet ihr am Ende der Lektüre vielleicht Teile von euch selbst wiedergefunden haben. Teile, die ihr in eurer Jugend beim Griechischlernen verloren habt, ohne jemals wirklich das Warum zu verstehen. Teile, die euch heute nützlich sein könnten. Sehr nützlich.
In beiden Fällen stellen diese Seiten sowohl für euch als auch für mich eine Möglichkeit dar, um in Altgriechisch denken zu spielen.
Jeder von euch musste sich im Laufe seines Lebens schon auf die eine oder andere Weise mit den alten Griechen und ihrer Sprache auseinandersetzen – sei es nun mit den Füßen unter der Schulbank, bei einer Tragödie oder Komödie im Theater oder auf den Korridoren der zahllosen archäologischen Museen. Und doch fühlt sich das Griechentum bei diesen Gelegenheiten in etwa so lebendig an wie eine Marmorstatue.
Alle – wirklich alle – wissen es. Es ist noch nicht einmal nötig, eigens darauf hinzuweisen. Man hat es in den letzten zweitausend Jahren so oft gehört, dass es mittlerweile jedem Europäer in Fleisch und Blut übergegangen ist: Alles Schöne und Unübertreffliche, das jemals auf der Welt gesagt oder getan worden ist, wurde zum ersten Mal von den alten Griechen getan oder gesagt. Und zwar auf Altgriechisch.
Die wenigsten kennen diese Sprache aus eigener Anschauung. Die meisten wissen darüber nur, dass es keinen einzigen alten Griechen mehr gibt, der noch Altgriechisch spräche. Sie haben lediglich »davon gehört« – oder noch nicht einmal das. Sie nehmen es einfach als gegeben hin: Es ist eben so und fertig. Seit Jahrhunderten.
Unser kulturelles Erbe ist uns demnach von einem antiken Volk hinterlassen worden, das wir nicht wirklich kennen, und noch dazu in einer alten Sprache, die wir nicht verstehen.
Furchtbar.
Denn es ist schrecklich, etwas nicht zu verstehen. Vor allem, wenn einem gesagt wird, man müsse es dennoch lieben. Kein Wunder, dass man es zu hassen beginnt.
Zugleich lassen uns die Parthenonskulpturen oder das Theater von Syrakus mit Stolz auf die Griechen blicken, so, als wären es die Werke unserer Ahnen, unserer weit entfernten Urgroßväter. Es gefällt uns, sie uns auf irgendeiner sonnenbeschienenen Insel vorzustellen, wie sie gerade die Philosophie oder die Geschichtsschreibung erfinden. Oder wie sie in einem Theater sitzen, das sich in den Hang irgendeines Hügels schmiegt, um einer Tragödie oder Komödie zu lauschen. Oder wir sehen sie vor uns, wie sie bei Nacht den Sternenhimmel betrachten und dabei Wissenschaft und Astronomie entdecken.
In Wahrheit jedoch sind wir zutiefst verunsichert. Es ist so, als befragte man uns über eine Geschichte, die letztlich eben doch nicht die unsere ist, und wir haben das Gefühl, etwas Wichtiges über das antike Griechenland vergessen zu haben. Und dieses Etwas ist die altgriechische Sprache.
Das Griechische: »Dieser absurde, tragische Moment des Menschlichen«, um Nikos Dimou in all seinem Unglück zu zitieren.
Nicht nur, dass wir uns dem kulturellen Erbe des Altgriechischen (gewissermaßen) als Enterbte und Untaugliche nähern. Auch wenn wir versuchen, die Krümel aufzulesen, die uns das Griechentum als Mitgift überlassen hat, bleiben wir Opfer eines der rückständigsten und stumpfsinnigsten Schulsysteme der Welt (zumindest nach meinem, dem Empfinden einer Hinterbänklerin, die nach diesem Buch wohl endgültig als ausgestoßen und durchgefallen gelten wird).
So, wie das altsprachliche Gymnasium in Italien strukturiert ist, scheint es keinem anderen Zweck zu dienen, als die Griechen und das Altgriechische so unerreichbar wie nur möglich zu belassen – stumm und herrlich auf dem Olymp, von einer Ehrfurcht umhüllt, die sich nur allzu oft in göttliche Schrecken und ausgesprochen irdische Verzweiflung verwandelt.
Mit wenigen, dem Engagement einiger aufgeklärter Lehrer zu verdankenden, Ausnahmen sind die gebräuchlichen Lehrmethoden geradezu dafür prädestiniert, um bei denjenigen, die es wagen, sich der griechischen Sprache anzunähern, Hass anstelle von Liebe zu erzeugen. Die Folge davon ist die Verweigerung eines Erbes, das wir nicht mehr wollen, weil wir es nicht verstehen, das uns einschüchtert und vor dem wir fliehen, kaum dass wir es auch nur streifen. Die meisten verbrennen daher die Schiffe des Griechischen hinter sich, sobald sie von den schulischen Zwängen befreit sind.
Nicht wenige Leser dieses Buches werden in meinen Ängsten ihre eigenen wiedererkennen, ihre Anstrengungen, ihre Frustrationen und ihre Wut auf das Altgriechische. Und doch sind diese Seiten aus der tiefen Überzeugung entstanden, dass es keinen Sinn ergibt, sich etwas vorzumachen. Es ist schlicht unmöglich, etwas zu vergessen, womit man sich fünf Jahre oder länger im Schweiße seines Angesichts herumgeplagt hat.
Doch keine Sorge, dieses Buch ist keine altgriechische Grammatik. Und es hat auch keinen akademischen Anspruch (von dieser Sorte gibt es bereits viel zu viele).
Sicher, es hat den Anspruch, leidenschaftlich zu sein und sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Es ist eine literarische Erzählung (wenn auch nicht im wörtlichen Sinne) – eine Erzählung über die Besonderheiten einer wundervollen eleganten Sprache.
Was auch immer man euch über das Altgriechische erzählt und vor allem nicht erzählt hat, es ist in erster Linie eine Sprache.
Jede Sprache dient dazu, mit ihren Worten eine Welt zu malen. Und diese Welt ist eure Welt. Nur dank der Sprache seid ihr dazu in der Lage, Ideen zu formulieren, Emotionen eine Stimme zu verleihen, mitzuteilen, wie es euch geht, Wünsche auszudrücken, ein Lied zu hören oder Gedichte zu schreiben.
Wir leben in einer Zeit, in der wir zwar ständig mit etwas, aber nur noch selten mit jemandem verbunden sind. Es ist eine Zeit, in der Worte außer Gebrauch geraten und durch Emojis oder andere Piktogramme ersetzt worden sind. Das Ergebnis ist eine immer schnelllebigere Welt mit einer virtuellen Realität, in der wir zeitversetzt von uns selbst existieren und einander – buchstäblich – nicht mehr verstehen.
Die Sprache – oder was davon bleibt – wird immer banaler. Wie viele von euch haben heute um der Liebe willen telefoniert? Ich meine, wirklich eine Nummer gewählt, um eine menschliche Stimme zu hören? Und wann habt ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben, einen richtigen Brief, meine ich, mit einem Stift auf ein Blatt Papier, und habt an einem Briefumschlag oder einer Briefmarke geleckt?
Der Unterschied zwischen der Bedeutung eines Wortes und seiner Interpretation wird immer größer – ebenso wie der Raum für unausgesprochene Missverständnisse und das Bedauern darüber, wieder einmal nicht den richtigen Ausdruck gefunden zu haben. Wir verlieren Stück für Stück die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen – welche auch immer es sei –, und damit zugleich die Fähigkeit, einander zu verstehen und uns verständlich zu machen. Es gelingt uns immer weniger, komplexe Dinge mit einfachen, treffenden und ehrlichen Worten auszudrücken. Aber genau das ist die Stärke des Altgriechischen.
Es mag merkwürdig klingen – ich habe ja gleich zu Beginn zugegeben, merkwürdig zu sein –, aber die Lektüre dieses Buches könnte euch täglich von Nutzen sein. Und das nicht etwa bei einer unerledigten Hausaufgabe, denn dafür gibt es andere Lösungen.
Ja, genau dieses Altgriechisch. Wenn man sich ihm ohne Angst (und mit einer ordentlichen Portion Verrücktheit) nähert, lässt es sich ins Gesicht blicken. Mehr noch, es spricht zu euch, mit lauter und reiner Stimme. Es hilft euch dabei zu denken und somit, euch auszudrücken, sei es nun in Bezug auf einen Wunsch, die Liebe, die Einsamkeit oder die Zeit. Mit seiner Hilfe könnt ihr euch die Welt zurückholen und die Dinge endlich wieder auf eure eigene Weise sagen. Weil wir, um noch einmal Virginia Woolf zu zitieren, »zum Griechischen zurückkehren, wenn wir der Ungenauigkeit, des Durcheinanders und unserer Epoche überdrüssig sind«4.
Dieses Buch zu schreiben war eine außerordentliche Erfahrung für mich. Es war wie eine Wiederentdeckung jener griechischen Wörter, die vor gefühlt tausend Jahren auf eine Schultafel geschrieben wurden, nur um gleich nach dem Unterricht weggewischt und vergessen zu werden.
Am Anfang stand die Erinnerung an mich selbst, fast noch ein Kind und verängstigt von einem Alphabet, das nicht meines war, und am Ende meine heutige, so vollkommen andere Sicht auf die altgriechische Sprache und die menschliche Natur.
Ich habe Kartons wiedergefunden, die mehr als zehn Umzüge überstanden haben, und darin die Schulbücher einer Vierzehnjährigen, in denen neben den Deklinationen der Name meines Sitznachbarn geschrieben stand. Nicht zu vergessen die Handbücher meiner Universitätszeit, die mir von Leben zu Leben und von Stadt zu Stadt gefolgt sind – mehr als die Schlüssel aller Wohnungen, in denen ich jemals gelebt habe und aus denen ich wieder ausgezogen bin.
Vergeblich habe ich zu vergessen versucht, was mich mehr als ein Jahrzehnt quälte, bis ich erkannte, dass es genügte, meine Gedanken mit Menschen aus meinem Umfeld zu teilen. Wir hatten uns niemals davon erzählt, aber auch sie wollten vergessen, dieselben Dinge wie ich, und das oftmals, ohne sich darüber im Klaren zu sein.
Bis heute unterstütze ich Schüler altsprachlicher Gymnasien, um letztlich von ihnen zu lernen. Die Fragen, die sie an mich richten, sind dieselben, die ich stellte, als ich noch keine Ahnung vom Altgriechischen oder vom Leben hatte. Und ist eine Frage erst einmal heraus, dann ist die Neugier geweckt und lässt sich nicht mehr unterdrücken. Genauso ist es auch mir ergangen, obwohl es lange gedauert hat, die Antworten zu finden oder auch nur zu erahnen.
Ich habe viel gelacht mit meinen Freunden, die in den Fängen des Altgriechischen dieselben Missgeschicke durchlebt haben wie ich. Ich musste feststellen, dass wirklich jeder, der sich mit dieser Sprache befasst hat, unzählige peinliche Erinnerungen mit sich herumträgt. Und genau die sind es, über die wir lachen müssen.
Vor allem jedoch habe ich versucht, die Merkwürdigkeiten des Altgriechischen auch jenen nahezubringen, die es nicht gelernt haben. Es ist kaum zu glauben, aber sie haben mich tatsächlich verstanden. Wir haben einander verstanden. Und zwar gut. Viel besser als gedacht.
Ich, die ich so merkwürdig bin, habe dank des Aspekts der griechischen Sprache nicht nur gelernt, die Zeit auf andere Weise zu betrachten, sondern es auch auszudrücken.
Ich habe so viele Seufzer geseufzt, während ich Wünsche im Optativ formulierte. Und nun, da ich Bilanz ziehe und mich frage, welche davon ich realisieren will, bleiben gar nicht mehr so viele übrig.
Ich habe ich liebe dich im Dual gesagt, einer Zahl, die in der griechischen Sprache wir beide bedeutet – nur wir.
Ich habe die Grausamkeit des auferlegten Schweigens erkannt, aber auch, dass man bestimmte Musik nicht einfach nur hört, sondern betrachtet.
Ich habe sogar Frieden mit meinem Namen Andrea geschlossen, der im Italienischen eigentlich ein Männername ist – eine Sache, die ich längst verloren glaubte.
Dieses Buch zu schreiben hat die Merkwürdigkeit in meinem Geist paradoxerweise weniger merkwürdig gemacht. Mit anderen Worten: Dank des Altgriechischen – indem ich es verstehe oder zumindest intuitiv erfasse – ist es mir gelungen, so viel mehr zu sagen, sowohl mir selbst als auch den anderen.
Ich hoffe, dass es euch genauso ergeht, wenn ihr diese Seiten lest, und dass ihr schließlich lachen und das Altgriechische zumindest einmal im Leben genießen könnt.
Wann, jemals, niemals. Der Aspekt
Zeit Gegenwart und Zeit Vergangenheit
Sind vielleicht beide in Zeit Zukunft gegenwärtig
Und Zeit Zukunft enthalten in Vergangenheit
Wenn alle Zeit für immer gegenwärtig ist
Kann nichts die Zeit erlösen
(…)
Fußtritte klingen nach, hier im Gedächtnis
Hier diesen Weg entlang, den wir nie gingen
Zu dieser Tür, die uns verschlossen blieb
Die Tür zum Rosengarten.
Thomas S. Eliot, Burnt Norton, [01]
aus Vier Quartette
Die Zeit, unser Gefängnis: Vergangenheit Gegenwart Zukunft. Früh spät heute gestern morgen. Immer. Niemals.
Die Zeit oder der Zeitpunkt kümmerten die alten Griechen wenig. Sie drückten sich in einer Weise aus, welche die Wirkung der Handlungen auf die Sprechenden berücksichtigte. Sie waren frei und fragten stets nach dem Wie. Wir sind Gefangene und beschäftigen uns immer nur mit dem Wann.
Nicht das Zu-spät oder Zu-früh der Dinge, sondern wie sie geschehen interessierte sie. Nicht der Moment der Dinge, sondern ihre Entwicklung war ihnen wichtig – nicht das Tempus, sondern der Aspekt. Der Aspekt ist eine grammatische Kategorie der altgriechischen Sprache, die sich auf die Qualität einer Aktion bezieht, ohne sie in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu verorten. Wir hingegen ordnen alles, was geschieht, entlang einer exakten Zeitlinie an. Und jeder von uns hat seine eigene, ob sie nun gerade oder im Zickzack verläuft.
Die Fakten wurden konkret, in ihrer Entstehung gesehen. Das Tempus kam erst danach, zusammen mit anderen, linguistisch zweitrangigen grammatischen Kategorien. Falls es überhaupt kam, denn oftmals blieb der genaue Zeitpunkt des Geschehens ganz offen.
In Timaios 37 e – 38 c schreibt Platon über die Zeit, unter Verwendung aller Varianten des Aspekts der Verben γίγνομαι, »werden«, und εἰμί, »sein«:
Ἡμέραςγὰρκαὶνύκταςκαὶμῆναςκαὶἐνιαυτούς, οὐκὂντας [Präsens] πρὶνοὐρανὸνγενέσθαι [Aorist], τότεἅμαἐκείνῳσυνισταμένῳτὴνγένεσιναὐτῶνμηχανᾶται· ταῦταδὲπάνταμέρηχρόνου, καὶτότ᾿ἦν[Imperfekt] τότ᾿ἔσται [Futur] χρόνουγεγονότα [Perfekt] εἴδη, ἃδὴφέροντεςλανθάνομενἐπὶτὴνἀίδιονοὐσίανοὐκὀρθῶς. λέγομενγὰρδὴὡςἦν [Imperfekt] ἔστιν [Präsens] τεκαὶἔσται [Futur], τῇδὲτὸἔστιν [Präsens] μόνονκατὰτὸνἀληθῆλόγονπροσήκει, τὸδὲἦν [Imperfekt] τότ᾿ἔσται [Futur] περὶτὴνἐνχρόνῳγένεσινἰοῦσανπρέπειλέγεσθαι.
Da es nämlich, bevor der Himmel entstand, keine Tage und Nächte, keine Monate und Jahre gab, so ließ er damals, indem er jenen zusammenfügte, diese mit entstehen; diese aber sind insgesamt Teile der Zeit, und das War und Wirdsein sind gewordene Formen der Zeit, die wir, uns selbst unbewusst, unrichtig auf das unvergängliche Sein übertragen. Denn wir sagen doch: Es war, ist und wird sein; der richtigen Ausdrucksweise zufolge kommt aber jenem nur das Ist zu, das War und Wirdsein ziemt sich dagegen nur von dem in der Zeit fortschreitenden Werden zu sagen, sind es doch Bewegungen.
Τότεγεγονὸς [Perfekt] εἶναιγεγονὸς [Perfekt] καὶτὸγιγνόμενον [Präsens] εἶναιγιγνόμενον [Präsens], ἔτιτετὸγενησόμενονεἶναι [Futur] γενησόμενον [Futur] καὶτὸμὴὂν [Präsens] μὴὂν [Präsens] εἶναι [Präsens], ὧνοὐδὲνἀκριβὲςλέγομεν.
Außerdem aber bedienen wir uns auch noch folgender Ausdrücke: Das Gewordene sei ein Gewordenes, das Werdende sei ein Werdendes, und das zu werden Bestimmte sei ein zu werden Bestimmtes sowie das Nichtseiende sei ein Nichtseiendes, aber keiner derselben ist vollkommen genau.5
Der Aspekt war eine Denkweise, die dazu diente, das Geschehen in der Welt und im Leben in Vollendetes und Unvollendetes zu unterteilen – perfecta oder infecta, um die lateinischen Begriffe zu verwenden. Oder auch in Anfang und Ende. Jede Sprache setzt eine bestimmte Sichtweise der Welt voraus. Wenn aber im Altgriechischen die Zeit zweitrangig ist, dann existieren im Grunde nur der Anfang und das Ende der Dinge. Aller Dinge.
Der Aspekt zeigte im Griechischen die Gesamtdauer zwischen Anfang und Ende an. Wie lange dauert ein Vorgang, und wie vollzieht er sich. Wie beginnt er, wie entwickelt er sich, und wie endet er. Was ist er geworden. Und vor allem war der Aspekt eine Möglichkeit, um auszudrücken, wie und wasaus jedem Anfang und jedem Ende entsteht.
Mit seiner Hilfe kannst du sagen, was geschieht, wenn du gesehen hast und daher nun weißt, wenn du Vertrauen hattest und daher nun glaubst, wenn du geschrieben hast und die weiße Seite daher nun voller Wörter ist. Wenn du losgegangen und angekommen bist – es ist nicht wichtig, wann, denn jetzt bist du ja da.
Für uns ist dieses Konzept kaum zu verstehen, denn wir sind mit der Vorstellung auf die Welt gekommen, dass zwischen Anfang und Ende Zeit vergeht – zu viel oder zu wenig – und dass diese Zeit alles ist, was wir haben. Wir können es nur schwer entschlüsseln, weil wir eine Sprache denken und sprechen, in der – wie in den meisten modernen Sprachen – jeder Vorgang eng mit einem präzisen Moment in Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft verknüpft ist. Und zugleich lässt sich nichts wirklich in der Zeit festmachen, weil es sich ständig in etwas anderes verwandelt. Es fällt uns schwer, festzustellen, was genau geschieht, denn wir vertrauen uns der heilenden Kraft der Zeit an, wenn wir Verletzungen davontragen und darauf warten, dass sie vernarben. Es ist schwer, ohne Zeitbezug zu denken, doch Zeit existiert nicht. Es existieren nur das Ende eines jeden Anfangs und der Anfang eines jeden Endes. Die Bauern und Seeleute wissen es: Man mäht, um wieder säen und ernten zu können. Man legt im Hafen an, um in See zu stechen, das Meer zu überqueren und erneut anzulegen. Es ist schwer zu sehen, denn wir blicken ständig auf die Uhr oder den Terminkalender, um die Logistik unseres Lebens in der Zeit zu strukturieren – einer Zeit, die alles verändert und es zugleich bleiben lässt, wie es ist: Im Altgriechischen haben »ich bleibe« und »ich erwarte dich« in den Verben μένω und μίμνω dieselbe Wurzel.
Es ist schwer für uns. Aber das liegt nicht am Altgriechischen, das nicht auf die Zeit verwies, sondern auf den Prozess, und das mithilfe des Aspekts der Verben die Qualität der Dinge zum Ausdruck brachte – eine Kategorie, die sich uns immer wieder zu entziehen scheint. Unser Problem ist das Wann, nach dem wir ständig fragen, ohne jemals das Wie zu hören.
Der Aspekt des griechischen Verbes ist eine der großartigsten Hinterlassenschaften des Indogermanischen, einer der ersten auf der Welt gesprochenen, inzwischen jedoch längst verschwundenen und daher nur noch hypothetischen Sprachen. Die Sprachen, die darauf folgten, haben nichts anderes getan, als das linguistische und intellektuelle Erbe des Indogermanischen durch Weglassungen zu verschleudern – Sprachökonomie wird dieses Prinzip der Vereinfachung in der Linguistik genannt, das auf eine Banalisierung der Sprache hinausläuft.
Die Gesellschaften wandelten sich im Laufe der Jahrtausende, Völker wurden von Nomaden und Viehzüchtern zu Stadtbewohnern: Es wurde notwendig, sich schnell auszudrücken, sich in Eile verständlich zu machen und verstanden zu werden. Die Welt war komplexer geworden, und paradoxerweise brauchte es dafür eine einfachere Sprache – so geschieht es immer, wenn sich die Realität nur schwer ausdrücken lässt. Man denke nur an die aktuelle Kommunikation mit Emoticons als moderne Piktogramme. Inzwischen kann niemand mehr richtig telefonieren, und wir vergessen, dass wir sprechen können.
Das Verbalsystem des Indogermanischen hatte eine eigentümliche Struktur. Es verfügte nämlich nicht über eine regelmäßige, auf dem Tempus basierende Konjugation, wie wir es gewohnt sind und in der Grundschule lernen: »Ich esse, ich aß, ich habe gegessen«. Stattdessen besaß es unabhängige, durch keine zeitliche Notwendigkeit verbundene Verbalstämme.
Das Altgriechische hat seit Homer diese indogermanische Eigentümlichkeit bewahrt und damit jene reine Art, die Welt ohne Tempus zu betrachten.
Im Vergleich dazu sind wir heute in linguistischer Hinsicht geradezu verstummt, denn wir sind kaum noch in der Lage, etwas ohne Zeitbezug auszudrücken. Es fällt uns schwer, das Wann der Dinge außer Acht zu lassen und über das Wie nachzudenken. Aber versuchen wir doch einfach mal zu sehen, um anschließend zu wissen. Versuchen wir, den Aspekt zu verstehen, um anschließend zu reden. Weil das Tempus sprachlos ist, der Aspekt hingegen nicht.
Für diejenigen, die Altgriechisch nicht in der Schule hatten, ist der Versuch, den Aspekt zu verstehen, so etwas wie eine Übung in Sprachfreiheit. Für jene hingegen, die es in der Schule oder an der Universität gelernt haben, wird es womöglich die Antwort auf nie gestellte Fragen sein. Vielleicht wird es auch etwas mehr als eine Übung in Sprachfreiheit sein – nämlich eine sprachlicheBefreiung und für manche sogar eine Revolution. Eine Art verspätete Wiedergutmachung für all die Jahre, die sie mit dem stupiden Auswendiglernen von Verben verbringen mussten, ohne wirklich den Sinn des Ganzen zu verstehen.
Die grammatische Kategorie des griechischen Aspekts wird in den Schulbüchern aktuell – wenn überhaupt – auf maximal einer halben Seite abgehandelt. Die Listen mit den auswendig zu lernenden Verben hingegen umfassen mindestens einhundert Seiten. Ich weiß sehr wohl, dass es eines intensiven Studiums, großer Ausdauer und Beharrlichkeit bedarf, um eine Fremdsprache zu erlernen. Und ob nun tot oder lebendig, genau das ist das Altgriechische. Es ist außerdem eine große Gedächtnisleistung, etwas in sprachlicher Hinsicht derart Fremdes zu verinnerlichen (vielleicht ist es ja genauso schwer, Japanisch zu lernen?). Trotzdem ist jede Anstrengung ohne Verständnis und Sprachgefühl nichts weiter als Selbstzweck. Und ohne ein Gefühl für sie zu haben, kann man die Sprache, die man lernt, nicht verstehen und schon gar nicht begreifen, warum man sie lernt.
Wer einmal Altgriechisch gelernt hat, mag die Sprache inzwischen vergessen haben, erinnert sich aber bestimmt noch an die zahllosen mit dem Pauken von Lehrsätzen verbrachten Nachmittage. Was soll auch anderes dabei herauskommen als das völlige Vergessen, wenn wir sinnfrei auswendig lernen oder uns vertraute Kategorien wie das Tempus auf Sprachen anwenden, denen sie fremd sind? Was bleibt, ist die Erinnerung an die Qualen so vieler Frühlingsnachmittage, an denen man lernte, was man so bald wie möglich wieder vergessen wollte. Und für die meisten von uns begann das Vergessen bereits unmittelbar nach Abgabe der Abiturarbeit.
Ich werde versuchen, den Aspekt zu erklären, indem ich mir meine eigene Jugend und die auswendig gelernten Lehrsätze noch einmal ins Gedächtnis rufe: Ich hörte den Klang, doch den Sinn verstand ich nicht. Ich wiederholte sie gebetsmühlenartig, ohne mir ihrer jemals wirklich bewusst zu sein. Es hätten ebenso gut vedische Verse, buddhistische Mantras oder Koransuren sein können, es wäre dasselbe gewesen. Auch heute noch muss ich nur φέρωhören, und ich antworte reflexartig οἴσω und so fort. Mein Sprachverständnis erschöpfte sich darin, dass ich während der Klassenarbeiten die Verben unter Beschwörungen zu Papier brachte. Und ich war weder die Erste noch die Letzte, der es so erging. Im Gegenteil. Genau dasselbe passiert auch heute noch Schülern an altsprachlichen Gymnasien, die in den Zweitausendern geboren wurden und ein Mobiltelefon benutzen konnten, bevor sie wussten, was ein Kugelschreiber ist.
Da ich selbst auch jetzt noch ein gebranntes Kind des altsprachlichen Gymnasiums bin, richten sich meine Erklärungen nicht zuletzt an diese jungen Menschen, um ihren Nachmittagen und vor allem den Nächten, in denen sie lernen, anstatt irgendwo zu feiern, wenigstens ein bisschen Sinn zu verleihen. Vertraut mir, es gibt einen Sinn in dem, was ihr lernt, einen wunderschönen sogar, auch wenn ich selbst fünfzehn Jahre und einen Universitätsabschluss in Altphilologie gebraucht habe, um das zu begreifen.
Dickköpfig wie ich war.
Fangen wir am besten mit einer Geschichte an, denn wir stellen uns gerne etwas vor, und Vorstellungskraft ist bei einer Sprache, die nicht die eigene und noch dazu eine tote ist, besonders wichtig. Natürlich wird es auch noch akademischere Beispiele geben – nur für den Fall, dass die kundigeren Leser beunruhigt sein sollten.
Ende der Leseprobe