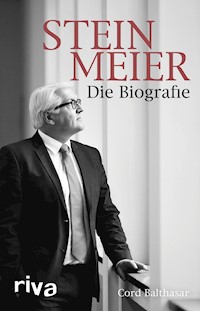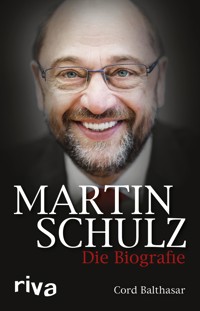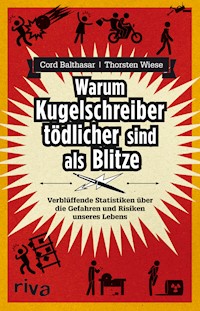
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist es ein Wunder, dass es uns überhaupt gibt. Die Chance, dass es beim Sex zur Schwangerschaft kommt, ist so gering, dass es sich eigentlich nicht lohnt, darüber zu sprechen. Werden wir tatsächlich geboren, dreht sich das Karussell der Gefahren munter weiter. Wir sind ständig an Leib und Leben bedroht: beim Spielen, im Straßenverkehr oder bei der Ernährung. Und haben wir dann trotz aller Widrigkeiten das Erwachsenenalter erreicht, sind wir längst nicht sicher. Krankheiten, Unfälle, Verbrechen eigentlich überleben wir nur mit Glück jeden neuen Tag. Cord Balthasar und Thorsten Wiese haben sich in kleinteiliger Recherche durch Berge von Statistiken gearbeitet, um unser Leben in Zahlen und Tabellen auszuwerten und zu analysieren, welche alltäglichen Dinge potenzielle Risiken bergen, ohne dass uns dies auch nur annähernd bewusst ist. Das Fazit sollte man mit Humor nehmen, denn Überleben ist eher unwahrscheinlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
[email protected]
Originalausgabe
1. Auflage 2014
© 2014 by riva Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Petra Holzmann, München
Umschlaggestaltung: Maria Wittek, München
Umschlagabbildung: unter Verwendung von Shutterstock
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print: 978-3-86883-420-8
ISBN E-Book (PDF): 978-3-86413-574-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi): 978-3-86413-575-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Inhalt
Titel
Impressum
Inhalt
Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt trotzdem um
Kapitel 1: Zeugung & Geburt Aller Anfang ist fast unmöglich
Kapitel 2: Säuglingsalter & Kindheit Von Kindesbeinen an in Gefahr
Kapitel 3: Jugend & Pubertät Der Geschmack von Freiheit, Tod und Abenteuer
Kapitel 4: Mobilität & Verkehr Frauen und Kinder zuletzt
Kapitel 5: Arbeit & Beruf Auf der (un)sicheren Seite
Kapitel 6: Familie & Nestbau Ein (Alb)Traum wird wahr
Kapitel 7: Freizeit & Sport Breitensport ist Massenmord
Kapitel 8: Reisen & fremde Länder Andere Länder, andere Gefahren
Kapitel 9: Sparen & Vermögen Geld macht auch nicht (un)glücklicher
Kapitel 10: Lebensabend Das Tödlichste kommt zum Schluss
Eine letzte Blitzmeldung
Quellen
Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt trotzdem um
Dass Sie diese Worte lesen, ist äußerst unwahrscheinlich. Denn statistisch gesehen, sind Sie tot oder haben es gar nicht erst zu einer menschlichen Existenz gebracht. Schließlich ist unser Leben vom ersten Augenblick an darauf ausgelegt, uns umzubringen – mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Die Frage ist einzig und allein, wann es uns erwischt.
Weil wir diesen Zeitpunkt instinktiv möglichst lange hinauszögern möchten, ist unser Alltag bewusst oder unbewusst von Ängsten beherrscht. Wir haben Angst vor terroristischen Anschlägen, fürchten uns davor, im Dunkeln überfallen zu werden oder dass uns der Blitz erschlägt.
Dummerweise aber fürchten wir uns kaum vor den vielen Risiken, die uns mit weit höherer Wahrscheinlichkeit ins Grab bringen. Wer beispielsweise am Flughafen beim Anblick jedes scheinbar herrenlosen Koffers in Panik verfällt und darin eine Bombe vermutet, sollte sich besser erst einmal beruhigen und an die realen Gefahren denken: Es ist nämlich 17.600-mal wahrscheinlicher, an einer Herzattacke zu sterben, als Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden. Sogar der Tod durch Ertrinken ist 87-mal wahrscheinlicher. Im weltweiten Vergleich sind selbst Polizisten gefährlicher als Terroristen: Dass ein Mensch von einem Ordnungshüter erschossen wird, ist immerhin 8-mal wahrscheinlicher, als dass er Opfer eines Terroranschlags wird.
Die Tödlichkeit des Kugelschreibers
Ein anderes Beispiel: Wohl kaum ein Mensch auf der Welt verfällt beim Anblick eines Kugelschreibers in Panik – bei einem Hai sieht das anders aus. Auch hier stehen unsere Ängste in keinem Verhältnis zur Realität. Im Jahr 2011 kam es weltweit zu 75 Angriffen von Haien auf Menschen, zwölf davon endeten tödlich. Wenn überhaupt jemand Angst vor Haien haben muss, dann sind es die Menschen in den Vereinigten Staaten – dort fanden 29 der Angriffe statt und damit fast die Hälfte dieser Attacken.
Kugelschreiber sind dagegen regelrechte Todesmaschinen. Gerade in den Industrieländern verbringt der moderne Mensch einen Großteil des Tages im Büro und an einem Schreibtisch – umgeben von Computern und ebenso gewöhnlichen Alltagsgegenständen wie Kugelschreibern. Gerade zu Letzteren wird immer wieder gegriffen: mal, um einfach auf dem Schieber am oberen Ende herumzudrücken, mal, um ihn auseinanderzuschrauben und zu zerlegen. Ergänzt wird das gedankenlose Rumgefummel von einer fatalen Tendenz des Menschen, Einzelteile oder komplette Kulis in den Mund zu nehmen und daran herumzunuckeln. Die Folge: Jährlich ersticken allein in Deutschland geschätzte 100 bis 300 Menschen an Kugelschreiberteilen. Wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr, man geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Mindestens 300 deutsche Kugelschreibertote gegen 12 weltweite Haiopfer also. Selbst der gefürchtete Blitz während eines Unwetters kommt nicht an die Gefährlichkeit des Kugelschreibers heran – aber dazu später mehr.
Wie sehr uns unsere Ängste von realen Gefahren ablenken, das zeigte auch der 11. September 2001 – jener Tag also, an dem tatsächlich ein terroristischer Angriff Tausende Menschenleben forderte. Da die Attentäter Flugzeuge benutzten, stieg nach diesem Ereignis die Angst, an Bord eines Passagierjets den Tod zu finden. Weltweit sank daher die Zahl der Flugpassagiere nach Jahren des Aufschwungs – in den USA sogar drastisch um 6,5 Prozent. Die Menschen fühlten sich am Boden einfach sicherer als in der Luft, fuhren lieber mit dem Auto – und verdrängten völlig, dass man auch dort zu Tode kommen kann. Allein die Monate Oktober bis Dezember 2001 sollen in den Vereinigten Staaten 1000 zusätzliche Verkehrstote gefordert haben.
Immer wieder haben Forscher vor dem Hintergrund realer und gefühlter Gefahren versucht herauszufinden, wo denn das tatsächliche Risiko verborgen ist. Und immer wieder kamen sie zu dem Ergebnis, dass es meist ganz alltägliche Vorgänge sind, die uns im Endeffekt umbringen. Der deutsche Risikoforscher Klaus Heilmann etwa hat verschiedene Todeswahrscheinlichkeiten berechnet und verglichen. Auch er kam zu teils überraschenden Ergebnissen.
Sterben liegt nicht in der Luft – aber im Qualm
Auf die Frage, ob es daheim oder im Straßenverkehr gefährlicher ist, würde vermutlich jeder auf den Verkehr tippen. Tatsächlich liegen beide Bereiche fast gleichauf: In den eigenen vier Wänden beträgt das Todesrisiko durch einen Sturz 1 zu 22.000 – einer von 22.000 Bundesbürgern wird so zu Tode kommen. Das Todesrisiko im Straßenverkehr beträgt 1 zu 20.000.
Die Luft dagegen hat allem Anschein nach doch Balken: An Bord eines Flugzeuges beträgt das Sterberisiko nach Heilmanns Berechnungen gerade einmal 1 zu 3.360.000. Trotzdem leiden etwa 15 Prozent der Deutschen unter Flugangst. Mancher verängstigte Passagier wird womöglich vor dem Start der Maschine zur Beruhigung noch schnell eine Zigarette rauchen – dumm nur, dass das Todesrisiko für Raucher bei 1 zu 210 liegt. Es ist also 16.000-mal wahrscheinlicher, durch Tabakqualm zu sterben, als mit dem Flugzeug abzustürzen.
Micromort: Todespunkte sammeln
Ein Forscher in den USA hat angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten, frühzeitig aus dem Leben zu scheiden, sogar eine Maßeinheit ausgetüftelt, mit der sich das Todesrisiko einer Tätigkeit beschreiben lässt. Die im Jahr 1980 von dem Entscheidungstheoretiker Ronald A. Howard errechnete Einheit trägt den Namen »Micromort« oder im Deutschen »Mikromort« und steht für die Mikrowahrscheinlichkeit, dass ein tödliches Ereignis eintritt. Ein Mikromort entspricht der Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million, dass ein bestimmtes Handeln das Leben beendet.
Motorradfahrer haben schon nach zehn Kilometer Fahrt ihren ersten Mikromort zusammen und damit die Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million gesammelt, dass ihr Leben durch einen Unfall endet. Autofahrer müssen dafür immerhin 370 Kilometer zurücklegen, Flugzeugpassagiere 1609 Kilometer und Zuginsassen 9656 Kilometer.
Ebenfalls einen Mikromort gibt es für eine Pille der Droge Ecstasy, 0,5 Liter Wein oder 1,4 Zigaretten. Das Leben im Umkreis von 32 Kilometern zu einem Atomkraftwerk führt dagegen erst nach 15 Jahren zu einem Mikromort.
Deutlich schneller lassen sich Mikromorts durch actionreiches Freizeitvergnügen sammeln: Wer sich ins Gestänge eines Hängegleiters krallt und als Drachenflieger einen Hang hinabstürzt, hat augenblicklich 8 Mikromorts beisammen. Da kommen selbst Fallschirmspringer (7 Mikromorts) und Taucher (5 Mikromorts) nicht mit.
Doch im Grunde sind auch das weit fortgeschrittene Möglichkeiten der Selbstentleibung, die nur die wenigsten grundsätzlich lebensfähigen menschlichen Zellen auskosten dürfen. Schließlich kommt nur ein Bruchteil solcher Zellen so weit. Denn die Tödlichkeit des Lebens setzt schon lange vor unserem ersten Atemzug ein.
Kapitel 1: Zeugung & Geburt Aller Anfang ist fast unmöglich
Wie groß unsere Chance ist, dass wir unser Leben möglichst lange leben können, hängt von einem Faktor ab: dass wir überhaupt geboren werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings denkbar gering. Grundsätzlich geben wir Menschen uns zwar ziemlich viel Mühe, das zum Zweck der Fortpflanzung notwendige Verfahren einzuleiten. Sprich: Wir haben gern und häufig Sex. Das von der Natur vorgesehene Ergebnis kommt dabei jedoch eher selten heraus. Laut einer weltweiten Umfrage des Unternehmens Harris/Durex hat der Durchschnittsdeutsche im Jahr 117-mal Sex– also etwa zweimal wöchentlich– und steht damit im internationalen Vergleich sogar ziemlich gut da. Die Japaner zieht es nicht einmal halb so oft ins Bett, sie beschränken sich auf nur 48 jährliche Sexualakte. Deutlich mehr Lust haben dagegen die Griechen. Sie liegen mit jährlich 164-mal Geschlechtsverkehr weltweit an der Spitze vor Brasilien (145) und Russland (143).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!