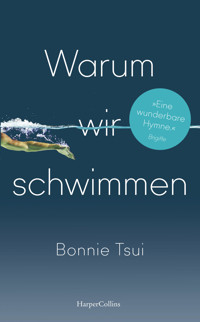
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein Juwel von einem Buch, eine Hymne aufs Wasser und unseren Platz darin.«
James Nestor, Autor des SPIEGEL-Bestsellers »Breath. Atem«
Unsere Vorfahren schwammen, um zu überleben. Heute schwimmen wir in arktischen Gewässern und durchqueren breite Kanäle, weil wir die Herausforderung mögen. Schwimmen ist ein ruhiger und meditativer Sport in einer chaotischen Zeit. Schwimmen ist gesund, gemeinschaftsfördernd, existenziell. Jeder Mensch sollte es können.
Ob ein Schwimmclub im ehemaligen Palastbad Saddam Husseins in Bagdad, moderne Samurai-Schwimmer in Japan, verpflichtender Schwimmunterricht vollständig bekleidet in den Niederlanden, ein isländischer Fischer, dessen Physis einer Robbe gleicht, die ersten öffentlichen Schwimmbäder in Chicago und New York oder die Bajau-Seenomaden von Malaysia, deren Kinder es schon schaffen, bis zu 70 Meter in die Tiefe zu tauchen, ohne einmal Luft holen zu müssen.
Mit ihren kurzweiligen und wissenswerten Portraits über weltweite Schwimmkultur lässt uns die Literaturwissenschaftlerin und ehemalige Leistungsschwimmerin Bonnie Tsui tief abtauchen in die faszinierende Welt des Wassers, die uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig und emotional bereichert.
»Eine großartige Geschichte. Ich liebe dieses Buch.« Christopher McDougall, Autor des Bestsellers Born to Run
»Absolut wundervoll.«The New York Times
»Warum wir schwimmen? Das Buch gibt eine Fülle von Antworten.« Der Tagesspiegel
»Die US-amerikanische Autorin Bonnie Tsui erzählt in ihrem Buch ›Warum wir schwimmen‹ spannende Geschichten über diese uralte Fortbewegungsart.« Kristian Teetz, RND
»Eine Perle unter den Sachbüchern, nicht nur für Menschen, die das Wasser lieben.« Radio Bremen Zwei
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem TitelWhy We Swim bei Algonquin Books, einem Imprint von Workman Publishing Co., Inc., New York.
Deutsche Erstausgabe © 2020 by Bonnie Tsui © 2022 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing Co., Inc., New York Covergestaltung von Rothfos & Gabler, Hamburg Coverabbildung von Henrik Sorensen / Getty Images, VDB Photos / Shutterstock - VDB Photos / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783365000274www.harpercollins.de
Überleben
Auf einer alten Karte aus der Zeit, als dieser Ort zum ersten Mal besiedelt wurde, erscheinen Ungeheuer, überall dort, wo das Festland sich im Meer verliert …
– CARL PHILLIPS, »SWIMMING«
Eines Abends beim Essen erzählte mir mein Mann von einer Geschichte, die er gehört hatte. 1 Es ging dabei um ein Schiff im Nordatlantik und einen Mann, der eigentlich hätte ertrinken müssen: Spät am Abend des 11. März 1984 fischte ein Trawler in ruhiger See drei Meilen östlich der Insel Heimaey, die Teil einer Inselgruppe südlich von Island ist. Der Himmel war klar, in der Luft herrschten frostige zwei Grad minus. Fünf Männer befanden sich an Bord, darunter der gerade 22-jährige Steuermann Guðlaugur Friðƥórsson. Er hatte Freiwache und lag schlafend unter Deck, als er vom Koch mit der Nachricht geweckt wurde, das Schleppnetz habe sich auf dem Meeresgrund verfangen. Als Friðƥórsson an Deck kam, sah er, wie die Mannschaft versuchte, das Netz hochzuwinschen. Eine der Kurrleinen stand seitlich stark unter Zug, weshalb das Schiff so weit überholte, dass schon Wasser über die Reling spülte. Friðƥórsson rief eine Warnung, woraufhin Kapitän Hjörtur Jónsson Anweisung gab, den Zug auf der Winsch zu lockern. Doch dann klemmte die Winsch, und als eine Welle das Schiff anhob, kenterte es, und die Seeleute wurden ins eiskalte Wasser geschleudert.
Zwei der Männer ertranken sofort, während die übrigen drei, darunter Friðƥórsson, sich am Kiel des Bootes festklammern konnten. Doch gelang es ihnen nicht, die Rettungsinsel loszumachen, und schon bald sank der Trawler. In dem fünf Grad kalten Wasser blieb ihnen weniger als eine halbe Stunde, dann würden sie unterkühlt sein. 2 Die drei begannen Richtung Küste zu schwimmen. Nach wenigen Minuten waren nur noch Jónsson und Friðƥórsson am Leben.
Die beiden Männer riefen sich während des Schwimmens immer wieder etwas zu, um sich gegenseitig anzufeuern. Doch irgendwann antwortete auch Jónsson nicht mehr. Friðƥórsson, der blaue Arbeitshosen, ein rotes Flanellhemd und einen dünnen Pullover trug, schwamm weiter. Er sprach mit den Möwen, um sich wach zu halten, und einmal fuhr ein Boot nur knapp einhundert Meter entfernt an ihm vorbei, und er schrie so laut er konnte, doch an Bord bemerkte man ihn nicht. Er schwamm auf dem Rücken und behielt immer den Leuchtturm im Süden der Insel im Auge. Endlich hörte er die Brandung und betete, dass er nicht an den Felsen zerschmettert würde. Erschöpft, schrecklich durstig und ohne Gefühl in den Gliedmaßen geriet er an eine steile, unwegsame Klippe. Weil er dort nicht hochklettern konnte, schwamm er nochmals hinaus, korrigierte seinen Kurs weiter nach Süden, wo er endlich das Ufer erreichte und langsam über ein mehr als einen Kilometer breites Lavafeld aus spitzen, schneebedeckten Steinen auf die nächste Stadt zuwanderte. Zwischendurch stillte er seinen Durst, nachdem er die zentimeterdicke Eisschicht auf dem Wasser eingeschlagen hatte, an einer Schafstränke. Als er schließlich in der Stadt ankam, hatte er das Gefühl, alles sei zu schön, um wahr zu sein, und klopfte am ersten Haus, in dem Licht brannte. Er war barfuß und mit Reif überzogen, und hinter ihm auf dem Bürgersteig waren blutige Fußspuren zu sehen, die bis zu dem Haus führten.
Dies ist eine wahre Geschichte. Letztendlich hatte Friðƥórsson sechs Stunden in eiskaltem Wasser überlebt und war mehr als fünf Kilometer geschwommen, bis er an Land gelangte. Als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, konnten die Ärzte keinen Puls bei ihm feststellen, und dennoch zeigte er keine Anzeichen von Unterkühlung, sondern war lediglich dehydriert. 3
Friðƥórssons Physis, so stellte man fest, glich der einer Robbe. Wie Wissenschaftler später feststellten, besaß er eine vierzehn Millimeter starke Fettschicht, die ihn isolierte – zwei- bis dreimal so dick wie bei einem normalen Menschen und viel fester. 4 Dieser Mann ähnelte mehr einem Meeres- als einem Landsäuger wie dem Menschen. Seine biologische Besonderheit hatte ihn gerettet, indem sie ihn warm hielt, ihm Auftrieb gab und ihn befähigte weiterzuschwimmen. Manche nannten ihn einen echten »Selkie«, eine Mischung aus Mensch und Seehund, die in isländischen und schottischen Sagen vorkommt. Für mich ist er ein lebendiger Beweis dafür, dass wir uns noch nicht so weit vom Meer, aus dem wir stammen, entfernt haben.
Als Menschen bevölkern wir die Erde. Wir sind Landkreaturen mit einer Meeresvergangenheit. Geschichten wie die von Friðƥórsson faszinieren mich, weil ich wissen will, was heute noch von dieser Vergangenheit geblieben ist. In gewisser Weise sind alle Geschichten von Schwimmern – von den Najaden der griechischen Mythen bis zur Langstreckenschwimmerin Diana Nyad, die im Jahr 2013 von Kuba nach Florida schwamm – Versuche, unser an das Land angepasstes Wesen wieder mit dem Wasser vertraut zu machen. Wir Menschen sind keine geborenen Schwimmer, aber wir haben Wege gefunden, um die Fähigkeiten wiederzugewinnen, die wir besaßen, ehe die Evolution vor Hunderten von Millionen Jahren Land und Meer voneinander trennte.
Warum schwimmen wir, wenn uns die Evolution doch darauf spezialisiert hat, unsere Beute so lange jagen zu können, bis sie vor Erschöpfung zusammenbricht? Natürlich hat auch das mit dem Überleben zu tun: Irgendwann im Laufe der Entwicklung half uns das Schwimmen, von einem prähistorischen Seeufer zum anderen zu gelangen, um unseren eigenen Verfolgern zu entkommen, nach größeren Schalentieren zu tauchen und uns so neue Nahrungsquellen zu erschließen oder uns über den Ozean zu wagen und neues Land zu besiedeln und schließlich alle Arten von Gefahren im Wasser überwinden und das Schwimmen als eine Quelle der Freude, des Vergnügens und als Errungenschaft erleben zu können. Und heute hier darüber schreiben zu können, warum wir schwimmen.
Mit diesem Buch möchte ich dem nachgehen, was uns, trotz seiner Gefahren, immer wieder zum Wasser zieht. Für mich bedeutet Schwimmen so viel mehr als nur im Wasser zu überleben. Schwimmen kann heilend und gesund sein – ein Weg zum Wohlbefinden. Schwimmen kann ein Weg sein, Gemeinschaft zu finden, als Mannschaft, in einem Klub oder an einem Ort, den man gern aufsucht. Wir müssen uns nur gegenseitig im Wasser beobachten, dann wissen wir, dass Wasser auch Raum zum Spiel schafft. Wenn wir merken, dass wir gute Schwimmer sind, kann uns das Antrieb sein, uns mit anderen zu messen und im Schwimmbad oder See zu zeigen, was in uns steckt. Doch Schwimmen ist nicht nur eine Frage des Körpers, sondern auch des Geistes. Indem man seinen Rhythmus im Wasser findet, entdeckt man eine neue Daseinsform in der Welt, man ist im Fluss. Dieses Buch handelt von unserer Beziehung zum Wasser und davon, wie das Eintauchen darin unsere Vorstellungskraft entfesseln kann.
Mehr als 70 Prozent unseres Planeten sind von Wasser bedeckt; mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung leben nicht weiter als zehn Kilometer von der nächsten Küste entfernt. 5 Dieses Buch wurde geschrieben für Schwimmer und alle neugierigen Menschen jeder Art und jeden Alters, ganz gleich, ob es ihnen um Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke oder um die Grenzen der eigenen Erfahrung geht. Für alle, die noch den Gesang der Sirenen im Wasser vernehmen und auch für diejenigen von uns, die sich selbst verstehen und so den verlorenen stillen Zustand des einfachen Seins wieder ergründen wollen – ohne Technologie, ohne Klingeltöne, in den Ursprüngen unseres menschlichen Daseins im Wasser.
Wir stürzen uns in alle Arten von Gewässer: Ozeane, Seen, Flüsse, Ströme oder Schwimmbecken. Mit den Rettungsschwimmern, den Wächtern dieser Orte, verbindet uns eine romantische Beziehung. Dort, wo diese Dinge zusammenkommen, beginnt meine Familiengeschichte – nicht zuletzt, weil meine Mutter und mein Vater sich in einem Schwimmbecken in Hongkong kennenlernten.
Ich lernte bereits im Alter von fünf Jahren schwimmen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil meine Eltern verhindern wollten, dass ich in der Badewanne, im Gartenpool der Nachbarn oder am Strand ertrinke. Als Kind verbrachte ich am Jones Beach in New York viel Zeit in dem etwa einen Meter tiefen Wasser dieses muschelförmigen, ausgefransten Ufers des Atlantiks. Ich sehe es noch deutlich vor mir: Mein Bruder, meine Cousins und ich hüpfen in dem flachen Wasser auf und nieder und warten auf eine Welle, die kommen und uns mitnehmen soll. Wir rudern uns mit den Armen über den Abhang der Welle, bis sie bricht und uns wieder im aufgeschäumten Bereich abwirft, wo Wasser auf Sand trifft. Aufstehen, lachen, noch einmal.
Wir sind fasziniert von diesem wogenden Wasserberg. Jeder von uns ist das. Wenn es heiß ist oder an einem Feiertag können sich am Jones Beach hunderttausend Menschen tummeln. Die Rettungsschwimmer halten von ihren erhöhten Sitzen aus Wache und behalten durch verspiegelte Sonnenbrillen die Menge im Blick.
So ein Tag am Strand hat etwas von einem Urbedürfnis – als würden alle Tiere zur Wasserstelle streben. Das Wasser wirkt wie ein Magnet auf die wuselnde Menschenmenge. Ich beobachte die verschiedenen Arten, wie die Menschen baden gehen. Manche wollen sich nur abkühlen: Sie berühren das Wasser wie elektrisiert und rennen schnell wieder raus. Andere bleiben eine Weile, lassen sich treiben, planschen und schwimmen. Es gibt auch immer welche, die auf Abstand bleiben und gar nicht ins Wasser gehen. Aber auch sie kommen – vom Pulsieren des Ozeans hypnotisiert, angelockt vom Grollen der Brandung und dem Geruch der salzigen Luft.
Schon früh habe ich die Verlockung des Wassers gespürt: dieses herrliche Gefühl des Eintauchens, die schwindelerregende Schwerelosigkeit, der privilegierte Zugang zu einer schweigenden Unterwasserwelt. All das lernte ich am Jones Beach kennen, wo wir die Stunden in Rufdistanz zu den blaugeblümten Strandtüchern meiner Mutter verbrachten. Wenn wir nicht im Wasser waren, zogen wir uns an den Badehosen oder gruben uns im Sand ein. Mir gefiel es, wie der Ozean zu atmen schien, wie er uns, gerade noch ganz still und im nächsten Moment in Aufruhr, als eine zappelnde Masse zum Horizont und wieder zurückwarf. Einmal erwischte mich eine große Welle von hinten. Überraschend auf den Kopf gestellt, Hintern oben. Dann ein grüner Raum voll aufgewühlten Sands. Ich schwimme und schwimme im Nichts. Wo ist oben? Ein Meter Wassertiefe ist nicht viel, aber genug, um darin zu ertrinken.
Die Zeit stand still. In meinen brennenden Lungen fühlte ich den Druck und gierte nach Luft.
Ein Tritt gegen meinen Kopf holte mich in die Gegenwart zurück – mein Cousin, der keinen halben Meter neben mir schwamm, hatte mich versehentlich erwischt. Mit ihm als Orientierungspunkt rappelte ich mich hoch zur Oberfläche, die Haare wie Seetang ums Gesicht gewickelt. Verlegen keuchend schaute ich mich um. Niemand hatte bemerkt, dass ich in Schwierigkeiten gewesen war, und als mir das klar wurde, tat ich so, als wäre es nie geschehen. Und stürzte mich gleich wieder in die Fluten.
Woher kam dieses bewusste Vergessen? Was war so verlockend am Wasser, dass ich dem Meer augenblicklich diesen Mordanschlag verzieh? Fast jedes Jahr ertrinken einige Menschen an den Stränden von Long Island. Damals war ich nur eine junge Schwimmerin, die mehr von der Magie einer Illusion erleben wollte, in einem Element zu Hause zu sein, das nicht für Menschen wie mich gemacht ist.
Was ich damals erlebte, begleitet mich bis heute – drei Jahrzehnte später bin ich eine erwachsene Frau, die beinahe täglich zum Vergnügen schwimmt, und doch frage ich mich, welcher tiefere, primitivere Instinkt uns dabei antreibt. Das Paradox des Wassers als Quelle von Leben und Tod zieht uns an, und wir haben unendlich viele Wege gefunden, uns darin zu verhalten. Nicht jeder schwimmt, aber jeder kann eine Geschichte davon erzählen. Bei der Betrachtung dieser universellen Erfahrung – und universell ist sie, ob wir nun das Wasser fürchten oder nicht, ob wir es lieben oder meiden, irgendwann in unserem Leben machen wir diese Erfahrung – trainieren wir unseren Überlebenstrieb und erleben einen stillen Triumph darin, in diesem Medium bestehen zu können. Gemeinsam springen wir in Schwimmbecken, suchen Wasserstellen und tauchen unter in der Suche nach dem Köder, der uns in die Tiefe zieht. Wir entdecken eine ganze Welt. Lassen Sie uns schwimmen gehen.
Wir beginnen mit einem Schalentier.
1: Urzeitschwimmer
1
Urzeitschwimmer
Die Abalone will sich nicht vom Felsen lösen. In fünf Metern Tiefe stoße ich das Muschelmesser unter die Schale, zwischen den Fußmuskel der Schnecke und den Felsen, an dem sie sich festkrallt, und hoffe auf das versprochene Ploppen. Nichts geschieht.
Ich versuche es noch einmal, die Atemluft blubbert mir aus der Nase, während ich versuche, mich gegen die Strömung zu stemmen, die mich vor und zurück wirft. Immer noch nichts. Diese Abalone spürt offenkundig meine Anwesenheit und hat sich fest verschlossen. Wenn das mal geschehen ist, so muss ich feststellen, dann wird es fast unmöglich, sie abzulösen.
Nach Abalonen, auch Seeohren genannt, zu tauchen ist ein spannender, aber gefährlicher Sport. Die Schnecken sind schwer zu finden; ich habe mich in den Gewässern des Salt Point State Park an der einsamen, mäandernden Sonomaküste zweieinhalb Stunden nördlich von San Francisco auf die Jagd begeben. Gefahren gibt es reichlich: kaltes Wasser, Rippströmungen, Felsen, Seegraswälder, heftige Brandung und Haie. Dennoch machen sich in jeder Saison von April bis November Tausende hoffnungsfroher Schwimmer an die Küste Nordkaliforniens auf, um ihr Glück bei der Jagd nach Abalonen zu versuchen. 6 Die wilde rote Abalone ist die größte der Welt, sie kommt nur an der nordamerikanischen Westküste vor. Hier kann ich in die Rolle einer prähistorischen Jägerin schlüpfen und ohne jede Erfahrung nach meinem Abendessen tauchen.
Ich besitze eine Lizenz zum Gerätetauchen, aber mit den Jahren habe ich gemerkt, wie mich die Gerätschaften einengen und behindern, wenn ich im Wasser bin. An diesem Küstenabschnitt sind Sauerstoffflaschen verboten, und wer hier nach Abalonen taucht, ist über seine Fähigkeiten im Schwimmen und Luftanhalten hinaus nur mit wenigen Werkzeugen ausgestattet. Diese Art der Jagd zurück zu den Wurzeln und reduziert auf Mensch gegen Natur führt allerdings auch dazu, dass jede Bucht an diesem Küstenabschnitt, wie die Ranger sagen, ein Friedhof ist. 7 Allein während der ersten drei Wochen der Saison 2015 starben vier Menschen beim Tauchen nach Abalonen. Auch erfahrene Taucher können nicht ewig die Luft anhalten, und Sportler, die es gewohnt sind, einen gut gefüllten Luftvorrat auf dem Rücken mit sich zu führen, geraten in Panik, wenn sie das merken. Zudem ist es schwer, in dem trüben Wasser die Orientierung nicht zu verlieren, und die Dünung unter Wasser kann einen gegen die Felsen schleudern und dann hinaus aufs Meer ziehen.
Trotzdem will ich es versuchen. Ich lerne, wie man die geriffelten Lippen aus schwarzem Gewebe, das Gehäuse der Schnecken, an einem schroffen Felsabhang erkennt. Mit einiger Anstrengung gelingt es mir, eine abzulösen, dann noch eine. Ein ganz alter, erbsengroßer Teil meines Gehirns wird zum Leben erweckt, als ich mit einer Klappmesserbewegung nach unten tauche, den Blick fest auf die Beute gerichtet, und schließlich eine drei Kilo schwere Abalone aus dem Wasser hebe. Ich brauche beide Hände, um sie hochzuhieven, und beide Füße, um mich vorwärtszustoßen, und noch ehe mein Kopf die Wasseroberfläche durchbricht, spüre ich schon, wie meine Lippen sich zu einem breiten Grinsen verziehen.
Noch nie habe ich das Bedürfnis verspürt, für das Frühstück einen Vogel zu erlegen oder für das Abendessen einen Hirsch zu jagen. Aber von dem Moment an, als ich die Schnecke erblicke, ist sofort der Anreiz da, mir mein Mittagessen zu ertauchen. Da gibt es noch etwas für mich über den Akt des Schwimmens zu begreifen, etwas Existenzielles, das mehr ist als bloße Bewegungsübung. Später bereite ich auf meiner Terrasse das Fleisch zu, säubere, schneide und klopfe es weich – ja, mit einem Stein –, gare es über einer Flamme und verköstige meine vierköpfige Familie mit einer Mahlzeit, die ich ganz allein mit meinen Händen, meinem Körper und meinem Atem besorgt habe. Es ist ein allgemein bekanntes Symptom des modernen Lebens, dass wir von unseren Nahrungsquellen entfremdet sind. Das Tauchen nach Nahrung lässt mich für einen Moment diese Verbindung wiederherstellen. Als ich abends meine Hände wasche und das Wasser im Waschbecken abfließen sehe, erinnere ich mich an das Wasser, das rhythmisch zwischen die Felsen an der Küste schoss, und an das Gefühl, zuzusehen, wie es wieder aufs Meer hinausgesogen wurde.
Die erste bekannte Darstellung von Schwimmern findet sich mitten in einer Wüste. 8 Irgendwo in Ägypten, nahe der libyschen Grenze, auf dem entlegenen und zerklüfteten Gilf-el-Kebir-Plateau, tummeln sich an einer Höhlenwand Brustschwimmer im Wasser.
Die »Höhle der Schwimmer«, 1933 von dem ungarischen Forscher Ladislaus (László) Almásy entdeckt, birgt diese prähistorischen Zeichnungen, die Figuren in verschiedenen Unterwasserpositionen darstellen. Archäologen zufolge sind die Bilder vor mindestens 4000 Jahren entstanden. Zu der Zeit, als Almásy die Höhle entdeckte, war die Vorstellung, dass die Sahara möglicherweise nicht schon immer Wüste war, eine radikale Idee. Die Theorien über einen Klimawandel, der eine gemäßigte Zone in eine dürre, hyperaride Wüste verwandeln könnte, waren so neu, dass der Herausgeber von Almásys Bericht Unbekannte Sahara aus dem Jahr 1934 sich veranlasst sah, das Buch mit Fußnoten zu versehen, in denen er seinen eigenen Zweifeln Ausdruck verlieh. Doch Almásy selbst war aufgrund der Zeichnungen überzeugt, dass es in der unmittelbaren Umgebung der Höhle ein natürliches Gewässer gegeben haben musste und die Schwimmer selbst die Zeichnungen angefertigt hatten, während das Seewasser um ihre Füße spielte. Wo jetzt ein Meer aus Sand ist, floss damals Wasser. Während das eine Medium flüssiges Leben war, schien das andere seine ausgetrocknete, felsige Antithese zu sein, so dachte Almásy – und doch war beides miteinander verbunden. 9
Wie sich herausstellte, hatte Almásy recht. Jahrzehnte später fanden Archäologen nicht weit von der Höhle ausgetrocknete Seen, die auf eine Zeit hinweisen, als die Sahara noch grün war. 10 Almásys Deutung der Schwimmer in der Wüste sollte durch eine bemerkenswerte Fülle geologischer Beweise bestätigt werden, die zeigten, dass diese Landschaft früher voller Seen war, bis hin zu den überraschenden Funden von Flusspferdknochen und Relikten vieler anderer Wasserlebewesen, darunter Riesenschildkröten, Fische und Muscheln. Diese Feuchtperiode wurde als »die grüne Saharazeit« bezeichnet.
Vor Kurzem las ich in einer alten Ausgabe des National Geographic über einen Paläontologen namens Paul Sereno, der ebenfalls Almásys Annahme bestätigte. 11 Im Herbst des Jahres 2000 suchte Sereno in einem anderen Teil der Sahara, am südlichen Ende in der von Konflikten heimgesuchten und wenig erforschten Region Niger, nach Dinosaurierknochen. Dort in der offenen Wüste, etwa 180 Kilometer von Agadez, der größten Stadt des Landes, entfernt, kletterte einer der Fotografen der Expedition eine abgelegene Gruppe von Dünen hinauf – und stieß auf eine große Zahl von Skeletten. Die stammten allerdings nicht von Dinosauriern oder Flusspferden.
Die ausgewaschenen, windgepeitschten Sanddünen gaben Hunderte menschlicher Skelette und Keramikscherben von Gefäßen frei, von denen manche bis zu 9000 Jahre alt waren. Einige der Gefäße waren mit Wellenlinien geschmückt, andere mit Punkten. Der Grabplatz, von Wissenschaftlern nach dem Tuaregnamen für diesen Ort Gobero genannt, gehört zu den umfangreichsten und ältesten urzeitlichen Grabfunden. Offenbar war die Sahara der »grünen Zeit« genau so ein Ort, wo die prähistorischen Schwimmer gelebt haben könnten.
An einem eiskalten Januarnachmittag treffe ich Paul Sereno in seinem Forschungslabor für Fossilien an der University of Chicago, wo er seit dreißig Jahren lehrt. Es gibt nicht viele auf urgeschichtliches Schwimmen spezialisierte wissenschaftliche Arbeiten, deshalb möchte ich ihn bitten, mir zur helfen, ein Bild von dieser prähistorischen Welt zu entwerfen. Sereno selbst ist kein großer Schwimmer, aber er hat viel Zeit darauf verwendet, über die Schwimmfähigkeit sowohl von Dinosauriern als auch von Menschen nachzudenken (er gehört zu den Wissenschaftlern, deren Forschungsergebnisse dazu führten, dass der Spinosaurus aegyptiacus als der erste bekannte schwimmende Saurier anerkannt wurde). 12 Sereno umweht ein Hauch von Indiana Jones – die Lederjacke und den rastlosen Enthusiasmus hat er auch und wurde schon einmal von der Zeitschrift People unter die »50 Most Beautiful People« gezählt. 13
Ich bitte Sereno darum, mir eine prähistorische Umgebung zu beschreiben, in der man schwimmen konnte. Er sagt, in der grünen Saharazeit vor zehntausend Jahren sei Gobero so etwas wie »Daytona Beach in der Wüste« gewesen: ein riesiges Gebiet miteinander verbundener flacher Gewässer, viele von ihnen nur etwa drei Meter tief mit Sandbänken, die es den Menschen erlaubten, in die Gewässer hinauszulaufen.
Wissenschaftler haben dieses Gebiet aus Steinzeitseen »Paläosee Gobero« genannt. Eine seiner entscheidenden geografischen Besonderheiten war eine Gesteinsverwerfung auf der einen Seite, die zwei Auswirkungen hatte. Zum einen staute sie das tiefe Grundwasser, sodass immer genug Wasser vorhanden war, selbst wenn es einmal lange Zeit nicht regnete. Zum anderen fungierte sie, wenn es regnete oder das Grundwasser stieg, als ein natürlicher Damm, der von Zeit zu Zeit überlief, wodurch der Wasserstand in den Seen reguliert wurde. Diese Flachwasserlandschaft entstand und verging wieder, aber sie war doch lange genug intakt, sodass Menschen viele Tausend Jahre an ihren Ufern leben konnten. Die Begräbnisstätte enthielt die Überreste zweier unterschiedlicher Populationen von Menschen, zwischen deren Auftreten die Region für einen Zeitraum von tausend Jahren nicht besiedelt war, weil die Seen verschwunden waren und die Menschen der ersten Population sich einen anderen Lebensraum suchten. Tausend Jahre später waren wieder Seen da, und eine andere, kleinwüchsigere Population besiedelte die Gegend. Dieses Erblühen und erneute Austrocknen der Sahara war, wie Sereno sagt, der umfassendste Klimawandel seit der letzten Eiszeit vor 12000 Jahren.
In Gobero stieß man auf große Haufen zerbrochener Muschelschalen – so viele, dass Sereno davon ausgeht, dass die Menschen dort nach Muscheln tauchten oder sie am Strand sammelten. Zudem weisen weitere Funde darauf hin, dass dies nicht die einzige Art war, wie sie sich Nahrung beschafften. Man fand geschnitzte Angelhaken und säuberlich geschliffene, aus Kieferknochen von Krokodilen gefertigte Harpunenspitzen mit Widerhaken. Sereno und sein Team fanden sogar vier Harpunen an einer Stelle, wo früher der Grund eines Sees gewesen war. »Wahrscheinlich hatten sie Boote«, meint Sereno. »Aber wir haben keine Ahnung, wie die aussahen oder woraus sie gemacht gewesen sein könnten. Und nachdem wir die Harpunen mitten im See gefunden haben, würde ich vermuten, dass die Fischer wahrscheinlich auch neben ihren Booten herschwammen.«
Serenos Team entdeckte auch schwere Steine mit flachem Boden – sie vermuten, dass dies Gewichte waren, um Buntbarsche und Welse mit Netzen zu fangen. In einem Raum des Labors, in dem die Forscher Gegenstände für Ausstellungen reinigen und vorbereiten, gibt er mir einen solchen ovalen Stein, glatt, braun gesprenkelt und mit einem ordentlichen Gewicht. Die prähistorischen Fischer harpunierten in diesem See beachtliche Mengen Fische und zogen sie an Land, so zum Beispiel den Nilbarsch, ein Süßwassermonstrum, das bis zu 1,80 Meter lang und mehr als 180 Kilogramm schwer werden kann. 14 Obwohl sein Bestand heute abnimmt, stellt dieser Fisch in vielen Teilen Afrikas immer noch eine wichtige Nahrungsquelle dar.
Im Labor des berühmten Paläontologen begegnet mir vieles, was mich überrascht. Sereno geht recht unbekümmert mit den Teströhrchen mit unschätzbar wertvoller DNA von Frühmenschen um, die schon eingetütet auf seinem Schreibtisch stehen (und darauf warten, zur Analyse versandt zu werden) und mit dem halb fertigen Dinosaurier einer neuen Art (der in seinem Schrank darauf wartet, einen Namen zu bekommen). Wahrscheinlich würde man selbst solche Dinge auch herumliegen lassen, wenn man von einer derart ausufernden Neugier beseelt wäre, die einen unablässig davon abhält, sich an die Schreibtischarbeit zu machen.
»Haben Sie schon einmal die Mumie eines Dinosauriers gesehen? Ich liebe Mumien!«, ruft er aus, als er mich einlädt, ein seltenes Dinosaurierfossil anzuschauen, das noch die Struktur der Haut erkennen lässt. Ich fahre mit den Fingern leicht über die Vertiefungen und Falten der Oberfläche. Sofort kommt mir das Wort Dinosaurierleder in den Kopf, und ich platze auch gleich damit heraus. Sereno erlaubt mir, alles im Labor anzufassen – von scharfen Pfeilspitzen und zerbrechlichen Tongefäßen über die Knochenplatte eines Stegosaurus und sogar die Überreste eines T. Rex! Die quasi körperliche Anwesenheit der Geschichte verbunden mit Serenos Enthusiasmus und seinen Erklärungen, die wie ein Wasserfall auf mich niedergehen, ist mehr als faszinierend. Ein kleiner Ausflug in die prähistorische Zeit.
Trotz aller Beweise können wir immer noch nicht sagen, wie die Menschen vom Paläosee Gobero geschwommen sind – das Frustrierende an der Untersuchung über das Verhalten der frühen Menschen am und im Wasser ist, dass sich davon keine Spuren erhalten haben. Was Sereno und sein Team zeigen können, ist, dass die Menschen der grünen Saharazeit ein Leben als Jäger und Sammler führten, wenn nötig auch ins Wasser stiegen und ansonsten am Ufer blieben.
Ich stelle mir gerne vor, dass diese Urmenschen ihre Muschelberge genauso ertauchten wie ich selbst meine Abalonen – durchaus strampelnd und zappelnd und keuchend, aber auch mit Staunen und Freude. Es ist nicht schwer sich vorzustellen, wie das vonstattenging – ich muss nur an meine eigenen Söhne denken, die nie glücklicher sind als bei Ebbe in Bolinas, einem kleinen Ort etwa eine Stunde nördlich von unserem Wohnort Berkeley in Kalifornien. Morgens hängt oft noch Bodennebel über der silbrig glänzenden Lagune. Die Jungen rennen in den matschigen Mulden herum, die das ablaufende Wasser hinterlassen hat, und springen über dunkel-sandige Rinnsale. Sie sausen bis zur Wasserlinie des rastlosen Meeres und zurück. Bewerfen einander mit Seetang. Bauen Sandburgen und erklären sich dabei gegenseitig in allen Details die Miniaturwelt, die sie gerade erschaffen haben, bevor sie dann alles in einer großen Sintflut untergehen lassen. Ich beobachte, wie sie in der Brandung tanzen und dabei ständig erproben, wie sicher sie sich fühlen. Beide lieben das Meer. Felix, der Ältere, kann schon seit längerer Zeit schwimmen, aber Teddy, der Jüngere, traut sich noch nicht recht in ein Wasser, das sich von selbst bewegt.
Vielleicht hat es vor vielen Tausend Jahren auch genauso begonnen. Ein Mädchen sucht Muscheln am Rande des Steinzeitsees. Seit sie denken kann, ist das ihre Aufgabe gewesen. Sie sieht die Muscheln dort, wo das Wasser tiefer wird. Vielleicht sind diese Muscheln größer als die, die sie im flachen Wasser erreichen kann. Eines Tages denkt sie, dass sie vielleicht die Luft anhalten könnte, um dorthin zu gelangen. Stück für Stück wagt sie sich hinein und wieder zurück, wieder hinein und wieder zurück, stößt sich mit den Zehen vom sandigen Boden ab und strampelt wie ein Frosch mit den Beinen, um den Kopf über Wasser zu halten. Wochen vergehen, vielleicht Monate. Strampeln und Keuchen gehen langsam in etwas über, was sie beherrschen kann. Nun weiß sie, wie sie sich problemlos über Wasser halten kann, wie sie dabei ihre Kräfte spart und wie sie dann ihren Körper zusammenklappen und in die Tiefe hinabschießen kann, wenn sie dort eine vielversprechende Muschel entdeckt hat. Sie hat erfolgreich Zugang zu einem neuen Lebensmittelvorrat gewonnen. Nun beginnen andere damit, ihre Schwimm-und-tauch-Methode nachzuahmen.
Solche greifbaren Gegenstände aus längst vergangenen Zeiten ansehen zu können hat etwas Magisches – Schau her! Hier haben sie gelebt, hier, wo wir gerade stehen. Auf einen geschwungenen Armreif aus Nilpferdelfenbein zu zeigen und zu sagen: Das hat sie getragen. Die gezackte Spitze eines Speeres in die Hand zu nehmen und sich vorzustellen, wie diese Jäger im Wasser tauchen, graben und schwimmen. Steinzeitmenschen! Genau wie wir!
Diese Urmenschen waren gewieft genug, um Flusspferden und Krokodilen auszuweichen, die in ihren Gewässern unterwegs waren, und sie hatten Zeit genug, das Schwimmen zu erlernen, weil sie nicht auf der Suche nach Wasser oder Nahrung die Gegend durchstreifen mussten. Der See und der darin enthaltene Reichtum an Tieren ermöglichten es diesen Gesellschaften, jahrtausendelang an seinem Ufer ein gedeihliches Auskommen zu finden. Vielleicht waren auch die Höhlenzeichner an einem anderen Ort während derselben Feuchtperiode in der grünen Zeit der Sahara Schwimmer.
Obwohl die frühesten Beweise für das Schwimmen von Menschen höchstens 9000 Jahre alt sind, wusste man wahrscheinlich schon viel früher, wie man schwimmt. Unser moderner Mensch, Homo sapiens, entwickelte sich ungefähr vor 200000 Jahren aus einer heute ausgestorbenen Menschenart. 15 Es gibt Beweise dafür, dass diese Urmenschen auch schon zur See fuhren. 16 Im Jahr 2008 entdeckte ein Forscherteam in Gesteinsschichtungen in der Nähe von Höhlen an der Südküste von Kreta Handäxte aus Quarzgestein, die Hunderttausende Jahre alt waren. Die groben Werkzeuge waren anders als alle, die man bisher dort gefunden hatte, und erinnerten stark an Gerätschaften, die der Homo erectus benutzt hatte, eine Menschenart, die in Afrika und auf dem europäischen Festland gelebt hatte. Nachdem Kreta schon seit mindestens fünf Millionen Jahren vom Festland getrennt war, mussten diese Vorfahren über das offene Meer auf die Insel gekommen sein. Dies war der Beweis dafür, dass Menschen im Mittelmeer schon Zehntausende Jahre früher zur See fuhren, als die Wissenschaftler bis dahin angenommen hatten. Solche Fahrten über das offene Meer sind aber schwer durchführbar, wenn man nicht schwimmen kann oder zumindest mit dem Wasser vertraut ist.
Sogar die Neandertaler, eine uns nahestehende, aber ausgestorbene Menschenart, könnten zur Nahrungssuche geschwommen sein. Ich frage den britischen Anthropologen Chris Stringer danach, der sich mit den Neandertalern beschäftigt und am National History Museum in London als Experte für den Ursprung des Menschen tätig ist. Die Funde seines Teams in Höhlen auf Gibraltar haben gezeigt, dass die letzten Neandertaler, die noch gleichzeitig mit dem modernen Menschen lebten, sich vor ungefähr 28000 Jahren auch aus dem Meer ernährt haben. 17 An einer Flussmündung sammelten die Neandertaler Muscheln, dort fingen und schlachteten sie Fische, Delfine und Robben, die sie dann in Höhlen schleppten, um sie über dem Feuer zuzubereiten. Wie fingen die Neandertaler diese Fische, Delfine und Robben? Wir wissen nicht, ob oder wie sie schwammen, aber die Verteilung der Gebeine von Meerestieren in den Schichten der Höhlen zeigt, dass die Neandertaler eine lange Tradition des Wissens und der Vertrautheit im Zusammenhang mit den Ressourcen des Meeres besaßen, wie man sie sonst vor dem Auftreten des modernen Menschen kaum nachweisen kann.
Aber wenn mich der Tauchgang nach den Abalonen etwas gelehrt hat, dann wie leicht einem das Schwimmen erscheinen kann – und wie schnell man die Gefahren vergessen kann. Sereno erzählt mir von der Entdeckung in Gobero, die ihn am meisten beeindruckte und die tatsächlich mit Schwimmen und Ertrinken zu tun hat. Es war eine anrührende Grabstelle am Rande des Paläosees, die sein Team die »Steinzeitumarmung« getauft hat: Drei Menschen, eine ungefähr dreißigjährige Frau und zwei etwa fünf und acht Jahre alte Kinder, lagen eng zusammen, die Hände ineinander verflochten.
»Es war eine spektakuläre Grabstelle, bei deren Freilegung drei Schädel zum Vorschein kamen«, erinnert sich Sereno an die heikle Ausgrabung. Das Team ging sehr umsichtig vor, weil die Umstände schwierig waren. Loser Sand verhält sich wie Wasser, immer wenn man ihn gerade weggefegt hat, fließt neuer nach.
Die besondere Stellung der Körper – die Arme ausgestreckt, die Hände ineinander verschränkt – berührte alle Expeditionsteilnehmer. Diese Anordnung ließ eindeutig auf eine zeremonielle Bestattung schließen, so Sereno. Wie eine entnommene Sandprobe später ergab, waren dort Blumen aus der Gattung Celosia (Brandschopf), die zur Familie der Fuchsschwanzgewächse gehört und in vielen verschiedenen Farben vorkommt, abgelegt worden. Unter den Körpern fand man aus versteinertem Holz gefertigte Pfeilspitzen. Sie wurden geröntgt und mit einem Elektronenmikroskop gescannt. Die Analyse ergab, dass sie unbenutzt waren und somit wahrscheinlich aus zeremoniellen Gründen bei den Toten platziert worden waren. Als man die Skelette untersuchte, zeigten Knochen und Zähne keinerlei Anzeichen von Verletzung oder Krankheit.
Sereno fragt mich, ob ich die Menschen von Gobero treffen möchte. Jetzt und hier. Er führt mich in die Ausstellung, wo die Ausgrabung der drei Toten dokumentiert ist, weist mich auf die Pfeilspitzen, die gesunden Zähne, die bewusste Anordnung der Körper hin. Obwohl die vielen handfesten paläontologischen Fundstücke, die mich hier umgeben – die Dinosaurier, die anderen urzeitlichen Wassertiere –, sehr beeindruckend sind, berührt mich die Begegnung mit den menschlichen Skeletten doch noch viel mehr. Ich spüre, dass die Geschichte, die dort mit ihnen begraben wurde, mich am meisten fasziniert. Die »Steinzeitumarmung« ist im Grunde etwas, was jeder von uns kennt: Die drei (eine Mutter und ihre Kinder?) starben zusammen, unerwartet (ertrunken?), und irgendjemand (ein liebender Ehemann und Vater?) nahm sich die Zeit, um ihnen ein aufwendiges Begräbnis zu schenken.
Sereno bestätigt einige meiner Vermutungen. »Wann kann man eine Leiche schon so herrichten? Man muss schließlich die Totenstarre und die Verwesung in der Sonne beachten«, erklärt er. »Es war also ein plötzlicher Tod. In der Nähe des Wassers. Ich vermute, dass die drei im Paläosee Gobero ertrunken sind.«
Es ist die zeitlose Geschichte vom schlimmsten Albtraum aller Eltern. Ich weiß, wie es ist, als Kind am Strand zu spielen und herumzutollen. Und ich weiß, wie es nun als Mutter ist, wenn ich meine zwei jungen Söhne dabei beobachte, wie sie schwimmen lernen und sich im Wasser erproben. Damals wie heute liegen das Schwimmen und das Ertrinken erschreckend nah beieinander. Und das wird auch so bleiben, egal wie gut wir gelernt haben zu schwimmen.
Die Feuchtperioden, unterbrochen von langen Dürreperioden, haben auch dazu geführt, dass die Zeugnisse aus der Vergangenheit bis in unsere Tage überdauert haben und wir sie finden konnten. In der Tragödie des dreifachen Begräbnisses liegt der Anfang von allem, und eine andere ewige Geschichte ist natürlich die von der untergegangenen Welt. Eine periodische Veränderung der Erdumlaufbahn lenkte den afrikanischen Monsunregen weiter nach Norden und ermöglichte die grüne Saharazeit; Gobero ist das einmalige Zeugnis der Menschen, die dort lebten. Die Relikte dieser Menschen haben für uns heute, da Meeresspiegel und Temperaturen höher steigen als je gemessen, eine besondere Aussagekraft.
Vielleicht werden auch wir bald vom Wasser überflutet, und diesmal ist unser eigenes Handeln für den dramatischen Wandel der Erdoberfläche verantwortlich. Im Jahr 2030 soll sich die Zahl derer, die von Hochwassern betroffen sind, verdreifacht haben. 18 In Kalifornien, wo ich lebe, könnte sich der Meeresspiegel bis zum Ende des nächsten Jahrhunderts um fast drei Meter anheben und damit mehr als die Hälfte aller Strände im Golden State mit sich davonspülen. 19 Weltweit könnte der Anstieg des Meeresspiegels Hunderte von Millionen Menschen zu Flüchtlingen machen. 20
2: Du bist ein Landsäugetier
2
Du bist ein Landsäugetier
Die meisten Säugetiere besitzen instinktiv die Fähigkeit zu schwimmen, der Mensch aber nicht. 21 Elefanten, Hunde und Katzen sind Schwimmer (wenngleich Letztere nur widerwillig), und sogar Fledermäuse können schwimmen (und zwar ziemlich gut). Menschen und andere große Primaten, wie etwa Schimpansen, müssen es erst lernen. 22 Einige Wissenschaftler vermuten, dies hinge damit zusammen, dass sich die Anatomie der großen Affen eher dahin entwickelte, gut in Bäumen klettern zu können. In den wenigen Experimenten, in denen Wissenschaftler einem Affen das Schwimmen beibringen konnten, zeigte sich, dass die Affen sich eher durch froschartige Fußbewegungen fortbewegten als durch das Paddeln mit den Armen, wie andere Säugetiere es tun.
Paul Sereno erklärt mir, dass wir zwar von den Fischen abstammen, aber nun seien wir »Landtiere, die zu schwimmen versuchen. Wir sind das, was man einen sekundären Schwimmer nennt.«
Doch das ist noch kein Grund, enttäuscht zu sein. Der Paläobiologe Neil Shubin weist darauf hin, dass die Struktur des menschlichen Körpers das Vermächtnis urzeitlicher Fische, Reptilien und anderer Primaten ist. In einer auf seinem Buch Der Fisch in uns basierenden Dokumentation aus dem Jahr 2014 sagt Shubin, man könne »als Paläontologe für Fische auch die menschliche Anatomie sehr gut erklären, weil oft der Blick auf andere Kreaturen der beste Weg ist, um den eigenen Körper zu erklären«. Das Vermächtnis der Fische etwa sind ihre Gräten und unsere Knochen, die beide ihren Ursprung in derselben Gruppe von Zellen haben.
In uns existieren faszinierende Hinweise auf unsere Vergangenheit im Wasser. Und wenn es so ist, dass wir Spuren (man könnte auch sagen: »Geister«) anderer Tiere in unserem Körper bewahren, werden bestimmte Funktionen erhalten oder wiedererweckt, wenn wir untertauchen. Hält man ein zwei Monate altes Baby mit dem Gesicht unter Wasser, dann hält das Baby für mehrere Sekunden die Luft an und verlangsamt seinen Herzschlag, um Sauerstoff zu sparen. 23 Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich schwimmend in Sicherheit bringen wird, wenn man es in einen Pool wirft. Wenn die Babys älter werden und sich ihr neurologisches System entwickelt, wird dieser Reflex als Teil einer ganzen Reihe primitiver, urzeitlicher Reflexe wie Saugen oder Greifen immer schwächer.
Doch Menschen sind Nachahmer. Wir lernen durch Beobachtung: alles von Bewegungsmustern bis hin zum Lesen der Emotionen unseres Gegenübers, von der Herstellung von Werkzeugen über Nahrungspräferenzen bis hin zu den Ideen von Fairness, Paarungsverhalten und Sprache. »Der Schlüssel zum Verständnis, wie sich die Menschen entwickelten und warum sie so anders sind als andere Lebewesen, ist die Erkenntnis, dass wir eine kulturelle Spezies sind«, schreibt der Evolutionsbiologe Joseph Henrich, dessen einflussreiche Arbeit sich darum dreht, wie die kulturelle und die genetische Evolution ineinandergreifen. Uns zeichnet ein kumulatives soziales Lernvermögen aus oder, wie Henrich es nennt, die Fähigkeit, eine vielschichtige »kollektive Intelligenz« zu entwickeln. Andere Lebewesen besitzen ebenfalls die Fähigkeit zum sozialen Lernen, die Menschen aber sind einzigartig darin, dies auf einer kumulativen kulturellen Ebene zu tun und so tatsächlich Einfluss auf die genetische Evolution zu nehmen.
Henrich illustriert seine Theorie mittels Fallstudien, die er ironisch »Lost European Explorer Files« nennt: Wenn europäische Entdecker in irgendwelchen neuen, scheinbar unwirtlichen Gegenden strandeten – zum Beispiel in der Arktis oder in Australien –, starben sie ausnahmslos an Hunger, Krankheiten oder weil sie der Umgebung schutzlos ausgesetzt waren, es sei denn, sie hielten sich an die lokale Bevölkerung. Denn die Einheimischen waren robust und gesund, sie wussten sich in den jeweiligen unwirtlichen Gegenden zu behaupten, und das schon seit Jahrtausenden. Gruppen von Menschen kommen zusammen und schaffen einen Wissenspool, wie ihn sich kein einzelner Mensch, sei er noch so klug, binnen eines Menschenlebens erarbeiten könnte. Wie stellt man einen dreizackigen Fischspeer her, woraus macht man ein Feuer, wenn es kein Holz gibt, wie kann man das Gift aus Pflanzen ausschwemmen, um sie genießbar zu machen? Diese Art der kulturellen Evolution geschieht, wie Ur- und Frühgeschichtler nachweisen können, schon seit mindestens 280000 Jahren und hat sich in den letzten 10000 Jahren erheblich beschleunigt.
Eine solche kulturell-genetische Co-Evolution erklärt unter anderem den außergewöhnlichen evolutionären Erfolg unserer Spezies auf diesem Planeten. Einzeln sind wir nicht besonders oder außerordentlich klug. Aber unsere Fähigkeit, über Generationen hinweg einen unendlich wachsenden Informationspool zu erwerben, zu speichern und zu organisieren und weiterzugeben, macht uns klüger als jede Einzelperson oder Gruppe. Die Fähigkeit zu schwimmen und die verschiedenen Weisen, wie wir einander das Schwimmen beibringen, sind Teil dieses kollektiven kulturellen Wissens. Was das Schwimmen angeht, so ist dabei nicht nur wichtig, wie man es macht – also die rein formale Anleitung –, entscheidend sind auch die Geschichten, die wir erzählen und durch die wir die Bedeutung dieses Wissens kommunizieren.
Eine kurze Geschichte von Schwimmhilfen, die uns in den letzten2000Jahren eingefallen sind:
~400v. Chr., Rom: Plutarch beschreibt eine Art Schwimmbrett aus Kork, auf das sich ein vom römischen Feldherrn Camillus ausgesandter Bote legte, um den Tiber zu durchschwimmen, denn die Brücke war von feindlichen Galliern besetzt. 24
14. Jahrhundert, Persien: Die durchsichtige äußere Schicht eines Schildkrötenpanzers dient dazu, die Augen beim Perlentauchen zu schützen. 25
15. Jahrhundert, Italien: Leonardo da Vinci konstruiert einen Sack aus Leder, der mit Luft gefüllt das Atmen unter Wasser ermöglichen soll; er fertigt auch Zeichnungen für Schwimmflossen, einen Schnorchel und andere Auftriebshilfen an. 26
Datum unbekannt, Japan: Die Ama, japanische Apnoetaucherinnen, nutzen eine über eine Umlenkrolle geführte Leine, um sich nach oben zu ziehen, wenn sie beim Schwimmen oder Atmen in Not geraten. 27
18. Jahrhundert, Boston: Benjamin Franklin, Schriftsteller, Staatsmann, Naturwissenschaftler, Erfinder und eine echte Wasserratte, entwirft Flossen in Form ovaler Malerpaletten für die Hände, um im Wasser schneller vorwärtszukommen. 28
1896, irgendwo in Massachusetts: James Emerson lässt eine »Schwimmmaschine« aus Metall patentieren, die einen Schüler über Wasser hält und ihm mit mechanischen Armen und Beinen genau die richtigen Schwimmbewegungen beibringen soll. 29
1908, London: Unter dem Namen »Swimeesy Buoy« werden Zehntausende Schwimmflügel verkauft, die aus dünnem Baumwollstoff genäht und mit Ventilen zum Aufblasen versehen sind. 30
1930, Miami: Ein Schwimmanzug aus dünnen Kiefernholzleisten ist der letzte Schrei, um furchtsame Schwimmerinnen über Wasser zu halten. 31
2017, China: Ein kleiner Tauchscooter mit zwei Propellern, der »WhiteShark Mix«, verspricht jedem Anfänger, er könne »wie ein Champion schwimmen und ein unschlagbarer Star im Wasser werden«.
Manchmal benötigen wir ein wenig Hilfe. Wenn das Gegenstück zur menschlichen Biologie die Kultur ist, liegt unsere Stärke in der Fähigkeit, ein Problem auszumachen und eine Lösung dafür zu finden. Diese obenstehenden Beschreibungen und die Namen der Erfindungen sind für mich eine Art Aquapoesie – der Klang unserer Vorstellungskraft, wenn sie mit der Natur tanzt, um das Unmögliche möglich zu machen.
3: Von Seenomaden lernen
3
Von Seenomaden lernen
I





























