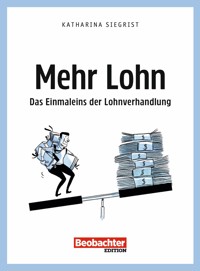22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Beobachter-Edition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Von Anfang an allein mit Kind, getrennt, geschieden oder verwitwet mit Kind – gut 14 Prozent aller Familienhaushalte in der Schweiz sind Einelternfamilien. Meist sind es die Mütter, die den Alltag mit ihren Kindern allein bestreiten, aber auch Väter finden sich, etwa nach dem Tod der Partnerin, in dieser Verantwortung. Wie bringe ich Familienleben und Erwerbsarbeit unter einen Hut? Wo finde ich einen bezahlbaren Betreuungsplatz? Was tun, wenn das Geld nicht reicht? Welches sind die grössten Schuldenfallen? Was ist vorzukehren, wenn die Alimente nicht eintreffen? Und wie ist es um meine Altersvorsorge bestellt? In diesem Ratgeber finden alleinerziehende Eltern praxiserprobte Tipps für den Alltag genauso wie Adressen von staatlichen und anderen Anlaufstellen, die weiterhelfen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Beobachter-Edition
© 2021 Ringier Axel Springer Schweiz AG, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
www.beobachter.ch
Herausgeber: Der Schweizerische Beobachter, Zürich
Lektorat: Wortspalterei | Lektorat + Korrektorat Plüss
Umschlaggestaltung, Konzept und Layout: fraufederer.ch
Umschlagillustration: illumueller.ch
Herstellung: Bruno Bächtold
Druck: CPI Books GmbH, Ulm
ISBN 978-3-03875-393-3
Zufrieden mit den Beobachter-Ratgebern?
Bewerten Sie unsere Ratgeber-Bücher im Shop:
www.beobachter.ch/buchshop
Mit dem Beobachter online in Kontakt:
www.facebook.com/beobachtermagazin
www.twitter.com/BeobachterRat
Die Autorin
Katharina Siegrist ist Beraterin und Redaktorin bei der Zeitschrift Beobachter. Sie hat in Zürich Rechtswissenschaften studiert und danach das Anwaltspatent erworben. Vor ihrer Zeit beim Beobachter hat sie als Rechtsanwältin in einer kleineren Kanzlei gearbeitet. Beim Beobachter-Beratungszentrum berät sie Abonnentinnen und Abonnenten zum Arbeits-, Vertrags- und Familienrecht.
Download-Angebot zu diesem Buch
Die Mustertexte im Anhang und weitere im Buch erwähnte Vorlagen und Rechenbeispiele stehen online bereit zum Herunterladen und Selberbearbeiten: www.beobachter.ch/download (Code: 3759).
Inhalt
Vorwort
Alleinerziehend – das kommt auf Sie zu
Alleinerziehend sein – eine besondere (psychologische) Herausforderung
Bleiben oder gehen?
Die Angst vor dem Alleinsein
Wenn Paare sich trennen
Aus der Wohnung ausziehen
Trennung und Scheidung von Ehepaaren
Das ist besonders, wenn sich Konkubinatspaare trennen
Die Zeit danach: So gelingt ein entspannter Umgang mit Ex-Partnern
Der Streit um die Kinder
Gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel
Alleinige elterliche Sorge
Das Besuchsrecht
Wenn der Partner stirbt
Die Grundregeln beim Erben
Diese Sozialversicherungen greifen im Todesfall
Was passiert mit der elterlichen Sorge?
Porträt: Vera (36)
Alimente und Unterstützung durch die Familie
Unterhaltsbeiträge für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin
Konkubinat: Das Gesetz sieht keine Alimente für den Ex-Partner vor
Der nacheheliche Unterhalt für den Ex-Mann, die Ex-Frau
Die Kindesunterhaltsbeiträge
So werden Kindesunterhaltsbeiträge berechnet
So lange muss man zahlen
Wer trägt die ausserordentlichen Kosten?
Die häufigsten Fragen zum Kindesunterhalt
Die Alimente werden nicht bezahlt oder die Verhältnisse ändern sich
Was tun, wenn die Alimente ausbleiben?
Alimente abändern
Unterstützung durch die Familie
Erbvorbezug und Schenkung
Darlehen
Verwandtenunterstützungspflicht nach Gesetz
Porträt: Markus (40)
Arbeiten, Vorsorgen und Vereinbarkeit
Nach der Trennung oder Scheidung: Wann und wie viel muss ich wieder arbeiten ?
Nach der Scheidung beruflich wieder einsteigen
Habe ich Anspruch auf Arbeitslosentaggeld?
Berufstätig als Mutter oder Vater: Was tun, wenn das Kind krank ist oder Überstunden anfallen?
Beruflicher Wiedereinstieg: So kann er gelingen
Den Stellenmarkt erkunden
Erfolgreich bewerben
Teilzeitarbeit – Rechte und Tücken
Das sind Ihre Rechte bei Teilzeitarbeit
Das gilt, wenn Sie mehrere Teilzeitstellen haben
Habe ich Anspruch auf Familienzulagen?
Porträt: Rebekka (30)
Achtung Altersarmut: Vorsorgen ist wichtig!
Armutsfalle Alleinerziehende
Erziehungsgutschriften der AHV
So berechnen Sie Ihre Altersvorsorge
Vorsorgen bei der Scheidung
Vorsorgen ohne Sparen?
Kunststück Vereinbarkeit
Arbeitsplatz: So kann Vereinbarkeit gelingen
Wie soll ich das alles bewältigen? Sich abgrenzen und Ressourcen schaffen
Porträt: Laetitia (53)
Ausgaben – und ihr Sparpotenzial
Zwei Haushalte kosten mehr als einer
So erstellen Sie ein Budget
Wohnen
Kinderbetreuung
Kinderkrippe
Tagesfamilien/ Tagesmutter
Mittagstisch und Kinderhort
Tagesschule
Kinderbetreuung in der Familie
Nanny
Krankenkasse
So finden Sie eine günstige Krankenkasse
Die Krankenkasse wechseln
Prämienverbilligungen bei der Krankenkasse
Braucht es eine Zusatzversicherung?
Privatversicherungen und Steuern
Welche Versicherungen lohnen sich?
Weitere Versicherungen
So kündigen Sie Ihre Versicherung
Steuern
Allgemeiner Lebensunterhalt
Lebensmittel, Kleider und Schuhe
Haustiere
Handy, Internet und Fernsehen
Ferien und Freizeit
Porträt: Nadja (33)
Mit knappem Budget umgehen
Achtung Schuldenfallen
Konsumkredit
Leasingvertrag
Mit Schulden leben
Budget erstellen und mit Geld umgehen
Stundung oder Ratenzahlung verhandeln
Betreibung erhalten – und nun?
So erheben Sie Rechtsvorschlag
Die Lohnpfändung
Der Verlustschein
Privatkonkurs als letzter Ausweg?
Fonds und gemeinnützige Stiftungen
Welche Stiftung ist geeignet?
Stipendien und Ausbildungsdarlehen
Die Sozialhilfe
So beantragen Sie Sozialhilfe
Sozialhilfe beziehen
Das sind Ihre Pflichten
Konflikte mit dem Sozialdienst oder der Sozialbehörde
Porträt: Maya (45)
Anhang
Musterklauseln, Skalen und Checklisten
Musterklauseln
Lohnfortzahlungsskalen
Budgetvorlage und Checklisten
Nützliche Links
Beobachter-Ratgeber
Dank
Vorwort
In der Schweiz gibt es rund 200 000 Einelternfamilien. Umgerechnet ist dies jede sechste Familie. Auch wenn dahinter die unterschiedlichsten Schicksale und Geschichten stehen, plagen Alleinerziehende oft ähnliche Sorgen: Etwa die Last der Verantwortung, die man nie abgeben kann. Oder Entscheide, die man treffen muss, ohne sich mit einem Gegenüber auszutauschen.
Wenn dazu noch Existenzängste und finanzieller Druck kommen, zehrt das zusätzlich an den Ressourcen. Gerade Alleinerziehende sind besonders armutsgefährdet. Und noch immer ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine besondere Herausforderung.
Alleinerziehende jonglieren so täglich mit einer Vielzahl von Ansprüchen und Bedürfnissen – nicht selten vergessen sie sich dabei selbst. Dieser Ratgeber zeigt Rechte und Ansprüche auf und bietet Hilfestellung und Tipps, wie sich die Herausforderungen des Alltags meistern lassen.
Alleinerziehende leisten jeden Tag Grossartiges. Ihnen ist dieses Buch gewidmet!
Katharina Siegrist
Oktober 2021
Alleinerziehend – das kommt auf Sie zu
Alleinerziehend sein – eine besondere (psychologische) Herausforderung
Fast jede sechste Familie in der Schweiz ist eine Einelternfamilie. Und in beinahe 90 Prozent aller Fälle wohnen die Kinder nach einer Scheidung oder Trennung bei der Mutter. Eine Trennung kann schmerzlich sein – auch finanziell. Neben existenziellen Ängsten plagen Alleinerziehende aber auch noch andere Sorgen: Sie tragen eine Verantwortung für ihre Familie, müssen sich um die Kinder kümmern. Und sollten sich ob all dem auch noch um sich selber kümmern.
Alleinerziehend kann man aus ganz unterschiedlichen Gründen werden – oder man ist es ganz bewusst. Wo es vielen Betroffenen gleich geht: Sie müssen sich – mehr oder weniger plötzlich – mit einer Vielzahl rechtlicher Fragen herumschlagen, sobald sie auf sich alleine gestellt sind. Das schafft Unsicherheit und schürt gleichzeitig Ängste. Nicht jedes Horrorszenario, das man möglicherweise schon vor dem inneren Auge hat, ist begründet. Wer sich frühzeitig mit den möglichen (rechtlichen) Konsequenzen und dem, was er zugut hat, auseinandersetzt, kann eine ausserordentliche Situation selbstsicherer und bestimmter angehen.
Bleiben oder gehen?
Eine Trennung ist normalerweise kein Schritt, den man leichtfertig tut – vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Nicht selten geht einer Trennung ein jahrelanges Ringen und auch Leiden voraus und sind Betroffene über Jahre in einer eigentlichen Gedankenspirale gefangen. Noch schwieriger wird es, wenn man nicht nur für sich alleine, sondern auch für Kinder verantwortlich ist.
Es gibt viele Gründe, die einen – auf den ersten Blick – von einer Trennung abhalten können: Kinder, die noch im Vorschulalter sind, oder ein Haus, das man gemeinsam gekauft hat und auf dem noch eine zehnjährige Hypothek lastet. Lebensumstände, die eine Beziehung belasten, können jedoch auch bloss vorübergehend sein: Auch Vorschulkinder kommen einmal in die Schule, auch der stellenlose Partner findet einen Job. Kann man diese besonderen Lebensumstände als Phasen begreifen, lohnt es sich möglicherweise eher, noch etwas durchzubeissen.
Wie soll ich mich bloss entscheiden?
Wenn sich ein Paar gegenseitig nur noch schadet, die Beziehung ungesund und destruktiv wird, dann lässt sich dies kaum noch kitten und eine Trennung ist meistens unumgänglich. Dennoch ist es erstaunlich, wie Betroffene manchmal jahrelang in einer solch belastenden Situation ausharren. Will man dann noch etwas ändern, müssen beide Partner bereit sein, wohlwollend aufeinander zuzugehen und an sich zu arbeiten. Nicht immer ist das möglich. Es kann sein, dass man dann die Verantwortung für sich (und seine Kinder, siehe S. 37) tragen und die Beziehung beenden muss.
„Seit der Trennung hat sich vieles zum Guten gewendet. Auch weil ich mich von der Idee des Familienlebens in einer Kleinfamilie verabschiedet habe. Ich geniesse die neuen Perspektiven und Lebensmodelle, die sich mir durch die Trennung eröffnet haben.“
MAYA
Es gibt Situationen im Leben, die für eine Beziehung besonders belastend sein können: Sei es, weil der Partner gerade den Job oder einen geliebten Menschen verloren hat oder weil ein Kind geboren wurde. Viele dieser Belastungen fussen nicht in der Beziehung, sondern kommen von aussen und sind letztlich vorübergehend und absehbar. Fragen Sie sich in einer solchen Situation also immer, ob sich die Belastung zumindest bis zur nächsten Phase aushalten lässt oder ob das ganze Beziehungsgefüge derart krankt, dass sich ein Verbleiben in der Beziehung nur noch negativ und ungesund auswirken würde.
„Die meisten Betroffenen bleiben aus meiner Erfahrung tendenziell eher zu lange in einer schwierigen Beziehung, als dass sie zu früh gehen. Wichtig ist, dass man sich nicht im Affekt trennt, nicht dann, wenn es sich gerade am schlimmsten anfühlt. Sondern erst, wenn man verstanden hat, was eigentlich schiefgelaufen ist und welchen Anteil man selber daran hat und welchen das Gegenüber. Erst dann lässt sich abschätzen, ob die Situation und die Beziehung überhaupt noch besser werden können oder ob man sich nicht besser trennen sollte. Ist eine Belastung nur vorübergehend beziehungsweise absehbar, kann es sich lohnen, noch etwas durchzubeissen – sofern beide Partner dazu bereit sind, selbstverständlich. Schwieriger wird es, wenn einer der Partner mit einer Suchterkrankung oder Depression zu kämpfen hat. Da sind die Prognosen eher ungünstig.“
Felizitas Ambauen, Psychotherapeutin FSP
Holen Sie sich professionelle Unterstützung, wenn Sie alleine nicht weiterkommen. Je früher Sie intervenieren, umso weniger braucht es, um aus einer konfliktbeladenen Situation herauszukommen.
TIPPs Ehe- und Familienberatungsstellen beraten Sie in Konfliktsituationen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Wohngemeinde nach entsprechenden Adressen. Anlaufstellen finden Sie auch unter www.paarlife.ch.
Eine Familienmediation unterstützt Paare darin, Konflikte und Auseinandersetzungen gemeinsam zu lösen. Informationen dazu finden Sie auf: www.familienmediation.ch.
Drogen und Depressionen: Wenn der Partner krank ist
Suchterkrankungen, Depressionen, Angststörungen etc. saugen extrem viel Energie und stellen eine Beziehung immer wieder auf die Probe. Nicht selten ist in diesen Fällen eine Trennung der einzige Ausweg.
„Irgendwann musste ich mich entscheiden, um wen ich mich in Zukunft kümmern soll: um meine Partnerin oder um meine Tochter. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Die Zeit mit meiner alkoholabhängigen Partnerin hat sehr viel Kraft und Energie gekostet. Das war noch lange spürbar.“
MARKUS
Wer zu Alkohol oder anderen Drogen greift, dem fällt es häufig schwer, sich mit unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen und diese auszuhalten. Für eine langjährige Beziehung, die auch Krisen überstehen soll, ist aber gerade diese Fähigkeit wichtig. Leider werden es Betroffene kaum schaffen, ihre Sucht in den Griff zu bekommen, sich in absehbarer Zeit mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und daneben auch noch andere Fähigkeiten und Kompetenzen zu erarbeiten, die es für eine funktionierende Beziehung braucht. Eine Beziehung kann damit schnell toxisch werden. Halten Sie sich in diesem Zusammenhang auch immer vor Augen, ob Sie Ihr Kind in einem solchen Umfeld aufwachsen lassen wollen und welche Verletzungen und Schäden es davontragen könnte. Eine Trennung ist möglicherweise das Beste, was man seinem Kind zumuten kann.
Denjenigen, der geht, plagen in solchen Konstellationen häufig grosse Schuldgefühle. Man verlässt den Partner, obwohl dieser einen gerade (vermeintlich) am meisten braucht. Sie tun aber niemandem einen Gefallen, wenn Sie in einer toxischen Beziehung bleiben – auch dem kranken Gegenüber nicht. Hier gilt ebenfalls: Je früher man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, umso einfacher lässt sich eine derart schwierige Situation bewältigen.
INFO An diese Anlaufstellen können sich insbesondere Angehörige psychisch beeinträchtigter oder alkoholkranker Menschen wenden:
–Der Verein Pro Mente Sana berät Angehörige psychisch beeinträchtigter Menschen (Tel. 0848 800 858, weitere Informationen unter www.promentesana.ch).
–Al-Anon ist die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholkranken (www.al-anon.ch).
–Im Dachverband VEVDAJ sind die regionalen und lokalen Vereinigungen von Eltern, Partnern und anderen Bezugspersonen suchtmittelgefährdeter oder suchtmittelabhängiger Menschen zusammengeschlossen (www.vevdaj.ch).
Wegen der Kinder zusammenbleiben?
Sobald Kinder im Spiel sind, verändert sich der Blickwinkel. Viele Betroffene fragen sich dann, was sie stärker gewichten sollen: die Kinder oder die Beziehung. Doch: Es gilt hier, nichts gegeneinander abzuwägen oder gar auszuspielen. Wichtig ist einzig die Frage, ob sich das Kind in der gegenwärtigen Situation (noch) gesund entwickeln kann.
„Nur wegen der Kinder zusammenbleiben? Da stellen sich mir alle Haare zu Berge. Mit diesem Credo kann man viel Schaden anrichten. Manchmal ist eine Trennung nämlich das Beste, was einem Kind passieren kann. Denn: Besser das Kind lebt bei jedem Elternteil separat in einer berechenbaren Welt als in einer von Streitereien und Willkür geprägten Umgebung.“
Felizitas Ambauen, Psychotherapeutin FSP
Kinder brauchen in erster Linie sichere und zuverlässige Bindungen, die möglichst wenig von unberechenbaren Launen geprägt sind. Diese Voraussetzungen sind nicht immer gegeben. Gerade das Willkürlevel ist bei – teilweise schon über Jahre – schwelenden Konflikten hoch. Für Kinder ist es beispielsweise verstörend und damit auch belastend, wenn zwischen seinen Eltern scheinbar aus dem Nichts heraus ein Streit entbrannt, die Stimmung explosiv ist. Schuldzuweisungen («Ich gehe, weil mich dein Vater verletzt hat.») können Kinder in Loyalitätskonflikte versetzen, die sie nicht lösen können und die grosse Not verursachen («Darf ich Papa nun nicht mehr gernhaben? Darf ich Mama sagen, dass ich bei Papa ein schönes Wochenende gehabt habe?»).
Wann und wie den Kindern eine Trennung kommunizieren?
•Kommunizieren Sie die Trennung erst, wenn sie spruchreif ist.
•Kommunizieren Sie die Trennung – wenn immer möglich – gemeinsam. Treten Sie als Team auf. Halten Sie fest, dass Sie die Trennung gemeinsam beschlossen haben. Nicht selten ist dies – zumindest für einen der Partner – sehr schwierig. Aber denken Sie daran: Es kann die Welt Ihres Kindes nachhaltig (positiv) prägen.
•Vermeiden Sie Schuldzuweisungen und Loyalitätskonflikte. Warum die Beziehung letztendlich gescheitert ist, ist Ihre Sache als Paar und für das Kind nicht relevant. Kinder im Schulalter, die um die Hintergründe wissen wollen, verdienen eine altersangepasste Erklärung.
•Geben Sie Ihrem Kind bei jedem Schritt zu verstehen: Wir trennen uns als Paar und nicht als Eltern. Wir sind immer noch deine Eltern und für dich da, auch wenn unsere Liebesbeziehung nun aufhört. Dies hilft übrigens auch schon bei relativ kleinen Kindern.
Die Angst vor dem Alleinsein
Die Angst vor dem Alleinsein ist ein schlechter Ratgeber. Sei dies innerhalb einer ungesunden Beziehung oder nach vollzogener Trennung. Es ist aber ein Gefühl, das viele Alleinerziehende kennen.
Es ist normal, dass Beziehungen mit einer gewissen Abhängigkeit einhergehen. Wenn diese aber überhandnimmt, man sich nichts mehr alleine zutraut und man deswegen in einer unbefriedigenden Situation verbleibt, dann ist dies auf die Dauer ungesund. Die Angst vor dem Alleinsein hemmt uns in jeglicher Hinsicht: Wir können uns selbst nicht weiterentwickeln und unsere Situation auch nicht verbessern. Wir erstarren.
Bei vielen Alleinerziehenden schleicht sich die Angst häufig nach der Trennung ein – dann vor allem, wenn der erste Druck von einem abgefallen ist, man sich im neuen Alltag eingelebt hat und schliesslich plötzlich die Panik hochsteigt, niemals wieder jemanden zu finden, mit dem man sein Leben teilen kann. Viele dieser Ängste haben mit dem eigenen Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun. Dieses kann man trainieren. Etwa indem man Dinge tut, die man gern macht und in denen man sich als sicher und kompetent erlebt. Auch Sport und Bewegung können helfen, eine innere Blockade und Erstarrung zu lösen. Oftmals liegen die Hintergründe aber auch tiefer. Dann lohnt es sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Wenn Paare sich trennen
Eine Trennung beziehungsweise Scheidung steht häufig am Ende eines schon jahrelang dauernden, schmerzhaften Prozesses. Steht sie aber einmal fest, gilt es, die Folgen für beide Seiten verbindlich festzuhalten. Im Idealfall kann man sich gemeinsam einigen.
„ Der Entscheid, sich zu trennen oder scheiden zu lassen, braucht Mut. Wer gut vorbereitet ist und mögliche Konsequenzen kennt, trifft ihn möglicherweise leichter. So schwierig wie gerade eine Scheidung anmutet: Das Leben geht auch danach weiter. Zugegeben, in finanzieller Hinsicht oder in Bezug auf gemeinsame Kinder kann es schwieriger werden. Doch es lohnt sich, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Man hat ja nur eines. Eine Trennung ist vernünftiger, als in einer unglücklichen Beziehung zu verharren.“
Marlène Bernardi, Rechtsanwältin
Die Folgen einer Trennung können einschneidend sein. Sie können das bisherige Leben sogar total umkrempeln – und das nachhaltig. Nicht wenige haben eigentliche Horrorszenarien vor Augen, wenn sie daran denken. Aber: Eine Trennung verliert schnell an Schrecken, wenn man sich bereits im Vorfeld mit den möglichen Konsequenzen auseinandersetzt, sich über seine Rechte informiert und durch eine Fachperson beraten lässt.
Wenn sich Paare einig sind, lassen sich eine Trennung sowie deren Folgen alleine regeln. Nur wenn keine einvernehmliche Lösung möglich ist, entscheidet das Gericht.
Diese Punkte sollten Sie im Fall einer Trennung (schriftlich) regeln
•Wohnsituation: Wer bleibt in der gemeinsamen Wohnung und was kann derjenige, der auszieht, an Hausrat und Möbeln mitnehmen (siehe S. 23)?
•Elterliche Obhut: Bei wem werden die Kinder (mehrheitlich) wohnen (siehe S. 37)?
•Besuchsrecht: Wann und wie lange kann ein Elternteil die Kinder besuchen, zu Besuch oder in die Ferien nehmen (siehe S. 43)?
•Unterhaltsbeiträge für die Kinder: Halten Sie hier auch die Grundlagen fest, also von welchen Einkünften und Lebenskosten Sie bei der Berechnung ausgegangen sind (siehe S. 73). Wichtig: Eine einvernehmliche Unterhaltsregelung ist im Streitfall (beziehungsweise dann, wenn nicht mehr
•Schulden: Braucht es eine Regelung zu Ihren (gegenseitigen) Schulden (siehe S. 28)?
•Speziell bei Ehepaaren:
– Zeitpunkt der Trennung: Wichtig, weil eine Scheidung gegen den Willen des anderen erst dann möglich ist, wenn sie zwei Jahre getrennt sind.
– Ehegatten haben unter Umständen einen Trennungsunterhalt zugut. Auch hier gilt: Halten Sie die Berechnungsgrundlagen fest. Übrigens: Selbstverständlich kann auch ein Unterhalt für einen Konkubinatspartner vorgesehen werden. Einen Anspruch von Gesetzes wegen gibt es aber nicht.
– Wie sollen die noch unbezahlten Steuern vor dem Trennungsjahr bezahlt und wie allfällige Rückzahlungen vom Steueramt unter den Ehegatten aufgeteilt werden?
Download Muster für eine Trennungsvereinbarung
INFO Wer von häuslicher Gewalt – also physischer, psychischer oder sexueller Gewalt innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten Beziehung – betroffen ist, sollte tätig werden. Wenn Sie verheiratet sind, können Sie ans Eheschutzgericht gelangen und bei drohender Gefahr sofortige Schutzmassnahmen verlangen (zum Beispiel: Ausweisung aus der ehelichen Wohnung, Betretungs- und Kontaktverbote). Auch die Polizei kann eine Wegweisung für bis zu vierzehn Tage verfügen. Opferhilfe-Beratungsstellen können Sie unentgeltlich beraten. Auf der Website www.opferhilfe-schweiz.ch finden Sie nützliche Informationen und die Adresse der für Sie zuständigen Beratungsstelle. Frauen in akuten Notsituationen können sich an ein Frauenhaus wenden (www.frauenhaus-schweiz.ch).
Aus der Wohnung ausziehen
Sind Sie verheiratet, darf keiner der Ehegatten den anderen eigenmächtig aus der gemeinsamen Familienwohnung wegweisen (Ausnahme: häusliche Gewalt). Im Idealfall können Sie sich selber einigen, wer bei der Trennung aus der ehelichen Wohnung auszieht und was er vom Hausrat mitnimmt. Im Streitfall kann nur das Gericht einen verbindlichen Entscheid fällen.
INFO Im Streitfall weist das Gericht demjenigen Ehegatten die eheliche Wohnung zur Alleinbenützung zu, dem sie besser dient. Hat das Ehepaar minderjährige Kinder, erhält meistens der Ehegatte das alleinige Wohnrecht, bei dem auch die Kinder zur Hauptsache wohnen. Wer Schuld an den Eheproblemen hat, spielt keine Rolle. Wer der Eigentümer der Liegenschaft oder der Mieter der Wohnung ist, spielt nur eine Rolle, wenn ansonsten beide Eheleute ein gleich grosses Interesse am Verbleib in der Wohnung haben. Bei der Zuteilung des Hausrates gelten die gleichen Kriterien wie für die Zuteilung der ehelichen Wohnung.
Als Konkubinatspaar die Wohnung kündigen und den Hausrat aufteilen
Wenn Sie mit Ihrem Partner einen Mietvertrag unterschrieben haben, können Sie diesen auch nur gemeinsam kündigen. Eine Kündigung, die nur von einem der beiden Mieter unterzeichnet ist, wäre ungültig. Das kann zu einer Pattsituation führen. Dann nämlich, wenn einer der Partner kündigen will, sich der andere aber weigert. Letztlich müsste wohl das Gericht entscheiden und das Konkubinat gemäss den Bestimmungen der einfachen Gesellschaft (Artikel 530 bis 551 des Obligationenrechts) auflösen. Bei wichtigen Gründen wäre dies jederzeit möglich.
Wenn beide Partner in der Wohnung bleiben wollen, stellt sich die Frage, wer ausziehen muss. Das Gesetz sagt nichts dazu – vielmehr hält es eben gerade fest, dass alle Mieter einander gleichgestellt sind und keiner ein besseres Recht an der Wohnung hat. Juristisch lässt sich ein solcher Konflikt also nicht lösen. Wenn man sich nicht einigen kann, könnte so das Los entscheiden.
Trennung und Scheidung von Ehepaaren
Eine Trennung müssen Sie bei keiner Behörde registrieren lassen. Auch die Trennungsfolgen können Sie gemeinsam vereinbaren, ohne dass es hierfür einen Gerichtsentscheid bräuchte.
TIPP Auf der Website der Zürcher Gerichte (www.gerichte-zh.ch → Themen → Ehe und Familie) finden Sie hilfreiche Informationen und praktische Mustervereinbarungen zum Getrenntleben der Eheleute. Diese Vorlagen können auch ausserhalb des Kantons Zürich lebende Eheleute verwenden.
RONJA UND EMIL SIND SICH EINIG, dass sie sich trennen wollen. Ronja ist Pflegefachfrau und arbeitet teilweise in der Nacht oder sonntags. Emil hat sich als Physiotherapeut selbständig gemacht und kann sich seine Arbeitszeit frei einteilen. Die Betreuung der gemeinsamen Kinder Sara und Leonie wollen die beiden flexibel regeln beziehungsweise dem Arbeitsplan von Ronja anpassen. Emil ist einverstanden, monatlich 2000 Franken Kindesunterhalt und 1000 Franken Ehegattenunterhalt zu bezahlen. Ronja und Emil schliessen eine schriftliche Trennungsvereinbarung. Für mehrere Monate klappt das problemlos. Doch plötzlich zahlt Emil nur noch unregelmässig und weniger als das gemeinsam Vereinbarte. Es wird auch immer schwieriger, sich wegen der Kinderbetreuung abzusprechen. Emil hat mittlerweile eine neue Partnerin, mit der er das Wochenende verbringen will. Dass Emil einfach weniger zahlt, bringt Ronja in die Bredouille. Sie mag sich auch nicht immer über die Besuchszeiten streiten. Sie möchte eine klare Regelung und schaltet das Eheschutzgericht ein.
Wenn es ohne Gericht nicht geht: der Eheschutz
Wenn Sie verheiratet sind und sich über die Folgen der Trennung nicht einig sind, können Sie das Getrenntleben gerichtlich regeln lassen. Man spricht hier vom sogenannten Eheschutz, der häufig die Vorstufe zur Scheidung bildet.
Es ist darum wichtig, sich frühzeitig durch eine Fachperson beziehungsweise einen spezialisierten Anwalt beraten zu lassen. Das gilt vor allem dann, wenn Sie sich unsicher fühlen oder wenn sich massive Konflikte um die Kinder und/oder den Unterhalt abzeichnen.
INFO Die Kosten eines Eheschutzverfahrens schwanken von Kanton zu Kanton. Wenn das Verfahren mit einem Vergleich abgeschlossen werden kann, sind sie niedriger (zwischen 1500 und 2500 Franken). Muss das Gericht ein Urteil fällen, können die Gerichtskosten auf über 3000 Franken ansteigen. Hinzu kommen die Kosten für die eigene Anwältin sowie eine allfällige Prozessentschädigung an die Gegenseite.
Der letzte Schritt: die Scheidung
Eine Trennung kann auch ohne Gericht ablaufen. Scheiden kann dagegen nur das Gericht. Wenn beide die Scheidung wollen – ohne sich möglicherweise schon über alle Folgen einig zu sein –, können Sie dem Gericht jederzeit eine Scheidung auf gemeinsames Begehren einreichen. Eine Scheidung gegen den Willen des andern ist hingegen erst nach Ablauf einer Trennungszeit von zwei Jahren möglich.
„Auf was Sie sich bei einem Scheidungsverfahren gefasst machen müssen? Darauf, dass Sie Ihr Leben möglicherweise neu organisieren müssen.“
Marlène Bernardi, Rechtsanwältin
Wie lange ein Scheidungsverfahren dauert (und damit auch, wie teuer es wird), ist sehr unterschiedlich und letztlich davon abhängig, inwieweit sich die Ehegatten über die Scheidungsfolgen einigen können: Während eine einvernehmliche Scheidung in der Regel nur wenige Wochen dauert, kann sich eine Kampfscheidung über Jahre hinziehen. Häufige Streitpunkte sind die Kinderbelange (siehe S. 37), die Alimente (siehe S. 62) und das Vermögen (siehe ab S. 28).
„ Einen Schlussstrich zieht man idealerweise bereits dann, wenn man noch miteinander reden kann. Kampfscheidungen können sehr teuer werden – und zu einer enormen Belastung werden, vor allem auch für die Kinder. Versetzen Sie sich darum auch in deren Lage. Dann kann verletzter Stolz manchmal auch Grosszügigkeit weichen.“
Marlène Bernardi, Rechtsanwältin
Wenn Sie sich über die Folgen der Scheidung einig sind, halten Sie diese in einer schriftlichen Scheidungskonvention beziehungsweise Scheidungsvereinbarung fest. Beim Ausarbeiten einer Scheidungskonvention kann auch eine Anwältin oder ein Mediator helfen.
TIPP Bei den Zürcher Gerichten (www.gerichte-zh.ch → Themen → Ehe und Familie → Scheidung) und im Beobachter-Ratgeber zur Scheidung (siehe Buchtipp links) finden Sie hilfreiche Informationen und praktische Mustervereinbarungen zum Ausarbeiten Ihrer Scheidungskonvention (zum Beispiel eine Muster-Scheidungskonvention für Ehepaare mit minderjährigen Kindern und eine Checkliste, was alles geregelt werden muss). Diese Muster können Sie auch verwenden, wenn Sie sich in einem anderen Kanton scheiden lassen.
INFO Die Gerichtsgebühr bei einer einvernehmlichen Scheidung ist von Kanton zu Kanton verschieden, liegt in der Regel aber zwischen 1000 und 4000 Franken, dazu kommen Schreib- und Zustellgebühren. Hingegen sind die Kosten bei einer strittigen Scheidung gegen oben offen. Muss zum Beispiel ein Gutachten darüber erstellt werden, wie und wo die Kinder am besten betreut sind, kostet dies schnell einmal 15 000 Franken. Hinzu kommen die Kosten für die eigene Anwältin sowie eine Parteientschädigung für die Gegenseite – sollte man in einzelnen Punkten unterliegen.
Das eheliche Vermögen aufteilen und die Schulden regeln
Bei der Aufteilung des ehelichen Vermögens bestimmt das Sachenrecht, wem ein bestimmter Vermögenswert gehört. Das Ehegüterrecht klärt, wie die Eheleute an einem Vermögenswert beteiligt sind und welche gegenseitigen Ansprüche sie daraus ableiten können.
Auch hier gilt: Wenn Sie sich einig sind, können Sie das eheliche Vermögen und die gemeinsamen Schulden aufteilen, wie Sie beide es wollen. Sie können auch bestimmte Vermögenswerte über die Scheidung hinaus gemeinsam behalten, wie zum Beispiel Ihre Liegenschaft.
Wenn Sie keinen öffentlich beurkundeten Ehevertrag abgeschlossen haben, leben Sie unter dem Güterstand der sogenannten Errungenschaftsbeteiligung. Nach deren Regeln wird bei der Scheidung das eheliche Vermögen aufgeteilt. Es ist darum wichtig, dass Sie über die Grundzüge und die Zusammensetzung Ihres Vermögens Bescheid wissen.
INFO Mit einem öffentlich beurkundeten Ehevertrag können die Ehegatten auch einen anderen Güterstand wählen: die Gütergemeinschaft oder die Gütertrennung. Für die güterrechtliche Auseinandersetzung muss man die Eheverträge immer genau prüfen. Ziehen Sie im Zweifel einen spezialisierten Anwalt bei.
Ihre Ansprüche bei der Errungenschaftsbeteiligung
Bei der Errungenschaftsbeteiligung hat jeder Ehegatte zwei Vermögensmassen: das Eigengut und die Errungenschaft.
•Zum Eigengut gehört das Vermögen, das man bereits vor der Ehe hatte. Aber auch das, was einem während der Ehe unentgeltlich, im Rahmen einer Schenkung oder Erbschaft, zugefallen ist. Zudem fallen die Gegenstände zum persönlichen Gebrauch darunter. Gut zu wissen: Es besteht kein Anspruch darauf, dass man das in die Ehe eingebrachte Vermögen oder eine Erbschaft bei der Scheidung 1:1 zurückerhält. Wurde das Geld verbraucht, fällt nur noch ein allfälliger Rest ins Eigengut.
•Zur Errungenschaft gehört all das, was man sich während der Ehe durch eine Erwerbstätigkeit angespart hat, ebenso Vermögen aus Arbeitslosen-, Kranken- und Unfalltaggeldern sowie Renten (AHV, IV, Pensionskasse etc.). Zudem fallen die Erträge aus dem Vermögen darunter (also beispielsweise die Zinsen des Sparkontos oder Mieterträge aus einer vermieteten Liegenschaft), wenn im Ehevertrag nichts anderes abgemacht ist.
TIPP Nicht immer ist es einfach und klar, das Vermögen in diese zwei Gütermassen aufzuteilen. Es ist darum wichtig, dass man Belege dazu gut aufbewahrt. Dabei gilt: Wer im Rahmen der Scheidung ein Vermögen als Eigengut beansprucht, muss dies beweisen können. Im Zweifel wird man in der Regel von Errungenschaft ausgehen, die man mit der Gegenseite teilen muss.
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung behält jeder Ehegatte sein Eigengut. Von der jeweiligen Errungenschaft hat der andere die Hälfte zugut. Gut zu wissen: Die Guthaben der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) werden in der güterrechtlichen Auseinandersetzung geteilt, für die Pensionskassenguthaben gelten andere Regeln (siehe S. 125).
RONJA HAT WÄHREND DER EHE EIN SÄULE-3A-KONTO ERÖFFNET