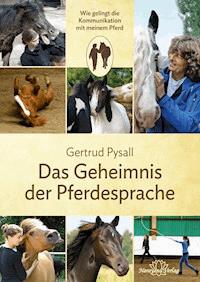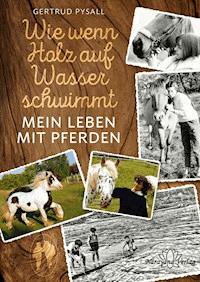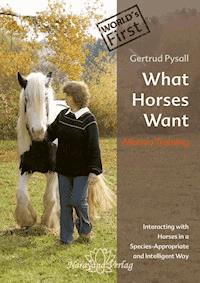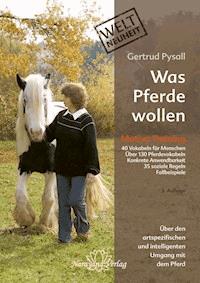
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narayana
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist nicht nur für alle Pferdefreunde eine Offenbarung, sondern auch für die Menschen, die schon immer eine unerklärliche Sehnsucht nach Pferden oder Reiten verspürten. In jahrelanger Arbeit erforschte Gertrud Pysall das Wesen und die Verhaltensweisen von domestizierten Pferden, deren Umgang mit Menschen und die Reaktionen auf das Leben in Stallungen anstatt in freier Wildbahn. Sie gibt jedem Leser wertvolle Hilfen an die Hand, zu einem harmonischen und friedlichen Miteinander zu finden. Die Schwierigkeiten im Umgang mit Pferden lassen sich nicht alleine durch die Liebe zu ihnen lösen. Dieses Buch schafft ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Pferde. Es macht das Pferd nicht zum Täter, sondern weist den Weg zum respektvollen Umgang. In diesem Werk sind erstmalig die sozialen Regeln der Pferde dargestellt. Dies umfasst ca. 130 „Vokabeln“ der Pferde und auch etwa 40 notwendige Kommunikationsgesten für Menschen. Durch ihren Gebrauch wird der Mensch zu einem anerkannten Sozialpartner des Pferdes. Er schafft damit die Grundvoraussetzung für Pferde, sich für ein Vertrauensverhältnis zum Menschen zu entscheiden. Die 2. erweiterte und verbesserte Auflage mit neuem übersichtlichen Layout wurde um weitere Pferde-Vokabeln, viele Fotos zur Erläuterung der Motiva-Einheiten und Vokabeln sowie um ein neues Fallbeispiel ergänzt. „Dieses Buch wird jeden Menschen, der sich dem Pferd verbunden fühlt, zutiefst berühren. Für diejenigen, die offen sind, ihr Verhalten zu hinterfragen, öffnet sich hier eine Tür zu einer einzigartigen, spannenden und noch nie gezeigten Welt, in der ein harmonisches Miteinander von Mensch und Pferd möglich ist und dem Pferd das Verständnis, der Respekt und die Liebe entgegengebracht wird, die diesem wundervollen Geschöpf zusteht! Möge ihr Buch weite Verbreitung finden und zu einem Umdenken in der Pferde- und Reiterszene führen.“ Dr. Shiela Mukerjee-Guzik Tierärztin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gertrud Pysall
Was Pferde wollen
Motiva Training
Über den artspezifischen und intelligenten Umgang mit dem Pferd
Gertrud Pysall
Was Pferde wollen
Motiva Training®
Über den artspezifischen und intelligenten
Umgang mit dem Pferd
1. deutsche Ausgabe 2012
2. überarbeitete und erweiterte deutsche Ausgabe 2013
3. Auflage 2016
ISBN 978-3-95582-152-4
Abbildung S. 2 © Ulrike Henke
Coverabbildung und alle anderen Bilder © Gertrud Pysall und Isabell Schmitt-Egner
Herausgeber: Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Kandern
Tel.: +49 7626 974970-0
E-Mail: [email protected]
www.narayana-verlag.de
© 2013, Narayana Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
„Motiva Training“ ist ein eingetragenes Warenzeichen. Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Wenn wir dem Wesen der Pferde gerecht werden wollen,
Müssen wir sie lassen, wie sie sind
Und ihnen geben, was sie brauchen.
Gertrud Pysall
WIDMUNG
Es gibt Millionen Menschen, die Pferdebesitzer sind, reiten oder einfach nur Pferde mögen. Dieses Buch ist jenen gewidmet, bei denen ich mit meinen Gedanken offene Türen einrenne, und vor allem all jenen Menschen, die durch dieses Buch besinnlich werden, die es schaffen, umzudenken, die sich bemühen, aufgrund dessen ihren Umgang mit Pferden zu verbessern, kurz, die mich mit meinem Anliegen und dadurch die Pferde dieser Welt besser verstehen.
Und außerdem widme ich dieses Buch meinem Bruder Peter Lindemann, der sich jede Woche eine Stunde Zeit für mich genommen und mir geduldig zugehört hat. Er war für mich da, wenn ich Hilfe brauchte.
Das hat mich bei der Erstellung des Buches sehr unterstützt.
Inhalt
Vorwort
Vorwort der Autorin
Einleitung
I. THEORIE
1. Das Pferd in Menschenhand
1.1 Das Pferd als Partner
1.2 Das Pferd als Freund
1.3 Das Pferd als Knecht
1.4 Das Pferd als Statussymbol
1.5 Das Pferd als Therapeut
1.6 Das Pferd als Schüler
2. Der Mensch als Lehrer des Pferdes
2.1 Das Pferd in der Erziehung und Ausbildung
2.2 Das Pferd und Strafe
2.3 Das Pferd und Lob
II. PRAXIS
3. Motiva Training
3.1 Ursprung und Forschung
3.2 Einführung
3.3 Motiva Training – Was ist das?
3.4 Psychologische Gedanken zum Motiva Training
4. Kommunikationssystem
4.1 Die Regeln
4.2 Vokabeln
4.2.1 Ausdruck des Pferdes
4.2.2 Ausdruck des Menschen
4.3 Beispiele zu Aussagen/Signalen im Kommunikationsverlauf
5. Meine Schulungsmethoden
5.1 Kritische Betrachtung der Selbstwahrnehmung
5.2 Erkennen der eigenen Motive
5.3 Konflikterkennung und Wege der friedlichen Konfliktlösung
5.4 Schulung der Körperbewegungen und des Raumgefühls
5.5 Lehrmittel und Hilfsmittel
6. Motiva-Erfahrungen mit Pferd
6.1 Mensch und Pferd
6.2 Pferde unter sich
6.3 Fallbeispiele
Schlussgedanken
Danksagung
Referenzen
Über die Autorin
Index
Vorwort
Vor vielen Jahren stand ich an einem sonnigen Herbsttag nach einer schier endlos erscheinenden Zugfahrt, die meine Familie und mich aus dem tiefsten Bayern in ein 300-Seelen-Dorf am Rande der Eifel geführt hatte, im Garten unseres neuen Heims. Während die Möbelpacker unser Hab und Gut ins Haus schleppten, ließ ich meinen Blick über die angrenzenden Wiesen und Felder schweifen. Da tauchte plötzlich auf der anderen Seite des groben Maschendrahtzaunes ein Pferd auf – wunderschön, groß, dunkelbraun mit schwarzer Mähne und schwarzem Schweif und einem kleinen weißen Fleck auf der Stirn – und schaute mich freundlich an. Ich war gerade einmal neun Jahre alt und bis zu diesem Augenblick hatte ich keine erwähnenswerten Begegnungen mit Pferden gehabt, aber nun verlor ich auf der Stelle mein Herz an „Alex“. Gleichzeitig hatte ich auch Angst vor ihm, da er mir so unendlich groß und stark erschien. Dennoch wagte ich es, seine warme, weiche Nase zu streicheln und empfand dabei ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Alex begann, mit einem Vorderhuf zu scharren und verfing sich im Zaun. Da es ihm nicht gelang, sich selbst zu befreien, bückte ich mich todesmutig und zog unter Mühen seinen großen Huf aus dem Draht. In diesem Moment wurde mir klar, dass es für mich nur einen Beruf gab: Tierärztin!
Unbeeindruckt von dem Trubel, der um mich herum herrschte, lief ich zu meinen Eltern und tat ihnen sehr ernsthaft meine Absicht kund. Sie waren die Ersten und bei Weitem nicht die Einzigen, die mich deshalb belächelten, 10 Jahre später aber eines Besseren belehrt wurden, als ich tatsächlich das Studium der Tiermedizin aufnahm.
Welch weitreichende Folgen kann die Magie der Begegnung zwischen Mensch und Pferd haben!
Wie Myriaden anderer junger Mädchen verbrachte ich in den darauffolgenden Jahren einen Großteil meiner Freizeit in Pferdegesellschaft. Reitschulen und -ställe mied ich allerdings weitestgehend und widmete mich lieber der hingebungsvollen Pflege „meiner“ Pflegeponys und -pferde in Privathaltung, denn an ein eigenes Pferd war ohnehin nicht zu denken.
Mir missfiel von jeher, wie Pferde üblicherweise gehalten und wie mit ihnen umgegangen wurde. Ich spürte, dass in sehr vielen, wenn nicht gar den meisten Fällen etwas Entscheidendes fehlte: echtes Verständnis für das Pferd als Lebewesen und seine Bedürfnisse. Ein Pferd war oft lediglich ein Gebrauchsgegenstand und beliebig austauschbar. „Funktionierte“ es nicht richtig, wurde es gemaßregelt, wobei es häufig nicht gerade zimperlich zuging.
Die Ausbildungsmethoden erschienen mir mehr als fragwürdig, und Horst Sterns „Bemerkungen über Pferde“ taten ihr Übriges, sodass ich schließlich die Reiterei vollends an den Nagel hing.
Als Jahre später der erste „Pferdeflüsterer“ als strahlender Stern am Himmel der Reiterszene aufging, schöpfte ich neue Hoffnung, allerdings blieb ein gewisses Unbehagen. Nach der Lektüre des vorliegenden Buches von Gertrud Pysall ist mir auch klar, warum: Viele sogenannte „Pferdeflüsterer“ haben offenbar nicht gelernt, mit Pferden zu sprechen, also in einen ausschließlich in der Sprache der Pferde geführten gegenseitigen Austausch zu treten, auch wenn nach außen genau dieser Eindruck vermittelt werden soll.
Gertrud Pysalls Buch „Was Pferde wollen“ wird jeden Menschen, der sich dem Pferd verbunden fühlt, zutiefst berühren. Für all diejenigen, die offen, neugierig und vielleicht sogar willens sind, sich selbst und ihr Verhalten zu hinterfragen, öffnet sich hier eine Tür zu einer einzigartigen, spannenden und in dieser Form noch nie gezeigten Welt, in der ein harmonisches Miteinander von Mensch und Pferd möglich ist und dem Pferd das Verständnis, der Respekt und die Liebe entgegengebracht wird, die diesem wundervollen Geschöpf zusteht!
In diesem Sinne wünsche ich Gertrud Pysall, dass ihr Buch weite Verbreitung finden und zu einem Umdenken in der Pferde- und Reiterszene führen möge.
Dr. med. vet. Shiela Mukerjee-Guzik
Vorwort der Autorin
Schon als kleines Kind war ich fasziniert von Pferden. Mehr als jedes andere Tier zogen sie mich in ihren Bann. Keine Fury-Folge wurde ausgelassen, und in Gedanken hatte ich eine bestimmte Vorstellung von der Freundschaft und Beziehung eines Pferdes zu mir. Ein unauslöschliches Erlebnis war es dann, eines Tages bei Bekannten auf einem Pony zwei Runden in einem Hinterhof geführt zu werden. Eine Runde dauerte nicht viel länger als eine Minute, aber diese Minuten bleiben mir unvergesslich. Es war der Himmel auf Erden, der Inbegriff des Glücks – diese zwei Runden über Betonboden auf dem Ponyrücken. Ab jetzt war dies der Maßstab, dieses unbeschreibliche Gefühl. Jahre später hat sich etwas Ähnliches wiederholt, als ich in einem Dorf in der Eifel auf einem sehr breiten Kaltblut ohne Sattel durchs Dorf reiten durfte. Ich konnte gar nichts, saß glückselig auf dem Tier und es trottete brav seinen Weg mit mir bis in den heimatlichen Stall. (Dass das damals nicht ungefährlich war, war mir nicht bewusst und wäre mir sicher auch egal gewesen.) Diese beiden Erlebnisse prägten meine Vorstellungen über das Reiten und das Miteinander Mensch-Pferd. In den 50er-Jahren war Reiten ein absolutes Privileg der Wohlhabenden, und ich entschied, mit meinem ersten selbst verdienten Geld Reitstunden zu nehmen.
Das tat ich dann auch 1969 in einem Reitstall in Idar-Oberstein. Nach den üblichen Longenstunden, denen ich mit freudiger Erregung entgegenfieberte, kamen dann die allgemeinen Reitstunden in einer Abteilung auf Schulpferden. Und damit begann auch meine Ernüchterung. Ich erfuhr, wie unzufrieden die Pferde waren. Sie drohten zu beißen und zu schlagen, es standen Warnungen an den Boxen, welches Pferd man nicht anfassen solle, und ich erlebte diverse Abstürze – eigene und die meiner Mitreiterinnen, weil Pferde vom Reitlehrer mit Peitschen geschlagen wurden, um sie zu beschleunigen.
Der Reitunterricht war schlecht, die Stimmung auch, der anschließende Schnaps schien wichtiger als der Rest. Man wurde angeschnauzt und die Pferde auch. So konnte ich nichts lernen und allmählich hatte ich mehr Angst und Ärger als Freude am Reiten. Mit meinem Arbeitsplatz wechselte ich auch den Reitstall. Hoffnungsvoll fing ich wieder an und fand sehr ähnliche Bedingungen und Prinzipien vor. Nach und nach testete ich alle Ställe in meiner Umgebung, konnte aber das, was ich suchte, nirgends finden: einen respektvollen und würdevollen Umgang mit Mensch und Pferd, der die Gefühle möglich machte, an die ich mich noch so gut erinnern konnte.
Der einzige Lichtblick war ein privater Reit- und Ferienhof in Oberstaufen, der Stall Schlippe, wo ich auf Privatpferden reiten durfte, wo es keinen Massenbetrieb gab, und die Familie Schlippe liebevoll und freundlich mit mir und den Pferden umging. Dadurch fasste ich wieder neue Zuversicht und verbrachte alle meine Ferien und freien Tage dort und – lernte reiten.
Später wohnte ich einige Jahre in Berlin. Dort war Reiten für mich fast unmöglich und der Traum vom eigenen Pferd auf dem Land wurde immer stärker. Ich zog aufs Land, kaufte mir ein Pferd von einem Ferienhof und glaubte, den Traum jetzt verwirklicht zu haben. Weit gefehlt. Das Pferd war schwierig, ich wusste zu wenig (ich konnte ja nur recht gut reiten und sonst nichts).
Ich baute Hella, so hieß die Stute, eine große Box, mistete gründlich jeden Tag, führte sie auf die Wiese, beschaffte ihr Gesellschaft durch das Pferd meiner Freundin Gunda, putzte sie inbrünstig und schmuste viel mit ihr. Dennoch fasste sie zu mir nicht das Vertrauen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Zum Beispiel wollte sie nicht mit mir alleine ins Gelände gehen und das brachte mich zum Nachdenken. Wenn all das, was ich tat, nicht reichte oder eventuell nicht das Richtige war, was war es dann? Ich wollte wissen, was Pferde wollen, was Pferde brauchen, um glückliche, zufriedene Pferde zu sein. Ich suchte die Voraussetzung, das mit einem Pferd erleben und spüren zu können, was ich in meiner Vorstellung gespeichert hatte: tiefes Vertrauen, ungestörtes Einvernehmen, warme Nähe ohne Angst, Stress oder Schmerz für beide Seiten. Ich hatte es doch schon gefühlt, ich wusste, dass es das gibt und wollte es dringend wieder finden.
Jetzt versuchte ich, an möglichst viele Informationen heranzukommen. Ich las in Fachzeitschriften und sprach mit Reitern, Pferdezüchtern, Tierärzten und traf auf Manfred Pysall, der zu dem Zeitpunkt die „Hunsrücker Reiterseminare“ abhielt und heute mein Mann ist. Er war auch frustriert von dem üblichen Umgang mit Pferden, den er als Reitlehrer gelernt hatte, und suchte neue Wege. Wir teilten viele Ansichten und Wünsche und gründeten eine gemeinsame Reitschule in dem kleinen Ort Ellenberg bei Birkenfeld. Im Rahmen der „Hunsrücker Reiterseminare“ hielten wir Anfang der neunziger Jahre Wochenseminare ab. „Reiten ohne Angst und Stress“ sowie „Reiten lernen – aber anders“. Nach vier Jahren reichte uns die Ellenberger Reitanlage nicht mehr aus, und wir zogen in unsere heutige Reitschule um, hier in Spenge, mit Reithalle, Außenplatz und großzügigem Platz für 70 Pferde und Ponys mit großen Gemeinschaftsausläufen und reichlich Weiden. Hier sind wir nun seit 1994. Parallel zum Aufbau unserer Schule, dem Reitunterricht und den Seminaren, hat mich meine Erinnerung an das perfekte Gefühl mit dem Pferd weiter beschäftigt. Ich spürte, ich kann es finden, der Schlüssel musste in dem Bedürfnis der Pferde liegen, ich wollte herausfinden,
► WAS PFERDE WOLLEN!
Einleitung
Der Satz: Was Pferde wollen oder als Frage formuliert: Was wollen Pferde? wurde zu meinem Leitgedanken im Umgang mit ihnen. Schon in Ellenberg beobachtete ich unsere kleine Herde von zwölf Tieren lange und intensiv, um hinter ihr Geheimnis zu kommen, was wirklich ihr persönlicher Bedarf ist und wie sich dieser in der Herde darstellt, ob und wie er sich in den Jahreszeiten und wenn neue Herdenmitglieder dazukommen oder alte gehen, verändert.
Durch intensives Beobachten, zahlreiche Videoaufnahmen und Studien derselben in Zeitlupe, entdeckte ich feine Signale der Pferde, die sie untereinander austauschten und die so regelmäßig wiederholt wurden, dass sie für mich einen hohen Wiedererkennungswert erhielten. Ich fing an zu verstehen. Hier spielten sich Dinge ab, hier gab es Informationen, die ich noch in keinem meiner zahlreichen Pferdebücher gelesen hatte, und die anscheinend kaum oder gar nicht bekannt waren. Nach unserem Umzug nach Spenge-Lenzinghausen steigerten sich meine Möglichkeiten, auf diesem Gebiet weiter zu forschen, enorm. Mit der Zeit hatten wir sechs Pferdeherden in unterschiedlichen Zusammensetzungen, insgesamt 70 Tiere. Meine Bedingungen verbesserten sich dadurch extrem, ich konnte jederzeit Filmaufnahmen von natürlichen Situationen herstellen, aber auch bestimmte Konstellationen zu Studienzwecken einrichten. In ungezählten Stunden wurden diese Beobachtungen von mir ausgewertet und katalogisiert.
Um dieses Wissen den Pferden zu Gute kommen zu lassen und an andere Menschen weitergeben zu können, entwickelte ich eine Lehre, die von uns MOTIVA genannt und 1996 in München eingetragen wurde.
Mir wurde klar, dass es in Pferdeherden eine sehr komplexe Sprache und ein ausgeprägtes Sozialverhalten gibt, wozu eine sehr genau festgelegte Hierarchie gehört. Jedes Pferd kennt seinen Platz in der Rangordnung und findet darin auch Sicherheit und Halt.
Motiva
Was ist Motiva?
Eine Pferdegesellschaft basiert auf dem Zusammenspiel der einzelnen Tiere. Damit dieses Miteinander funktioniert, brauchen sie soziale Regeln, die dieses Zusammenleben steuern. Dabei handelt es sich grundsätzlich um einfache, überlieferte, erprobte und stabile Regeln, die sich mit dem Pferdekommunikationssystem vermitteln und einfordern lassen. Sowohl einseitige als auch wechselseitige Rechte und Pflichten werden von den erwachsenen Tieren an die jungen weitergegeben. Der Autorität der Leittiere kann man sich innerhalb der Pferdegesellschaft kaum entziehen, wodurch in der Herde eine natürliche Ordnung erhalten und somit der Fortbestand der Sozialregeln sowie der gesamten Herde gesichert wird und sich ein Bewusstsein der Zugehörigkeit entwickelt.
Motiva ist die Lehre genau dieser Zusammenhänge. Sie umfasst sowohl die Kenntnis der sozialen Regeln als solche, als auch die recht weit entwickelten Ausdrucksfähigkeiten der Pferde, diese Regeln darzustellen, einzufordern und zu überprüfen. Sie schult den Menschen aber nicht nur darin, über 130 Vokabeln der Pferde zu verstehen, sondern diese auch selbst sprechen zu können. Das Motiva Training des Menschen schließt außerdem eine Schulung in Konflikterkennung, friedlicher Konfliktlösung und kompetenter Kommunikation ein.
Aus der Formulierung „Verständigung mit Pferden“ kann man das Wort Verständnis herleiten. Wir brauchen ein tiefes Verständnis für ihre Art, ihre sozialen Regeln und Rituale, ihre Instinkthandlungen, ihre Ängste und Entscheidungen, ihre Lebensform. Die zusätzliche Kompetenz, ihre Sprache zu sprechen und zu verstehen, unter Einbeziehung dieses kompletten Wissens, gibt uns die Antwort auf meine Frage: Was Pferde wollen, und das ist eindeutig die Erkenntnis –
► SIE WOLLEN VERSTANDEN WERDEN.
PFERDE-VOKABELN
► Im Umgang mit Menschen kommunizieren Pferde immer. Sie können nicht „nicht“ kommunizieren.
Vorsichtige Kontaktaufnahme mit dem Menschen
„Ich bewache dich, wenn du ruhst“
Info
Motiva umfasst sowohl die Kenntnis der sozialen Regeln als solche, als auch die recht weit entwickelten Ausdrucksfähigkeiten der Pferde, diese Regeln darzustellen, einzufordern und zu überprüfen.
In die Nüstern blasen als Ausdruck gegenseitiger Freundschaft
Gesicht an Gesicht als Freundschaftsgeste
Pferd: Abschnauben als Zeichen von Wohlbehagen
Aufforderung zum gegenseitigen Kraulen durch Lippe
Gähnen als Beschwich-tigung, nicht aufdringlich sein zu wollen
Erneutes Gähnen zur Bestärkung der Aussage
Prüfung der Pheromone
Erneute Beschwichtigung durch Gähnen
Anschließendes Kopf-schütteln, dem Menschen (ranghöher) nicht zu nahe treten zu wollen
Info
Motiva schult den Menschen darin, über 130 Vokabeln der Pferde zu verstehen und diese auch selbst sprechen zu können.
I. THEORIE
1. DAS PFERD IN MENSCHENHAND
Auf unserem Hof in NRW trafen wir, Manfred Pysall und ich, erst einmal einen völlig normalen Reiterhof an, mit Publikum, wie wir es aus unserer Vergangenheit kannten. Es mischten sich Westernreiter mit den sogenannten Englischreitern, die untereinander konkurrierten. Nach einer kurzen Eingewöhnungs- und Beobachtungszeit stellten wir neue Regeln auf. Eine davon war, dass auf unserem Hof Pferde nicht geschlagen werden. Außerdem untersagten wir gewisse Trainingsmethoden, in denen Pferden über Schmerz Lektionen beigebracht wurden. In kurzer Zeit suchten sich etliche einen anderen Hof, wo sie ungestört weiter machen konnten wie gewohnt.
Im Laufe der Jahre konnte ich ein sehr interessantes Phänomen beobachten. Es passiert uns ständig: Neue Leute kommen auf den Hof und sind begeistert von der Atmosphäre, der Ruhe, den zufriedenen Pferden, sie beschreiben das Gefühl, in einer Oase zu sein. Es tut ihnen sehr gut, nicht mit Aggression und Angst im Umgang mit dem Pferd leben zu müssen und zu erfahren, das tut auch nicht not. Unsere Pferde, die ganz anders erzogen werden, lassen sich problemlos reiten, sind zufrieden und strahlen Ruhe und Verlässlichkeit aus. Das wird von fast jedem genossen.
Wenn aber diese Menschen erkennen, dass die Ablehnung der traditionellen Ausbildungsmethoden gleichzeitig den Anspruch an den Menschen mit sich bringt, seine Gedanken und Taten zu überprüfen, zu verbessern und umzulernen, dann entscheidet sich manch einer, lieber den Stall zu wechseln. Obwohl die Faszination so groß ist, überwindet sie nicht immer die innerliche Hürde, sich selbst, sein Denken und sein Verhalten kritisch überprüfen und teilweise verändern zu müssen. Es fällt viel leichter, sich vorzustellen, nur das Pferd müsse lernen und anders werden. Der Mensch nicht.
In der Pferdefachliteratur geht es fast immer darum, wie man was dem Pferd beibringen kann. Ziel ist: Das Pferd soll lernen, es soll sich verändern! Das ist man so gewohnt, das setzt der Mensch genauso voraus. Dabei ignoriert er, wie stark die Pferde im Umgang mit den Menschen auf diese reagieren. Häufig spiegeln Pferde deren Eigenschaften wider und verhalten sich je nach ihrem Gegenüber zugewandt, vorsichtig, aber auch abweisend, wenn sie z.B. bestimmte Verhaltensmuster spüren. Die folgenden Ausführungen sollen anhand einiger Beispiele einen ersten Einblick geben in diese Dimension der Verständigung und Kommunikation.
Freya
DAS GEHEIMNIS DER EHRLICHKEIT
Ein Pferd als Hobby oder Luxusgut kam erst nach den fünfziger Jahren für uns langsam in Mode. Je erschwinglicher Reiten oder Pferdehaltung wurde, desto mehr stiegen die Zahlen der Pferdebesitzer und Reiter an. Die unterschiedlichen Eigenschaften und Charakterstrukturen haben sich aber nicht geändert, obwohl der Anspruch an das Pferd sich geändert hat. Es ist in diesem Fall kein Nutztier, es ist Partnerersatz, Kinderersatz, Schmusefaktor, Bestätigung, Statussymbol, Ausgleich. Jede dieser Funktionen, die es zugeordnet bekommt, gelten dem Menschen. Es stellt etwas für den Menschen dar, es ersetzt etwas, was dem Menschen fehlt, was er sucht und glaubt zu brauchen. Findet er das nicht unter Seinesgleichen, greift er auf das Pferd als Ersatz zurück, und siehe da, es wirkt. Es passt, das Pferd kann uns seelisch einiges geben, und von daher ist es auch, wenn man so will, ungefragt der Therapeut in schweren Zeiten. Es ist da, groß und stark, es liebt uns, trägt uns, wartet auf uns und man kann sich auf es verlassen.
Bis hierhin ist das vielleicht einfach in Ordnung so, solange man das Pferd nicht missbraucht für schlechte Stimmungen oder als Prügelknabe.
Es ist logisch, wenn man heutzutage das Hobby Reiten wählt zur Entspannung in der Freizeit, dann geht es einem natürlich um Entspannung auf dem Pferd und nicht darum, dass man ein Pferd zufrieden oder glücklich macht.
In unserer Reitschule begegnet man Menschen, die genau das wollen, einen entspannten Abend auf dem Pferderücken oder am Samstagmorgen einen schönen Start ins Wochenende in einer angstfreien Reitstunde auf einem gut ausgebildeten Verlasspferd. Wir bedienen diesen Wunsch der Leute und versuchen dennoch, auch dem Pferd dabei gerecht zu werden. Für ein Schulpferd ist es immer ein gewisser Stress, oft wechselnde Reiter/Innen zu haben. Es kann ja keine feste Beziehung zu den einzelnen aufbauen, weil sie nur sporadisch kommen und auch von sich aus eine engere Beziehung zu einem Pferd gar nicht im Sinn haben.
Auch das kennen Pferde aus ihrem Leben miteinander nicht. In einer Herde sind die Mitglieder durchgängig die gleichen, wenn keines stirbt oder, weil es ein jugendlicher Hengst ist, verschwindet, bleibt die Herde zusammen. Man kennt sich untereinander und arrangiert sich, stellt die Hierarchie fest und lebt zusammen in emotionaler Sicherheit. Niemand erdreistet sich Befehle zu erteilen, der das nicht Kraft seines Amtes auch soll. Von daher ist das die instinktive Erwartung eines Pferdes an die Herde, selbst in der Gefangenschaft.
Schulpferde sind natürlich ausgebildet dafür, diesen Anspruch runterriegeln zu müssen, aber im tiefen Inneren sitzt der Wunsch nach Nähe gleichermaßen wie der Wunsch nach Aushandeln der Führung nach Pferderegeln. Solange ein Pferd ein Pferd ist, wird es diesen Bedarf haben und schauen, was sich für es klären lässt. Auch unsere Schulpferde versuchen gleich herauszufinden, mit wem sie es da zu tun haben. Sie berühren den Menschen zuerst oder reiben sich an ihm. Darf das Pferd das einfach tun, dann folgert es daraus, die Führung übernehmen zu sollen, was es willig tut. Es entscheidet schon mal, ob und wie es mitläuft mit diesem Menschen.
Aber nicht nur die äußerlichen Verhaltensweisen geben für das Pferd Hinweise darauf, wer hier das Sagen hat, sondern auch die innere Einstellung des Reitkunden wird gespürt und ist teilweise Grundlage des Pferdeverhaltens.
Obwohl wir sehr brave Schulpferde haben, die auch mit ängstlichen und unsicheren Reitschüler/Innen klar kommen und artig jeden durch die Reithalle tragen, haben diese Tiere Ihren Anspruch oder Wunsch nach ehrlichem Umgang nicht an den Nagel gehängt. Ist man aufmerksam, so sieht man das täglich bei den Anpaarungen, wie die Pferde behutsam, aber auch konsequent ihrer Natur nach handeln und für sich die richtigen Entscheidungen umzusetzen suchen. Ich möchte das an einem Beispiel aus diesem Herbst erläutern:
Wir haben eine Stute, selbstbewusst, 162 cm und ca. 10 Jahre alt. Sie kennt die Pferderegeln sehr genau, lebt in einer Stutenherde von 13 Mitgliedern und ist als Nachzügler vor einigen Jahren zu uns zurückgekommen. In der Zwischenzeit hatte eine Frau sie gekauft und durch die privaten Lebensumstände nicht mehr behalten können. Sie kennt das Leben als Privatpferd. In ihr Leben als Schulpferd hat sie sich gut hereingefunden, den Anspruch an ehrlichen Umgang behalten und erwartet Respekt ihr gegenüber. In meinem Buch „Was Pferde Wollen“ sieht man sie in der Fotoreihe von meinem Stopp mit Hinterhandwendung. Sie ist sehr fein und sensibel und dem Menschen zugetan als Schmusepferd, ein souveränes Tier, sehr offen für psychische Vorgänge im Menschen.
Es trug sich Folgendes zu:
An einem Samstagmorgen kam eine erwachsene Reitschülerin zur Stunde und wollte dieses Pferd aus dem Auslauf holen. Da sie bei uns relativ neu war und FREYA in der Stutenherde stand, sagte eine freundliche Pferdebesitzerin:
„Du willst sicher dein Pferd, ich hole sie dir hier durch die Tür“.
Die Frau meinte: „Ja, Madame steht eh hier in der Ecke des Auslaufs.“
Ich war gerade in der Stallgasse und es ergab sich sinngemäß folgender Wortwechsel:
„Sie sagen MADAME zu Freya“?
„Ja, klar.“
„Was meinen Sie damit, warum betiteln Sie sie so?“
„Weil sie eine ist.“
„Woran machen Sie das fest und wann ist man eine Madame in Ihren Augen?“
„Weil sie so ist, wie sie ist, wie sie guckt und sie hat ihren eigenen Kopf.“
„Wer hat das nicht, wer ist schon mit einem Fremdkopf ausgestattet, oder was wollen Sie wirklich damit sagen?“
„Nichts, nur dass sie einen eigenen Kopf hat und ich finde das ja auch gut. Sie soll ja machen, was sie will.“
„Wenn Sie aber gleich in der Reitstunde sind und sie links rum geht wenn Sie rechts rum wollen, dann werden Sie so nicht denken. Dann wollen Sie, dass sie macht, was Sie sagen, oder?“
„Nein, ich finde immer gut, wenn jemand weiß, was er will, ich finde eigenen Kopf gut, bei Kindern auch.“
Sie hatte inzwischen Freya an der Hand und ging mit ihr zum Sattelplatz, um sie zu putzen und zu satteln und für die Reitstunde fertig zu machen. Nach etwa 10 Minuten kam ich an den beiden vorbei. Die Frau schaute mich komisch an, schien unsicher und ich fragte freundlich:
„Wie ist es Ihnen inzwischen, haben Sie noch mal drüber nachgedacht?“
„Ich habe mich darüber geärgert.“
„Ich wollte nur sagen, Madame als Betitelung kenne ich gut von anderen Leuten. Es hat immer etwas von distanziertem Beurteilen, Mütter die zu ihrem Kind Madame
sagen, verbinden das mit einem Maßregeln. Oft reicht schon nur das Wort mit der entsprechenden Betonung und das Kind weiß, das war jetzt nichts. Worte sind nicht Schall und Rauch, sie kommen ja aus unserer Einstellung zur Situation, und deswegen wollte ich nur aufmerksam machen, darüber mal nachzudenken, mehr ist es nicht.“
„Für mich ist Madame nur positiv, ich meine das nicht so, wie Sie sagen.“
„Ich kann nur sagen, wie ich es empfunden habe, aber wenn Sie es ganz anders gemeint haben, dann wird Freya das wissen. Pferde spüren das, sie lesen in der inneren Einstellung unabhängig von einzelnen Menschenworten. Ich kenne Freya eben gut, und wollte Ihnen nur einen Tipp geben, wie Sie Ihr Pferd für sich gewinnen und wie man die Beziehung erschwert. Aber wenn Sie das so positiv meinen, wie Sie sagen, wird Freya das spüren. In dem Fall ist es egal, wie ich denke, Sie reiten sie ja jetzt.“
Ich ging weiter, hatte noch zu tun und die Reitstunde ging ja auch bald los. Nach wenigen Minuten kam eine andere Frau, die zusammen mit dieser Kundin Freya gebürstet hat und sagte:
„Frau Pysall, was sollen wir machen, Freya kommt nicht mit in die Halle, wir können sie nicht bewegen, sie bleibt einfach hier stehen“.
Die beiden hatten also fertig geputzt und gesattelt und wollten in die Reithalle mit dem Pferd. Das allerdings hatte doch irgendwas verstanden, und meine Befürchtung traf ein. Freya spürte die Haltung der Frau und ging keinen Zentimeter mit ihr. Sie hatte versucht, das Pferd zu ziehen, im Kreis zu führen und dann los. Nichts half, Freya stand wie angedübelt.
Ich erklärte: „Das hatte ich gemeint.“
Freya wurde von jemand anderem zur Halle geführt, mit dem sie ganz einfach mitging.
Nach der Reitstunde traf ich wieder auf diese Frau und fragte, wie ihr jetzt ist, ob sie verstanden habe, was ich meinte, und ob sie wiederkommt.
Sie sagte: Ja klar, sie lernt ja dazu, das wirft sie nicht um. Bis nächsten Samstag.
Ihre Aussage, dass sie dieses „Madame“ sehr wohlwollend und positiv meint, hatte sich durch das Pferd entlarvt. Jetzt blieb nur, hinzuschauen und in sich zu gehen. Es war ja nichts passiert. Allerdings die Möglichkeit der Reflexion geboten, doch mal zu fühlen, was meinte ich wirklich mit dem „Madame“? Mehr war es nicht und eigentlich war es spannend, auch für diese Frau, an einem Alltagsbeispiel gezeigt zu bekommen, wie solch eine Gedanken-
welt funktioniert. Dienstags rief sie an und kündigte, sie kam nie wieder. Sie hatte sich nicht dafür entscheiden können, hinter die Kulissen zu schauen und zu realisieren, was Pferde spüren können und wie hilfreich das ist, solche Spiegel zu haben.
Ich weiß, solche Begriffe zu nutzen, ist nicht böse gemeint. Sie sind unbedacht, dennoch zeigen sie Einstellungen, die im Zusammenhang mit dem Pferd manchmal eine Falle sind, in die man unwissentlich läuft, weil Pferde feine „Spürnasen“ dafür haben und ihre Beziehung zu uns davon beeinflusst wird. Insofern war es ein wohlgemeinter Tipp, der diese Frau nicht nur im Reiten auf Freya weiter gebracht hätte.
Pferde spüren unsere Einstellung zu ihnen. Sie gehen für viele Menschen unbemerkt damit um. Gerade wenn man Reitanfänger ist und noch viel lernen muss, tut ein bisschen Demut und Bescheidenheit nicht schlecht.
Geht das Pferd nicht durch die Ecke und man sagt: „Das tut es nicht!“, lernt man weniger, als wenn man sagt: „Ich kann es nicht.“
Sucht man den Fehler in der Reithilfe, also bei sich, dann kann man ihn korrigieren.
Reiten ist Gebärdensprache, und es dauert eben seine Zeit, bis man behaupten kann, dabei keine Fehler zu machen und somit kommunikative Missverständnisse anzustellen.
Das Zugeben der Fehler macht oft schon seelischen Stress bei Menschen und verhindert zügiges Lernen.
Freya
Motiva
Ehrlichkeit
Für unsere Beziehung zum Pferd ist es hilfreich, gerecht zu sein, und die nicht gelungene Übung dem zuzuordnen, der sie auch verschuldet hat. Das Pferd erwartet in uns keine fehlerfreie Person, aber es wünscht sich eine gerechte und faire Person auf seinem Rücken, die nicht dafür straft, dass sie selbst etwas nicht kann.
Ich habe das in den vielen Jahren als Reitlehrerin oft erlebt, wie fein Pferde mitmachen, und wie bemüht sie sind, so zu laufen, wie der Mensch sich das wünscht, wenn man nur gerechterweise die Fehler in der Hilfengebung sucht anstatt pauschal beim Tier. Diese Grundehrlichkeit, zu denken, ich kann es noch nicht, ist die größte Garantie, es lernen zu können.
Diese Ehrlichkeit braucht man nicht nur beim Pferd, klar, es nutzt auch im Umgang mit Menschen. Auch da ist es schwer, weil wir traditionell anders reden als wir denken und Vokabeln benutzen, die Sachverhalte verwischen.
Vor einer Reitstunde spielte ein sechsjähriger Junge am Teich. Der Vater rief, er wolle, dass der Sohn das Pony mitbürstet. Der Junge gehorchte nicht, spielte weiter. Der Vater ging hin, nahm ihn am Arm und sagte: „Komm mal her mein Freund, so nicht!“ Das Kind verstand genau, es hatte den Bogen überspannt, kam natürlich mit, weil der Vater stärker ist, und es maulte vor sich hin. Erzieherisch war das konsequent und sicher richtig für das Kind. Warum aber wird es in dem Zusammenhang Freund genannt?
Der Junge kannte das wohl, das hörte er nicht zum ersten Mal. So erfährt er in Kindertagen schon, das Wort steht für beides, Freund und … ja – und was? Man weiß es nicht genau. Für jemand der Fehler macht?
Sicher macht sich niemand groß Gedanken darüber, der Junge weiß später irgend
wann, was Freund und nicht Freund ist. Das lernt er schon. Ich will damit nur aufzeigen, wir sind so. Wir sagen Sachen, die wir nicht meinen. Warum?
Eine Mutter unterhält sich mit einer anderen vor der Reitstunde im Beisein der Kinder. Eine klagt: „Der Justin hat heute wieder… .Ich könnte ihn an die Wand klatschen.“
In dem Fall ist es ja gut, dass sie nicht meint, was sie sagt. Das allerdings tun Menschen sehr sehr oft und Pferde nie. Weil sich das bei uns Menschen so etabliert hat, nehmen wir uns auch die Freiheit, solche Dinge und Schlimmeres zu sagen. Der Zuhörer muss sich das dann selbst in Richtig und Falsch sortieren. Das tun und können Pferde nicht. Sie verstehen diese Menschenworte nicht, aber sie entlarven die Haltung, die dahinter steht.
Nun kann man sagen, Pferde müssen damit klarkommen, sind ja nur Tiere und ich will wenigstens beim Ausüben meines Hobbys meine Ruhe haben und nicht noch Stress, indem ich kontrollieren muss, was ich sage. Man kann aber auch hinsehen und erkennen, wie man redet und versuchen, den inneren Weg zu erforschen, warum einem danach ist, sich genauso auszudrücken. Was steckt dahinter, gibt es sensiblere und freudvollere Wege, sich beim Hobby zu entspannen? Diese Entscheidung bleibt jedem selbst überlassen, für die Pferde allerdings wäre es toll, wenn immer mehr Pferdeleute bewusster mit alledem und der Beziehung
zum Pferd umgehen. Gerade weil die Pferde so sind, wie sie sind, mögen wir sie ja so sehr. Sie sollen uns ja entspannen, für uns da sein und nicht selten sogar als Therapeuten fungieren. Also möchten wir auch, dass sie fein und sensibel sind, Verständnis für uns haben, wenn wir sie benutzen und brauchen, um gesund zu werden oder mit unserem Stress klarzukommen.
Weil sie so genau spüren, was in uns los ist, können sie, nimmt man sie ernst mit ihren Aussagen, auch als „Diagnostiker“ eingesetzt werden. Dazu kann ich ungezählte Beispiele bringen, die ich selbst erfahren und mit Leuten erlebt habe.
Gertrud Pysall und Mette
Mette
Vor über 20 Jahren hatten wir in einem Seminar „Bewusstes Leben – lebendiges Reiten“ einen jungen Mann in der Gruppe, der sehr still war. Er ritt in der Reitstunde, aber beim Mittagessen nahm er kaum etwas zu sich. Nach zwei Tagen fragte ich ihn, ob es nicht schmeckt, oder ob er krank sei. Er meinte, es schmeckt schon, aber er könne nicht gut schlucken und erzählte mir, er hat seit der Pubertät einen „Kloß im Hals“, eine Enge, die sehr unangenehm ist, und die es ihm schwer macht, normale feste Nahrung zu essen. Sein Vater, der selbst Arzt war, hatte ihn in jeder Hinsicht durchchecken lassen, er hatte alle möglichen Fachärzte und Kliniken in sechs Jahren durchlaufen und niemand konnte helfen. Man fand keine Ursache. Alle symptomatischen Therapien hatten nichts genutzt. Meine Frage, ob damals irgendetwas passiert sei, was er mit dem Kloß in Zusammenhang bringen könnte, konnte er nicht beantworten. Da er ja den Kurs gebucht hatte, aber im Grunde nicht so viel davon mitnehmen konnte, bot ich ihm an, hinter die Kulissen zu schauen, wenn er mag. Das wollte er. Ich hatte Erfahrung mit meiner Knabstrupperstute Mette als Diagnosepferd und seelischen Problemen bei Menschen. Ich erlaubte dem jungen Mann, sich ohne Sattel auf das Pferd zu setzen und dann, so bequem es ging, sich auf Mette zu legen, indem er sich Richtung Hals runterbeugte. Er fand eine gute Position. Er schloss die Augen und ich führte Mette mit ihm darauf liegend erst einmal schweigend. Mit der Zeit fing ich an zu reden, fragte ihn Ereignisse aus der fraglichen Zeit und er erzählte. Zwischendurch gab es immer wieder einige Zeit der Ruhe, des Spürens und der Besinnung auf frühere Gefühle. Irgendwann fing der Mann an bitterlich zu weinen.
Es war ihm klar geworden, er studierte gerade auf Wunsch des Vaters Medizin, um später einmal die Praxis übernehmen zu können. Seinen Herzenswusch, Sport zu studieren, musste er ignorieren, das hatte der Vater von ihm gefordert. Er weinte laut und herzerweichend und auch sehr lange. Mette trug ihn ruhig immer weiter. Sie machte immer wieder rhythmische Geräusche, die wie ein stockendes Ausatmen klangen. Das tat sie immer, wenn sie spürte, der Mensch auf ihrem Rücken hat Probleme, dem fehlt sprichwörtlich die Luft zum Atmen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit war ihr Hals ganz nass von Tränen, das Schluchzen wurde leiser und der junge Student kam zur Ruhe. Ich ging schweigend mit Mette weiter. Nach einer besinnlichen Zeit setzte der Mann sich auf, trocknete sich das Gesicht mit dem Ärmel ab, wartete eine Weile und dann … kam es aus ihm raus: „Der Kloß ist weg, ich habe Luft, ich kann schlucken!“
Er konnte es nicht fassen, nach Jahren der Enge im Hals, fühlte der sich zum ersten Mal wieder normal an, mit Platz darin. Wir sprachen noch eine Weile darüber, während er selbst die Mette führen wollte, sie umarmte, sich immer wieder bei ihr bedankend. Er hatte auch in der psychosomatischen Klinik zu keinem Ergebnis gefunden, aber jetzt war es ihm klar geworden. Er wusste, was er tun musste und wollte. Er wollte mit dem Vater reden, er wird Sport studieren, er wird ihn überzeugen, dass er das für sein Leben ändern muss. Bisher war es ihm nicht klar, was dieser für ihn falsch eingeschlagene Lebensweg bedeutete und dass er reden muss, um den Kloß aus dem Hals nicht als Warn-Mal zu brauchen. Mit dieser Blockade hatte sein Körper ihm gezeigt, was seelisch für ihn nicht gut war, aber erst durch den Kontakt mit Mette und in der Situation des Getragenwerdens von dem Pferd, bekam er den Zugang zu sich selbst, konnte weinen und das zulassen, was als Erkenntnis wichtig für ihn war.
An dem Tag schmeckte ihm das Mittagessen, er war zufrieden und tief beeindruckt von Mette, die nur durch ihre Art Pferd zu sein, ihm half, an den Ausdruck seiner wahren Gefühle zu kommen. Er hatte das Bedürfnis, den ganzen Nachmittag mit ihr zu verbringen, brachte ihr sorgsam gesuchte Löwenzahnblätter aus frischem Frühlingsgrün und redete mit ihr.
Er brach am nächsten Tag das Seminar ab, fuhr nach Hause, sprach mit dem Vater und fing an, Sport zu studieren. Irgendwann rief er noch mal an um zu berichten, es geht ihm gut. Der Kloß tauchte nicht mehr auf, er war geheilt.
Motiva
Pferde spiegeln, was sie spüren
Solche oder ähnliche Situationen, in denen Pferde psychische Blockaden bei Menschen spüren, erlebe ich sehr häufig. Auch im Motiva Training ist das so. Dort können Menschen auch nicht anders sein, als sie innerlich sind. Sind sie aggressiv, dann merkt man das, sind sie ängstlich, unsicher, arrogant, respektlos, dem Pferd bleibt das nicht verborgen. Es kann das lesen, tut es auch, und zeigt was es denkt. Das drückt es mit seinen Vokabeln aus. Wenn man ihre Sprache spricht, ist es nicht schwer, alles sinngemäß für den Menschen zu übersetzen. Dieser bekommt, wenn er will, eine sehr feine Diagnose seiner momentanen inneren Situation.
Eine Teilnehmerin wollte beim Motiva-Training ein Pferd von sich wegschicken und es gelang ihr nicht, obwohl dieses ein Schulpferd war und sehr einfach im Umgang. Die beiden aber konnten sich nicht einigen. Es kam zu meiner Frage, ob sie, die Frau, sich auch im wahren Leben nicht zur Wehr setzen könne oder sich den Raum von jemand so stark einschränken ließe.
Erfahrungsgemäß spiegeln die Pferde das, was sie spüren. Ich hatte recht mit meiner Vermutung. Diese Teilnehmerin erkannte dadurch ihre häusliche Situation und ihr Verhalten. Sie hatte sich seit langem in der Beziehung unwohl gefühlt, sich aber nicht gewehrt und sich hilflos ausgeliefert. Durch das Seminar wusste sie mehr von sich, die Erkenntnis half ihr, sich zu trennen. Bald darauf fand sie den Mann ihres Lebens und ist inzwischen mit ihm glücklich verheiratet. Ohne diese Erkenntnis wäre diese Geschichte anders verlaufen.
Mit meinen wahren Geschichten aus meinem Pferde - Menschenleben könnte ich viele Seiten füllen. Hier geht es mir in erster Linie um das Prinzip. Es geht um die Erkenntnis, Pferde sind sehr ehrlich und unmittelbar. Sie merken, wenn jemand anders ist als er tut.
Es ist aber leider schon fast typisch menschlich, genau das zu machen. Wir sind so erzogen, sind höflich, diplomatisch, treten niemandem zu nahe, zeigen unsere wahren Gefühle nicht. So glauben wir, wäre es richtig. Unsere Kultur und Erziehung hat uns so gemacht. Das zeigt sich in winzigen Alltagsbeispielen den ganzen Tag, ohne dass man sich dessen bewusst ist.
Wenn man müde ist, darf man in Gesellschaft nicht einfach gähnen, weil es unhöflich ist. Dennoch ist man aber müde. Jetzt muss man schauen, das zu tarnen, um niemanden zu verletzen.
Man darf sich fragen, warum ein andererbeleidigt reagieren würde, weil ich müde bin. Eigentlich völliger Quatsch, weil er nicht schuld ist. Es betrifft ihn gar nicht, er bezieht es aber, falls er auch noch der Gastgeber ist, auf sich. Er unterstellt uns jetzt, wir langweilen uns bei ihm, er hat aber den Anspruch, ein guter Unterhalter zu sein.
Wenn wir genauso wären, wie Pferde sind, würde man einfach gähnen dürfen und eventuell sagen, ich bin sehr müde, habe schlecht geschlafen. Der Gastgeber hätte kein Problem damit, weil er auch gar nicht auf die Idee käme, dass meine Müdigkeit sich auf ihn beziehen könnte. Außerdem würde er auch glauben, was ich sage, weil Pferde niemals Dinge anders nennen, als sie sind. Da stimmt alles was gesagt wird, Lügen geht nicht.
Ganz anders bei dem Menschen. Der Gastgeber hat an sich den Anspruch, entertainen zu müssen und die Müdigkeit des anderen, sich selbst anzulasten. Dadurch darf der Müde nicht zeigen, dass er gähnen muss um den anderen nicht zu belasten oder zu kränken, weil der ihm nicht glauben könnte, dass es wirklich nichts mit der Qualität der Party zu tun hat.
An diesem kleinen Beispiel sieht man schon, unser Lebensalltag ist vollgespickt mit solchen und ähnlichen Situationen, in denen wir rücksichtsvoll, höflich, zurückhaltend und dadurch unehrlich sind. In der Gesellschaft mit Menschen kann man das so machen, wir sind alle gewöhnt daran und können damit umgehen. Wir kämen gar nicht zurecht, wenn das von jetzt auf gleich anders wäre und jeder würde wie ein Pferd gnadenlos sagen, wie ihm zumute ist, was er denkt, was er will. Das würde unser soziales Leben sprengen.
Motiva
Verständnis
Die Pferdegesellschaft könnte umgekehrt nicht mit unserem Verhalten leben. Wenn wir nun aber mit diesen Wesen Beziehungen eingehen und uns verbinden wollen, dann ist es schwer für beide, diese Hürde zu überwinden. Pferde verstehen diese diplomatischen Schachzüge nicht, sie spüren, wenn wir sauer sind oder Angst haben, ihnen machen wir nichts vor.
Noch schlimmer ist es, wenn die versteckten Gefühle nicht aus den genannten höflichen oder unsicheren Verhaltensweisen kommen, sondern aus Wut und Aggression. Wenn das Pferd zum Prügelknaben wird, weil man sich an ihm abreagiert, hat es keine Chance gegen den Menschen.
Strafen ist eine bei uns legitime Form des Aggressionsausdrucks. Darunter haben viele Pferde zu leiden. Sie werden gestraft für Dinge, die sie nicht können, Verhalten, das sie nicht verstehen, für ihr „so sein, wie sie sind“, für ihre Sprache.
Sie treten uns auf die Füße, sie treten uns zu nahe, weil das ihre Lebensweise ist.
Spricht man mit Katzenfreunden und Katzenbesitzern, dann bezeichnen sie sich lächelnd als den Dosenöffner. Sie erzählen begeistert, wie selbstbewusst ihre Katze ist, wie sie sich bemerkbar macht, was sie nicht toleriert und von wem sie sich nicht anfassen lässt. Die Katze hat sich ein Image erwirtschaftet, womit sie recht gut zufrieden ist. Sie wird umsorgt und geliebt, sie darf ungezogen sein und fordernd, sie erntet ein Lächeln des stolzen Besitzers, wenn sie sich typisch für Katzen verhält und so lange nervt, bis sie bekommt, was sie möchte. Hunde haben Herren, Katzen Personal, so heißt es schmunzelnd.
Es gibt viele Cartoons, die nur lustig zeigen, wie Katzen sind und wie die Besitzer erzogen werden.
Bei Pferden ist das sehr viel anders. Sie ernten nicht das Verständnis für ihre Art. Sie sind ja nicht weniger speziell als Katzen, sie sind auch Tiere, sie haben auch ihre Art, die sie deutlich von uns Menschen unterscheidet. Das aber wird ungeduldig gesehen, hart bestraft und aberzogen. Bei Katzen heißt es: „die kann man nicht erziehen „ und damit ist man zufrieden.
Pferde kann man erziehen, sie geben alles, um sich für die Beziehung Mensch – Pferd einzusetzen. Sie geben sich Mühe, lernen, was möglich ist an Menschensprache, tolerieren, wenn wir sie nicht verstehen, sie tragen uns durch die Welt, auch dann, wenn man für solch ein Tier zu schwer ist, sie tun es. Sie versuchen uns zu gefallen, weil sie so stark an einer Freundschaft mit dem Menschen interessiert sind.
Wir haben ihnen schon bei ihrer Geburt durch unsere Anwesenheit in ihrer Prägezeit ein unbewusstes Versprechen gegeben. Wir haben dadurch behauptet, dass wir Menschen zum Leben des Pferdes gehören, und dass wir als Sozialpartner ernstzunehmen sind. Dieses Versprechen gilt es einzulösen.
Vielleicht fangen wir gedanklich noch mal ganz vorne an. Wie war das mit der Madame? Was wäre gewesen, wenn diese Frau verstanden hätte, warum ihr es ein Bedarf war, das Pferd so zu betiteln? Sie hätte herausfinden können, welche Gefühle sie dazu bewegten. Was sie an Vorurteilen mitgebracht hatte, denn sie kannte diese Stute ja kaum.
Sie hätte auch herausfinden können, wo die Ursache dieser Gedanken zu finden ist, und dann wäre es ihr gelungen, die Freya mit den Augen zu sehen, die sie im wahren Licht erscheinen lassen:
als ein super braves Schulpferd, willig, alles zu machen, was sie soll, vorausgesetzt, die Hilfengebung stimmt und sie versteht, was gemeint ist.
Meine Ansagen in Reitstunden sind häufig nicht anders. Für ein Pferd aus seiner Sicht ist es immer Quatsch in einem Zimmer (Reithalle) zu laufen, sich zu biegen, sich anzustrengen, ohne dass man für Futter sorgt oder sonst etwas Lebenserhaltendes erwirbt. Aus Sicht des Tieres vergeudete Energie. Wenn es schon wegen und für den Menschen in solch einem Raum läuft, dann ist es für das Tier gleichgültig, ob es rechts oder links herum marschiert, schnell oder langsam, in die Ecke oder durch die Mitte, weil alles gleichermaßen sinnlos ist. Es tut es für den Menschen auf die Hilfen hin, die es wie eine Sprache übersetzt. Es hat gar keinen Impuls, extra etwas anders zu machen, warum und wofür? Das bringt ihm ja nichts, und Pferde tun nichts in der Natur, um sich gegenseitig zu ärgern. Sie können das gar nicht, es wäre nicht arterhaltend und gegen den Instinkt. Also ärgern sie auch den Menschen nicht. Sie sind nicht zickig, wie wir es sein können.
Pferde verweigern sich
• wenn es weh tut
• wenn sie nicht verstehen was sie sollen
• wenn sie Angst vor den Folgen haben und glauben, die Verantwortung zu tragen
• wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht und daraus gelernt haben
• wenn sie meinen, etwas anderes sei wichtiger und richtiger
• wenn sie krank sind
• wenn ihr Respekt vor anderen das verbietet
… um nur einen Teil der Gründe zu nennen, die sich Menschen bei Ungehorsam durch den Sinn ziehen lassen könnten. Wenn wir nur einen kleinen Teil der Toleranz zeigen könnten, den wir Menschen Katzen gegenüber empfinden, wäre dem Pferd schon geholfen.
Wenn wir es doch können, Verständnisfür Tiere zu haben, Geduld mit ihrem Anderssein, mit ihrem nur ein Tier sein, was spricht dagegen, diese unsere Fähigkeit für Geduld und Verständnis einem anderen Wesen gegenüber auch beim Pferd anzuwenden.
Wenn außerdem das Verständnis dafür wächst, wie unterschiedlich wir sind, die Menschen und die Pferde, wenn wir bereit sind, hinzuschauen und zu erkennen, wo wir im Umgang mit dem Pferd Opfer unserer Biographie werden, können wir immer dann der Gerechtigkeit Raum schaffen und dem Pferd so begegnen, wie es sich das verdient hat und sich dringend wünscht:
Als ehrliche Freunde mit dem besten Vorsatz, das Tier verstehen zu wollen und bemüht, seine Welt zu begreifen, sich darin immer sicherer zu bewegen, um des Pferdes und unserer gegenseitigen Freundschaft willen.
Info
Pferde kann man erziehen, sie geben alles, um sich für die Beziehung Mensch – Pferd einzusetzen. Sie geben sich Mühe, lernen, was möglich ist, an Menschensprache, tolerieren, wenn wir sie nicht verstehen, sie tragen uns durch die Welt, auch dann, wenn man für solch ein Tier zu schwer ist.
Motiva
Die Art der Beziehung
In unterschiedlichen Zusammenhängen hat mich die Frage interessiert, warum man dieses oder jenes macht. Natürlich betraf das auch das Thema Mensch und Pferd. Viele der Reiter, die ich im Laufe der Zeit kennen gelernt hatte, waren freundliche, lustige Personen, doch sobald ihr Pferd nicht „funktionierte“, veränderten sie sich sehr. Dieses Handeln, diese Gefühle sind Symptome für eine Ursache, die man ganz woanders suchen musste. Dafür sprach auch, dass die meisten Reiter oder Pferdebesitzer selbst keine schlüssige Erklärung für ihr eigenes Tun finden konnten. Eigentlich liebten sie ihre Tiere ja sehr. Ihre Taten zeigten im Stress das Gegenteil – und Hilflosigkeit. Ich stellte mir die Frage, was denn das Pferd jedem Einzelnen dieser Menschen bedeutet? Welche Beziehungen zeigen sich in den unterschiedlichen Konstellationen? Welche Position wird dem Pferd von seinem Menschen zugeordnet?