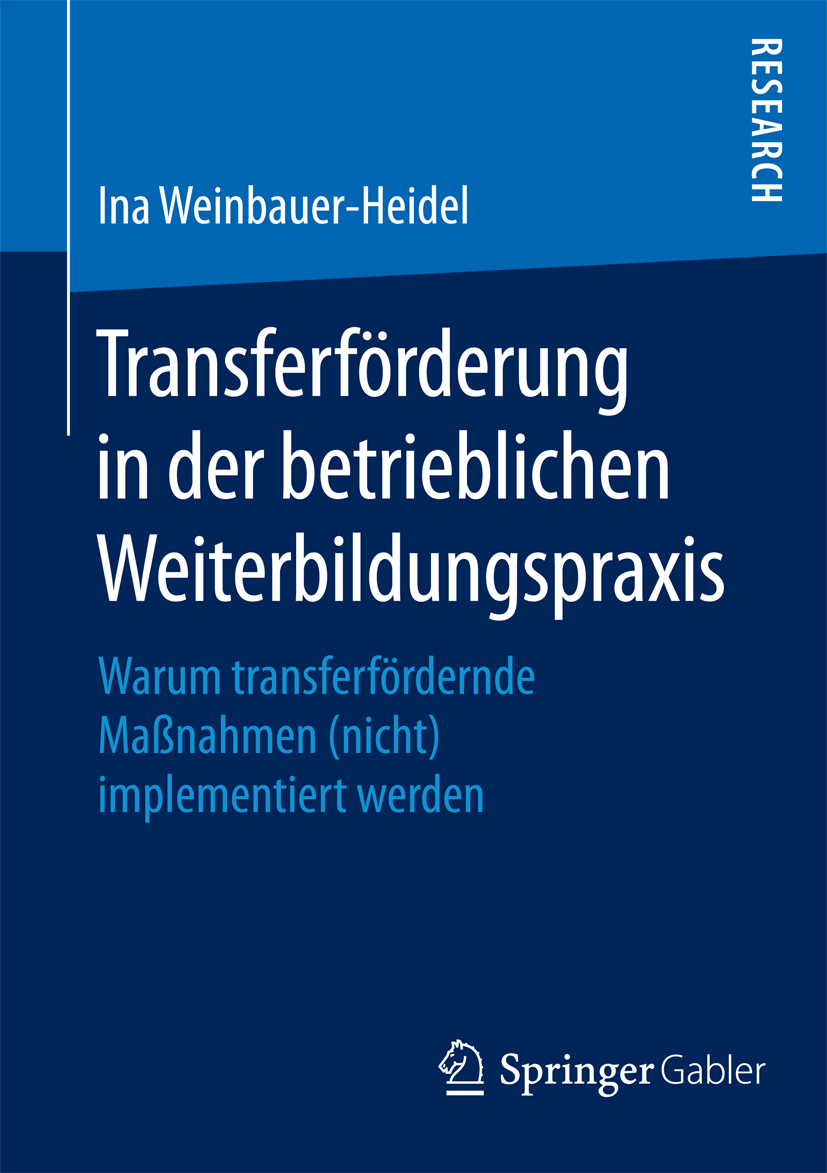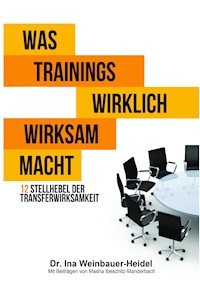
36,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die meisten Seminare bringen nichts - das ist in HR-Kreisen ein offenes Geheimnis. Nur knapp 20 Prozent des Gelernten werden im beruflichen Alltag auch umgesetzt. Kein Wunder, dass Weiterbildungsprogramme gerne dem Rotstift zum Opfer fallen. In diesem Buch bringt die Autorin 100 Jahre Transferforschung auf den Punkt und zeigt: Der Transfererfolg ist steuerbar. Die Stellhebel der Transferwirksamkeit® sind die Quintessenz der Forschung für die HR-Praxis. Wer sie kennt, weiß, wovon der Transfererfolg abhängt und wie er ihn steuern kann. Dieses Buch präsentiert ein Gesamtkonzept mit wissenschaftlicher Fundierung und über 50 anschlussfähigen Tools und Interventionen, mit denen PersonalentwicklerInnen, Trainingsdienstleister und Trainer die Wirksamkeit jedes Trainings maximieren können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
WAS TRAININGS WIRKLICH WIRKSAM MACHT
Dr. Ina Weinbauer-Heidel mit Beiträgen von Masha Ibeschitz-Manderbach
WAS TRAININGS WIRKLICH WIRKSAM MACHT
12 Stellhebel der Transferwirksamkeit
Institut für Transferwirksamkeit | www.transferwirksamkeit.com
© 2018 Dr. Ina Weinbauer-Heidel
Institut für Transferwirksamkeit – www.transferwirksamkeit.com
Umschlaggestaltung: Antoneta Wotringer
Umschlagbild: 123rf.com - ekinyalgin
Illustration: Katharina Trnka
Buchssatz & -gestaltung: werdewelt GmbH
Lektorat: Friederike Schmitz - Prolitera
Erschienen bei tredition GmbH, Hamburg
978-3-7345-8329-2 (Paperback)
978-3-7345-8330-8 (Hardcover)
978-3-7469-7181-0 (E-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Die Essenz der Transferforschung – ein Intro
Die Stellhebel bei den Teilnehmenden
Stellhebel 1 – Transfermotivation
Stellhebel 2 – Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Stellhebel 3 – Transfervolition
Die Stellhebel im Trainingsdesign
Stellhebel 4 – Erwartungsklarheit
Stellhebel 5 – Inhaltsrelevanz
Stellhebel 6 – Aktives Üben
Stellhebel 7 – Transferplanung
Die Stellhebel in der Organisation
Stellhebel 8 – Anwendungsmöglichkeit
Stellhebel 9 – Persönliche Transferkapazität
Stellhebel 10 – Unterstützung durch Vorgesetzte
Stellhebel 11 – Unterstützung durch Peers
Stellhebel 12 – Transfererwartung im Unternehmen
Make Transfer happen
GELEITWORT VON AXEL KOCH (R. GRIS)
Autor von „Die Weiterbildungslüge“
Als ich im Jahr 2006 die Entscheidung traf, das Weiterbildungsgeschäft provokativ ins Visier zu nehmen, ahnte Ina Weinbauer-Heidel noch gar nicht, was ihre spezielle Mission sein würde. Doch bald kristallisierte sich ihre Leidenschaft heraus, von der Sie in diesem Buch lesen werden. Ein Leidenschaft, die uns beide verbindet, nämlich der Wunsch, mehr herauszuholen aus den Seminar- und Trainingsmaßnahmen.
In der Forschung wie in der Praxis gibt es immer wieder diese eine Beobachtung: Teilnehmende setzen nach den Trainings zu wenig des Gelernten in die Praxis um. Anfangs sind sie vielleicht Feuer und Flamme. Doch dann sind die guten Impulse bald verglüht, wie Feuerwerkskörper zu Silvester.
Diese Beobachtung war für mich der Anlass, das Buch „Die Weiterbildungslüge“ zu schreiben. Um aufzurütteln. Als Plädoyer gegen die Wirkungslosigkeit. Und um die gängigen Mechanismen in den Firmen sichtbar zu machen – damals noch unter dem Pseudonym Richard Gris. Die Arbeit bei einer Unternehmensberatung erlaubte mir nicht, meinen wahren Namen zu nutzen. Das Buch kam 2008 auf den Markt und ist heute so aktuell wie damals. Leider!
Seit rund 10 Jahren rangiert laut den Trendstudien des swiss competence centre for innovations in learning (scil) der Universität St. Gallen das Thema „Bildungsmaßnahmen transferförderlich gestalten“ unter den Top 3 der Herausforderungen für Personalentwickler. Transferförderung ist und bleibt Spitzenreiter! Im Prinzip könnte man doch annehmen, dass dieses Problem längst verschwunden wäre – wenn es denn jemand angepackt hätte. Stattdessen wird nun seit 10 Jahren darüber gesprochen.
Hat die Unternehmenswelt vielleicht selbst ein Transferproblem? Nämlich die Umsetzung dessen, was die Wissenschaft schon weiß?
Ina Weinbauer-Heidel schließt die Lücke mit ihrem gut lesbaren und praxisorientierten Buch. Ich sehe es als die Antwort auf die Weiterbildungslüge. Wer Schluss machen will mit ineffizienten Trainingsmaßnahmen, findet auf den folgenden Seiten die richtige Lektüre.
Die Autorin hat sich zum Ziel gesetzt, zwölf leicht anzuwendende Stellhebel zu beschreiben. Und ihre Botschaft ist auch erfreulich: Sie müssen nicht alle Stellhebel umsetzen, einer allein kann schon einen Unterschied machen. Es geht um die Macht der kleinen Schritte!
Ich habe großen Respekt, wie es der Autorin gelungen ist, das gesamte Forschungswissen zum Thema Trainingstransfer auf die wichtigsten Punkte einzudampfen. Immerhin hat sie sich jahrelang intensiv in die Materie eingelesen und im Rahmen ihrer Doktorarbeit Schrankwände von Literatur gesichtet und ausgewertet. Sich hier zu fokussieren, war sicherlich keine leichte Aufgabe.
Die Zeit ist reif für dieses Buch. Es ist höchste Zeit, umzudenken! Denn nur etwa 20 Prozent der Teilnehmer schaffen es „einfach so“, das Gelernte für sich nutzbar zu machen, wie meine eigene Forschungsrichtung zum Thema Transferstärke zeigt.
Damit Trainings wirksam sind, braucht es eine systematische Förderung des Trainingstransfers. Dieses Buch bietet eine klare Anleitung.
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und eine wirksame Umsetzung der Stellhebel.
Prof. Dr. Axel Koch
Professor für Training & Coaching,
Hochschule für angewandtes Management, Erding (Deutschland)
DIE STELLHEBEL BEI DEN TEILNEHMENDEN
I want – I can – I will In the end, transfer is a trainee’s decision
Stellhebel 1 Transfermotivation
Stellhebel 2 Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Stellhebel 3 Transfervolition
In diesem Teil lesen Sie,
• wie Sie Teilnehmende zum Transfer motivieren können,
• was die magische Vier-Minuten-Meile mit Transfer zu tun hat,
• wie unser Willensmuskel funktioniert
• und was Sie tun können, um die Stellhebel des Teilnehmers auf „transferwirksam“ zu stellen.
STELLHEBEL 1 – TRANSFERMOTIVATION
ZWEI BEISPIELE AUS DER PRAXIS
Christina und Martin haben vor einer Woche jeweils ein unternehmensinternes „Leadership Excellence“-Programm abgeschlossen. Lesen Sie, was die beiden berichten. Bei wem wird der Transfererfolg höher ausfallen?
Martin, 38, Führungskraft in der Automobilbranche
„Als mich mein Chef für das „Leadership Excellence“-Programm nominiert hat, war ich echt stolz. Ich hatte schon von den anderen gehört, dass mich das Programm wirklich weiterbringen würde. Im Kick-off war die Geschäftsführung höchstpersönlich da, um uns ganz konkret zu sagen, warum es dieses Programm gibt und was es mir und der Firma nutzen würde. Die Firma lässt es sich einiges kosten, um uns dabei zu unterstützen, dass wir das Gelernte praktisch für uns nutzen können. Im Programm selbst habe ich mich gut wiedergefunden. Die Themen, die ich eingebracht habe, wurden aufgegriffen. Die Trainer begegneten uns auf Augenhöhe – überhaupt nicht belehrend. Wir Teilnehmer waren die meiste Zeit selbst aktiv, anstatt stundenlang nur passiv zuzuhören. Und immer und immer wieder haben wir über die Anwendungsmöglichkeiten und den Nutzen gesprochen, bei jeder einzelnen Übung. Am Ende des Programms hatte ich klare Pläne, was ich wie umsetzen wollte. Die habe ich dann auch mit meinem Chef besprochen, der mir noch richtig wertvolle Tipps gegeben hat. Ich finde es toll, dass mein Chef sich so für meine Themen interessiert. Seine Wertschätzung motiviert mich. Darüber hinaus trage ich mit der Erreichung meiner Ziele ja auch zu seinem Erfolg bei. Ich freue mich auf die weitere Umsetzung und die Umsetzungserfolge – und auf das nächste Training!“
Christina, 36, Führungskraft im öffentlichen Dienst
„Nach drei Jahren hat es nun auch mich erwischt. Ich musste in unser sogenanntes „Leadership Excellence“-Trainingsprogramm. Ich wusste ja schon im Vorhinein, dass es dort um gar nichts geht – reine Zeitverschwendung, wie die meisten anderen Trainings bei uns! Dort sagen dir Externe, wie Führen geht. Als ob die wüssten, wie der Hase bei uns läuft oder was mich beschäftigt. Ein Mega-Vortrag und ein paar 0815-Gruppenarbeiten und -übungen. Wozu die gut waren, weiß ich bis heute nicht! Was vom Programm ich umsetzen will? Ich, gar nichts! Aber das kann ich ja schwer beim Rückkehrgespräch zu meinem Chef sagen. Zuerst hatte ich ja noch gehofft, dass er es wieder vergessen würde, wie die anderen Male auch – aber nein. Diesmal hat es tatsächlich stattgefunden, weil die Personalabteilung vehement ein Protokoll eingefordert hat. Ich kam mir in diesem Rückkehrgespräch vor wie ein kleines Kind. ‚Das sollst du tun, und das funktioniert sowieso nicht!‘ – typisch mein Chef! Ich hab’s über mich ergehen lassen und einfach irgendwas ins Protokoll geschrieben. Hoffentlich habe ich jetzt wieder einige Jahre Ruhe von diesem Trainingsklamauk!“
Wie haben Sie sich in puncto Transfererfolg entschieden? Wer wird Ihrer Meinung nach mehr anwenden? Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Für Christina sind Trainings ganz allgemein ein „Klamauk“. Auch das „Leadership Excellence“-Programm war für sie Zeitverschwendung. Der Nutzen des Programms und der einzelnen Inhalte und Übungen waren für Christina nicht ersichtlich und anschlussfähig. Sie hat keine Motivation, das Gelernte anzuwenden. Ganz anders Martin. In seiner Wahrnehmung ist es eine Ehre und Chance, für das „Leadership Excellence“-Programm nominiert zu werden. Der Nutzen war für ihn persönlich und seine Organisation klar ersichtlich. Für Martin war völlig klar: Er will das Gelernte umsetzen. Diesen starken Wunsch, das Gelernte im Arbeitsalltag aktiv zu nutzen und umzusetzen, bezeichnen Forscher als Transfermotivation.1 Hat ein Teilnehmer eine hohe Transfermotivation, verlässt er das Training mit einem starken „Ja, ich WILL das umsetzen“-Gefühl. Wie wir noch diskutieren werden, sind neben dem Teilnehmer auch die Organisation und das Trainingsdesign für den Transfererfolg ausschlaggebend.
Doch eine ganz zentrale Grundentscheidung trifft der Teilnehmer selbst. Nämlich die Entscheidung darüber, ob er das Gelernte ganz grundsätzlich anwenden will oder nicht. Es liegt auf der Hand, dass diese Entscheidung, diese Motivation zum Transfer eine entscheidende Rolle spielt. Wenn der Teilnehmer das Gelernte nicht von sich aus anwenden will, ist der Transfererfolg nahezu ausgeschlossen. Hat er dagegen von sich aus den starken Wunsch, das Gelernte anzuwenden, ist bereits viel erreicht. Das bestätigen uns – wenig überraschend – auch die empirischen Studien der Transferforschung – hohe Transfermotivation ist eine bedeutende Determinante des Trainingstransfers.2
TRANSFERMOTIVATION – JA, ICH WILL!
Transfermotivation auf den Punkt gebracht
Teilnehmende sagen
„Ja, ich will es!“
Definition
Der Stellhebel Transfermotivation beschreibt die Intensität des Wunsches, das Gelernte am Arbeitsplatz umzusetzen.
Leitende Fragestellung
Wie können Sie dafür sorgen, dass die Teilnehmehmenden den starken Wunsch haben, das Gelernte am Arbeitsplatz umzusetzen?
Motiviert zu sein bedeutet also, etwas wirklich zu wollen. Aha. Aber wann bzw. warum wollen wir etwas denn wirklich? Diese Frage beschäftigt uns Menschen seit langer Zeit. Die Motivationsforschung ist ein riesiges Forschungsgebiet mit schier unerschöpflichen Publikationen, Studien und Theorien. Wahrscheinlich sind auch Sie nicht an Namen wie Herzberg, Maslow, Murray oder Alderfer vorbeigekommen und kamen mit Begriffen aus der Motivationspsychologie in Berührung wie Motive, Triebe, Bedürfnispyramide, Motivatoren und Hygienefaktoren, extrinsische und intrinsische Motivation. Selbst der Versuch, einen ersten Überblick über die Theorien und Erkenntnisse der Motivationsforschung zu geben, würde wahrscheinlich einen eigenen 500-Seiten-Schmöker füllen. Daher wollen wir uns hier auf wenige Motivationstheorien und -dimensionen beschränken, die zum Entwickeln von transferfördernden Maßnahmen besonders ergiebig sind.
Motivation zweiter Klasse?
Wenn Sie Ihr dreijähriges Kind fragen, warum es am Nachmittag spielen will, dann wird es Ihnen wahrscheinlich antworten „Ja, weil ich es mag. Weil es mir Spaß macht!“. Wenn Sie Ihr vierzehnjähriges Kind fragen, warum es am Nachmittag Chemie lernen will, wird es Ihnen – im Optimalfall – dasselbe antworten. Wie gesagt – im Optimalfall. Häufiger werden Sie leider die Antwort erhalten „Weil ich am Montag den Test bestehen will!“ oder „Weil du gesagt hast, dass ich dann am Abend Playstation spielen darf.“ Hier scheint es also einen grundlegenden Unterschied zu geben: Ihr Dreijähriger will, weil ihm die Tätigkeit an sich Freude bereitet; Ihr Vierzehnjähriger will, weil etwas Externes – etwas anderes als die Tätigkeit selbst – als Folge angestrebt wird. Dieser Unterschied fiel schon Aristoteles auf, vielleicht weil auch er zwei Kinder hatte. Viel später kam dieser Unterschied wieder auf und wurde 1918 von Robert S. Woodworth, einem einflussreichen US-amerikanischen Psychologen, als intrinsische und extrinsische Motivation beschrieben.3 Intrinsisch heißt, von „innen“ heraus motiviert zu sein, wollen um der Aufgabe selbst willen (Ihr spielender Dreijähriger). Extrinsisch motiviert heißt, von „außen“ motiviert zu sein, also wollen, weil etwas Erstrebenswertes erwartet wird, wenn die Aufgabe erfolgreich erledigt ist (Playstation nach dem Lernen – juhu!). Soweit scheinen ja beide Motivationsarten durchaus brauchbar und sinnvoll zu sein, wenn es darum geht, Menschen für etwas zu motivieren und sie damit zu einer bestimmten Handlung „anzustiften“. Im zweiten Fall haben wir nur das Problem, dass das angestrebte Verhalten schnell eingestellt wird, sobald die Sanktionen oder Belohnungen aufhören bzw. nicht entsprechend kontrolliert werden können. Folglich scheint es eine „wahre, echte, bessere und nachhaltigere“ Motivation zu geben, die es anzustreben gilt, nämlich die intrinsische. Und eine „unechte, nicht ganz so gute und weniger nachhaltige“ Motivation zweiter Klasse, die extrinsische. Entsprechend der Hinweis in vielen glückversprechenden Ratgebern: Tue nur das, was dir Spaß macht! Also jene Dinge, für die du intrinsisch motiviert bist. Aber mal ehrlich, wie realistisch ist es denn, im (Arbeits-)Alltag in jeder Minute nur das zu tun, was uns Spaß macht, und sofort damit aufzuhören, wenn es das nicht mehr tut? Und wie realistisch ist das in Bezug auf den Trainingstransfer? Ist es grundsätzlich eine „unechte, zweitklassige“ Motivation, wenn unsere Teilnehmenden das Gelernte anwenden, weil sie sich davon erstrebenswerte Ergebnisse, Erfolge oder Belohnungen erhoffen (extrinsische Motivation) und nicht nur weil ihnen die Tätigkeit an sich Freude bereitet (intrinsische Motivation)? Und es kann ja auch keine Lösung sein, dass es jedes Mal Belohnungen (beispielsweise eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung) braucht, um die Teilnehmenden zum Transfer zu verführen. Oder einen Chef, der mit erhobenem Zeigefinger mit Konsequenzen bei der Nicht-Anwendung des Gelernten droht. Irgendwie scheint diese Unterscheidung in intrinsische und extrinsische Motivation noch nicht ganz ausreichend zu sein …
Was nach extrinsisch und intrinsisch kommt
Intrinsische und extrinsische Motivation wurden lange als gegensätzliches, unvereinbares Begriffspaar betrachtet. Ein verbreiteter Unterton in der Motivationsliteratur: Intrinsische Motivation ist besser (tue nur, was dir Spaß macht) als extrinsische Motivation. Doch bei der extrinsischen Motivation gibt es bedeutsame Unterschiede. Vielleicht macht ein Studium oder das Aufräumen der Garage nicht immer Spaß, aber das Ergebnis (der Abschluss, der unglaubliche Anblick der Garage, wenn sie ordentlich und nahezu leer ist) ist eine Wohltat, für die sich das Engagement ausgezahlt hat. Ganz anders ist die Qualität der Motivation freilich, wenn die Eltern das Studium „aufzwingen“ oder der Ehemann das Ausräumen der Garage anordnet – hier entsteht sofort ein unangenehmes Gefühl. Was macht den Unterschied in der Motivationsqualität? Es ist die Selbstbestimmung, sagen Deci und Ryan und entwickelten daraus die Selbstbestimmungstheorie der Motivation.4 Populär wurde diese Theorie durch Daniel Pink, seinen TED-Talk und seinen Bestseller.5 Für Daniel Pink ist die Selbstbestimmungstheorie die Schatzkiste der Motivationsforschung, und sind Deci und Ryan jene Forscher, über die wir in vierzig Jahren sagen werden, dass sie die einflussreichsten Sozialwissenschaftler unserer Zeit waren. Neugierig? Dann schauen wir uns die Selbstbestimmungstheorie etwas genauer an.
Wie der Name schon sagt, ist der Dreh- und Angelpunkt ihrer Motivationstheorie die Selbstbestimmtheit. Im Zentrum steht hier nicht mehr die Frage „Macht die Handlung an sich Spaß oder nicht“, sondern die Frage „Will ich es selbst, oder wollen es andere“. Diese Theorie geht davon aus, dass Menschen ein angeborenes Grundbedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung haben. Ähnlich wie Maslow, der die Selbstverwirklichung an die Spitze seiner Bedürfnispyramide stellt, gilt auch in dieser Theorie, dass wir Menschen ganz grundsätzlich danach streben, das zu tun, was wir selbst wollen. Dabei ist es zusätzlich förderlich, wenn das Tun an sich Freude bereitet (intrinsische Motivation), aber nicht zwingend notwendig. (Nachhaltig) Motiviert gehen wir an Dinge heran, die für uns selbst positive und erstrebenswerte Folgen haben.
Warum diskutieren wir das? Was bringt uns diese Theorie in puncto Transfermotivation? Die Antwort lautet: Sie bringt uns zusätzliche Handlungs- und Motivationsmöglichkeiten! Denken Sie beispielsweise an ein Telefonakquisetraining. Eines der Ziele lautet vielleicht: Die Teilnehmenden rufen jede Woche fünf potenzielle KundInnen an. Wie fördern wir die Transfermotivation? Oder anders gefragt: Wie schaffen wir es, dass die Teilnehmenden sagen „Ja, das will ich!“? Hier drei mögliche Ansatzpunkte:
extrinsisch-kontrolliert motivieren
extrinsisch-autonom motivieren
intrinsisch-autonom motivieren
Sie fördern die Transfermotivation, indem Sie aufzeigen, dass andere wollen, dass so gehandelt wird
Sie fördern die Transfermotivation, indem Sie aufzeigen, wie erstrebenswert die Folgen und Ergebnisse der Handlung sind
Sie fördern die Transfermotivation, indem Sie aufzeigen, wie viel Freude die Handlung macht
Die Teilnehmenden sagen: Ich rufe wöchentlich fünf KundInnen an, weil mein Chef das so will
Die Teilnehmenden sagen: Ich rufe wöchentlich fünf KundInnen an, weil ich damit mehr verkaufe – und das finde ich toll
Die Teilnehmenden sagen: Ich rufe wöchentlich fünf KundInnen an, weil das Telefonieren einfach Spaß macht
Wir wissen aus empirischen Studien, dass alle drei Versionen, also sowohl die autonome als auch die kontrollierte Transfermotivation den Transfererfolg steigern.6 Das heißt, der Transfererfolg steigt auch, wenn Druck von außen ausgeübt wird (z. B. von den Vorgesetzten, vom Unternehmen, vom Trainer etc.). Allerdings sagen uns Bauchgefühl, Hausverstand und die Selbstbestimmungstheorie, dass diese kontrollierte Motivation nicht unbedingt eine optimale, erwachsenengerechte und nachhaltige Form ist. Demnach gilt es, weniger auf die kontrollierte, als vielmehr auf die autonome Form der Motivation zu setzen und diese zu fördern.
Motivieren Sie durch klaren, transparenten Nutzen. Auch wenn das Anwenden des Erlernten nicht (immer) Spaß macht, können die Teilnehmenden nachhaltige Transfermotivation entwickeln. Thematisieren Sie immer wieder den Nutzen und die erwünschten Folgen der Anwendung!
Wie kann das nun praktisch aussehen? Wie kann man die autonome Motivation unterstützen und fördern? Hier einige Beispiele zum Weiterdenken.
Das fördert die autonome Transfermotivation
Beispiele
Entscheidungen begründen statt wortlos zu bestimmen
• Mit den Teilnehmern besprechen, warum genau sie für ein Training nominiert wurden
Nutzen und Sinn klar kommunizieren statt ihn stillschweigend vorauszusetzen
• Den Nutzen des Trainings für den Teilnehmer deutlich machen (z. B. in der Trainingsbeschreibung, im Kick-off, im Entsendungsgespräch etc.)
• Im Training selbst bei jeder Übung und jedem Inhalt den Nutzen kommunizieren
Wählen lassen statt vorschreiben
• TeilnehmerInnen vorab über Inhalte und Methoden des Trainings mitbestimmen lassen
• Den TeilnehmerInnen im Training Wahlmöglichkeiten bieten (z. B. mehrere Themeninseln, aus denen sie selbst wählen können, welches Thema sie bearbeiten möchten)
Forschend-entdeckendes Lernen statt rezeptives Lernen
• Im Training auf aktive, problembasierte Lernmethoden setzen, statt mit Frontalvorträgen zu „belehren“ (mehr dazu finden Sie beim Stellhebel 6 – Aktives Üben)
Autonomieförderndes Wording statt kontrollierendes Wording
• Im gesamten Wording in und um das Training darauf achten, dass wir kontrollierende Ausdrücke wie „Sie müssen“, „es wurde beschlossen, dass“, „das geht nicht so, sondern anders“ usw. durch autonomiefördernde Ausdrücke wie „ich lade Sie ein“, „ich habe die Erfahrung gemacht“, „eine weitere Möglichkeit wäre …“ usw. zu ersetzen
• Als Trainer und Vorgesetzte mit Lob, Feedback und einer coachenden Haltung unterstützen statt als Kontrollinstanz zu agieren (mehr dazu lesen Sie beim Stellhebel 10 – Unterstützung durch Vorgesetzte)
Selbstverantwortung stärken statt ausschließlich andere für den Transfererfolg verantwortlich machen
• Die eigene Verantwortung für den Lern- und Transfererfolg vor, im und nach dem Training deutlich machen, anstatt sie auf die Trainer oder andere abzuwälzen
So ein selbstbestimmtheitsfördernder Umgang mit Lernenden ist für viele bereits selbstverständlich. Es ist eine Grundhaltung, die auch in Punkto Transferförderung entscheidend ist.
Hände hoch oder ich schieße – Transfer als Zwang
Beim Stichwort Grundhaltung sind wir an einem sehr spannenden und ganz grundsätzlichen Punkt der Transferförderung angelangt. Fassen wir das Bisherige nochmal zusammen: Transfermotivation ist dann vorhanden, wenn Teilnehmenden sagen „Ich WILL es“. Nach den Ausführungen zur kontrollierten und autonomen Motivation können wir nun schon präziser werden. Was wir uns wünschen, sind Teilnehmende, die sagen: „Ich will es (anwenden), weil ICH es will“ und weniger „Ich will es (anwenden), weil ANDERE es wollen“. Diese Erkenntnis zeigt uns etwas Grundsätzliches und Wichtiges: Transferinterventionen sollten niemals Kontrolle oder Zwang sein, sondern stets Unterstützungs- und Förderungsangebote für selbstbestimmt Lernende. Transfer fördern heißt nicht, die Anwendung des Gelernten zu erzwingen, sondern vielmehr die Anwendung zu ermöglichen und bestmöglich zu fördern. Mit allen Transferinterventionen streben wir danach, den Weg zum Transfererfolg so einfach und barrierefrei wie möglich zu gestalten. Dadurch ermöglichen wir der Organisation und insbesondere den Teilnehmenden selbst, den größtmöglichen und nachhaltigsten Nutzen aus der Trainingsinvestition (dem Geld, der Zeit, dem Engagement etc.) zu ziehen. Das ist sowohl im Interesse der Organisation als auch der Teilnehmenden selbst.
Aus dieser Grundhaltung folgt, dass alle weiteren Stellhebel in diesem Buch und die daraus abgeleiteten Ideen zur Transferförderung nicht nur den Transfererfolg, sondern immer auch die Transfermotivation unterstützen. Das ergibt sich ganz von selbst. Transferinterventionen sind Unterstützungs- und Ermöglichungsangebote und kein Zwang. Und Unterstützungs- und Ermöglichungsangebote zielen darauf ab und setzen gleichzeitig voraus, dass selbstbestimmt Lernende das Angebot (die Intervention) und das Ergebnis (den Transfererfolg) selbst wollen. Dem Transfererfolg und jeder Transferintervention geht immer eine hohe Transfermotivation – ein „Ich will es anwenden“ – voraus. Der Umkehrschluss allerdings funktioniert leider nicht. Die Transfermotivation alleine ist noch kein Garant für den Transfererfolg.
Transfermotivation – das individuelle Wollen – ist eine entscheidende Voraussetzung, aber noch kein Garant für den Transfererfolg.
Wollen alleine reicht noch nicht aus, um es wirklich zu tun bzw. tun zu können. Auch das werden wir bei den anderen Stellhebeln noch genauer diskutierten. Für den Moment wollen wir festhalten, dass Transferinterventionen stets Unterstützungs- und Ermöglichungsangebote sind, die den Weg zum Transfererfolg ebnen – und das sollten wir bei der Gestaltung und dem Wording zu all unseren Transferinterventionen berücksichtigen.
Transferfördernde Maßnahmen machen den Teilnehmenden die Entwicklung und Anwendung des Erlernten einfach, schmackhaft und barrierefrei möglich. Es sind Ermöglichungs- und Unterstützungsangebote für selbstbestimmte, nutzenorientierte, erwachsene Lernende.
Sind nur Freiwillige motiviert?
Was ist mit der Selbstbestimmtheit und dem Zwang in puncto Teilnahme am Training? Sollten Trainings – der Logik der autonomen Motivation folgend – nicht generell nur noch auf freiwilliger Basis erfolgen? Nur zu oft sind TrainerInnen und PersonalentwicklerInnen mit Teilnehmenden konfrontiert, die ins Training „geschickt“ wurden und gelangweilt im Stuhlkreis sitzen. Oder schlimmer noch: Sie machen ihrem Unmut offen Luft und beeinflussen so mitunter die Stimmung der ganzen Gruppe negativ. Sind also Teilnehmer, die zum Training verpflichtet bzw. dafür „nominiert“ wurden, ganz grundsätzlich weniger motiviert? Eine gute Frage, die es sich zu diskutieren lohnt. Die Forschung zeigt, dass die Transfermotivation ganz wesentlich von der Motivation vor bzw. im Training beeinflusst wird.7 Also ab sofort nur noch freiwillige Trainings? Studien zeigten tatsächlich, dass eine freiwillige Teilnahme am Training zu höherer Motivation führte.8 In anderen Studien dagegen konnte genau das aber nicht bestätigt werden.9 Es wurde sogar das Gegenteil nachgewiesen: Teilnehmer, die verpflichtend am Training teilnahmen, waren die motivierteren.10 Was stimmt denn nun? Wie kann man diese widersprüchlichen Ergebnisse erklären?
Es sind (1) die subjektive Einschätzung der Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des Trainings und (2) die eigenen vorherigen Trainingserfahrungen, die den Unterschied ausmachen. Ein Gedankenexperiment: Denken Sie an einen Teilnehmer, der in der Vergangenheit ausgesprochen gute Erfahrungen mit Trainings in Ihrem Unternehmen gemacht hat. Die Trainings waren für ihn bisher ausgesprochen nützlich, sinnvoll und hilfreich. Durch die Anwendung des Gelernten konnte er sich selbst deutlich und erfolgreich weiterentwickeln. Wie wird es diesem Teilnehmer gehen, wenn er erfährt, dass ein weiteres Training ansteht? Klar! Er wird es als weitere Chance betrachten. Es ist weniger ein Gefühl der Verpflichtung als vielmehr ein Gefühl, auserwählt oder nominiert zu werden. Kein Zwang, sondern eine Chance, eine Belohnung, eine Ehre. Die Folge der Nominierung: die Motivation steigt. Wird dagegen ein Teilnehmer für genau dasselbe Training nominiert (und damit verpflichtet), der bisher Trainings durchweg als Zeitverschwendung erlebte – unwirksam und sinnlos – wird diese Nominierung genau den gegenteiligen Effekt haben: Es demotiviert ihn zusätzlich! Die Motivation hängt also stark von den gemachten Vorerfahrungen ab.
Neben der Erfahrung spielt die dem Training subjektiv zugeschriebene Bedeutsamkeit eine entscheidende Rolle. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitglied des Personalentwicklungsteams in einem Unternehmen. Alle drei Jahre findet eine sehr bedeutsame Konferenz in Washington statt, auf der die neusten Erkenntnisse aus der Personalforschung vorgestellt werden, und das von den weltweit namhaftesten ExpertInnen der Branche. Jeder in Ihrem Team möchte dorthin. Denn jedes Mal, wenn jemand von dieser Konferenz zurückkehrt, kommt er mit innovativen Ideen, die richtungsweisend sind für die Personalarbeit im Team. Der Chef hat großes Interesse an diesen Ideen und unterstützt die Einführung und Umsetzung mit vollem Engagement. Beim Jour fixe dann die Ankündigung: Der Chef schickt dieses Jahr genau Sie zur begehrten Konferenz. Genau Sie fahren nach Washington, lernen und werden auch mit genialen Ideen zurückkehren! Wie steht es um Ihre Motivation? Sie ist hoch? Und das, obwohl Sie bzw. gerade weil Sie geschickt wurden! Genau so geht es auch den Teilnehmenden eines Trainings. Ist das Training bedeutsam und wichtig, steigert das „Geschickt werden“ die Motivation. Ist es nur irgendein weiteres Training, das laut Vorschrift besucht werden muss, senkt es die Motivation der Teilnehmenden, wenn sie geschickt werden. Die Vorerfahrung und die zugeschriebene Bedeutsamkeit machen den Unterschied!
Auch Teilnehmende, die für ein Training verpflichtet oder nominiert wurden, können hoch transfermotiviert sein. Entscheidend ist (1), welche Vorerfahrungen der Teilnehmer mit Trainings gemacht hat und (2), als wie bedeutsam und wertvoll er das Training erachtet („Ehre und Chance“ versus „lästige Pflicht“).
Stellen Sie sich vor, Sie treffen auf der nächsten PersonalentwicklerInnenkonferenz eine Kollegin, die mit dem Thema Freiwilligkeit hadert. „Unsere Führungskräfteentwicklung ist verpflichtend – jeder muss da durch. Das demotiviert ja total! Ich will, dass die Leute motiviert sind, aber der Chef verlangt, dass alle Führungskräfte durchs Training geschleust werden. Was soll ich nur tun?“ Was könnten Sie ihr raten? Richtig! Die Frage ist nicht „Wie boxe ich Freiwilligkeit durch?“, sondern vielmehr „Wie machen wir unsere Trainings bedeutsamer und begehrter?“ und „Wie fördern wir, dass die Teilnehmer positive Erfahrungen sammeln und unser Training als wirksam und nützlich erleben?“. Wenn die MitarbeiterInnen die Teilnahme am Training als Chance begreifen, die sie dankbar in Anspruch nehmen, dann ist die Nominierung (bzw. Verpflichtung) dazu ein Zeichen der Wertschätzung – die zusätzlich motiviert!
Arbeiten Sie aktiv am Image Ihrer Trainings! Sorgen Sie dafür, dass Trainings im Unternehmen als bedeutsam, erstrebenswert, nützlich und wirksam wahrgenommen und erlebt werden!
Ein kritischer Blick auf dicke Bildungsprogramme
Das Thema Bedeutsamkeit, Wert und Exklusivität bringt uns an einen weiteren spannenden Diskussionspunkt. Wann und wodurch werden Trainings bedeutsam, begehrt und exklusiv? Lassen Sie mich dies anhand zweier Extrembeispiele verdeutlichen.
Unser erstes Unternehmen bietet seinen MitarbeiterInnen ein umfassendes Bildungsprogramm. Es ist ein über 100-seitiger Katalog an Trainingsangeboten, aus denen Interessierte auswählen können – ganz wie es viele MitarbeiterInnen im Einstellungsgespräch fordern. Dieses Bildungsprogramm wird jährlich an alle MitarbeiterInnen des Unternehmens verschickt. Die Kennzahlen dieser Personalentwicklungsabteilung sind „Qualifizierungstage pro Mitarbeiter pro Jahr“ und „Anzahl angebotener Trainings“. Diese Kennzahlen gelten als Leistungsmaßstab der Personalentwicklung. Dass physische Anwesenheit in einem Training natürlich nichts über den Transfererfolg bzw. die Wirksamkeit des Trainings aussagt, sei für den Moment hintangestellt (wir werden noch genauer darauf eingehen bei Stellhebel 12 – Transfererwartung im Unternehmen). Konzentrieren wir uns jetzt darauf, was das dicke Bildungsprogramm dieses Unternehmens und der Anspruch, möglichst viele Trainingstage zu erreichen, bewirken. Während einige Trainings in unserem Beispielunternehmen gut besucht sind, steht die Personalentwicklung bei vielen anderen Trainings immer öfter vor der Frage: „Wie bekommen wir dieses Training nur voll?“. Entsprechend nutzt die Personalentwicklung jede Gelegenheit, um für die betreffenden Trainings Werbung zu machen. Es werden Mails versandt, die die MitarbeiterInnen zusätzlich auffordern, sich für dieses Training anzumelden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Trainingskontingent, das jedem Mitarbeiter zu Verfügung steht, bitte auszuschöpfen sei. Die Führungskräfte werden daran erinnert, ihre MitarbeiterInnen in Trainings zu schicken. Aufgrund der verfügbaren (und zu besetzenden) Trainingsplätze kommt es auch schon mal vor, dass eine Sekretärin im Training „Visualisierung am Flipchart“ sitzt, obwohl sie weiß, dass sie weder bisher noch künftig mit Flipchart arbeiten wird. Aber weil es um „allgemeine Präsentationskompetenzen“ und das Aufbrauchen des Trainingskontingents geht, hat sie der Empfehlung der Personalabteilung nachgegeben. Die MitarbeiterInnen in diesem Unternehmen sind mit einem Überangebot an Trainings konfrontiert. Statt der Einstellung „Ich darf ein Training besuchen“ ist der Tenor dort: „Ich soll/muss heuer noch zwei Trainingstage verbrauchen.“ Spüren Sie, was dadurch in puncto Bedeutsamkeit, Wert und insbesondere Motivation passiert? Sie sinkt! „Seminarmüdigkeit“ ist ein Begriff, den die überaus engagierte Personalentwicklung dieses Unternehmens insbesondere bei den Führungstrainings nur zu gut kennt.
Das andere Extrembeispiel: Ein Vertriebsunternehmen organisiert die Weiterbildung folgendermaßen: Es gibt ein sehr kompaktes Trainingsangebot. Damit die MitarbeiterInnen am Training teilnehmen können, müssen sie zuvor bestimmte Ziele erreichen (so berechtigt ein bestimmter Jahresumsatz zur Teilnahme am Training „Aktiv Verkaufen 2“). Oder der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin, die für einen nächsten Karriereschritt nominiert wurde, ist zur Teilnahme an „Führung 1“ zugelassen. Vor der Teilnahme bewerben sich die MitarbeiterInnen um die Trainingsplätze mit einem Motivationsschreiben. Die Kennzahlen der Personalentwicklungsabteilung sind „Transferquote“ und „Anzahl der umgesetzten Transfervorhaben“. Diese Zahlen werden im halbjährlich erscheinenden MitarbeiterInnenmagazin veröffentlicht. Gemeinsam mit Interviews einzelner Teilnehmender, die dort über das Training und ihre Umsetzungserfahrungen und -erfolge berichten. Abgesehen davon, dass dieses Unternehmen mit einem weit geringeren Weiterbildungsbudget auskommt, kennt man das Schlagwort „Seminarmüdigkeit“ dort nicht.
Worin liegt der Unterschied? Es ist ein bewährtes und bekanntes ökonomisches Prinzip: das Prinzip der Knappheit. Ein Überangebot reduziert den Wert. Und wenn das Training nicht als wertvoll bzw. bedeutsam erachtet wird, sinkt die Motivation der Teilnehmenden. Das heißt nun nicht, dass sämtliche Bildungsprogramme – symbolisch gesprochen – mit der Heckenschere radikal gestutzt werden müssen. Aber ich möchte Sie motivieren, wie beim Rosenschneiden vorzugehen und mutig überflüssige einzelne Triebe zu entfernen, damit der ganze Rosenstock wachsen kann. Ein umfassendes Bildungsprogramm an sich und die Anzahl der durchgeführten Trainings sind aus Transfersicht kein Qualitätskriterium erfolgreicher Personalentwicklungsarbeit. Weniger Angebote, dafür klar bedarfs- und transferorientiert: Das gibt nicht nur Budget frei, sondern trägt auch dazu bei, die Motivation und damit den Transfererfolg zu fördern. Und erlebte Wirksamkeit in einem absolvierten Training fördert die positive Einstellung für das nächste!
Ein umfassendes Trainingsangebot und die Anzahl absolvierter Trainingstage sind kein Qualitätskriterium für transferwirksame Personalarbeit. Trauen Sie sich, weniger Trainings anzubieten. Setzen Sie auf Transferqualität statt auf Trainingsquantität!
Zusammenfassung
Die Transfermotivation ist eine entscheidende Determinante des Transfererfolgs. Dabei gibt es unterschiedliche Qualitäten von Motivation. Weniger nachhaltig ist die extrinsische, kontrollierte Motivation (z. B. ein Vorgesetzter oder eine Personalabteilung, die durch Protokolle und strikte Evaluierung kontrolliert, ob das Gelernte auch tatsächlich umgesetzt wird). Diese Form der Motivation besteht zumeist nur, solange strikt kontrolliert wird. Viel nachhaltiger dagegen ist die autonome Motivation – wenn also das Anwenden an sich Spaß macht (intrinsisch) oder aber die Folgen der Anwendung des Gelernten für den Teilnehmer selbst erstrebenswert und positiv sind (extrinsisch). Indem wir den individuellen Nutzen des Trainings und jeder einzelnen Übung hervorheben, Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten einräumen, selbstbestimmtes Lernen ermöglichen und Transfer durch Lob und Feedback verstärken, können wir diese nachhaltige Form der autonomen Motivation fördern. Die Selbstbestimmung soll zur Grundhaltung bei allen Transferinterventionen werden. Alle Transfermaßnahmen sind stets Unterstützungsangebote und niemals Zwang oder Kontrolle. Wirksame und erwachsenengerechte Transferinterventionen steigern demnach nicht nur den Transfererfolg, sondern auch immer die Transfermotivation der Teilnehmer. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine freiwillige Teilnahme am Training zwingende Voraussetzung für hohe Motivation ist. Wenn die Teilnehmer das Training als attraktiv und bedeutsam erachten und zudem positive Erfahrungen mit der Wirksamkeit absolvierter Trainings gemacht haben, motiviert die Nominierung bzw. Verpflichtung zum Training zusätzlich. Um die Bedeutsamkeit der Trainings zu steigern, sollten wir das ökonomische Prinzip der Knappheit nutzen: weniger Trainings, aber dafür genau auf den Bedarf zugeschnitten und mit entsprechenden transferunterstützenden Interventionen.
SO FÖRDERN SIE DIE TRANSFERMOTIVATION
Im Überblick: Ideen zum Umsetzen & Weiterdenken
Framen Sie Transferinterventionen als sinnvoll und nützlich
• Praxisbeispiele für nutzenorientiertes versus kontrollierendes Wording
Stärken Sie die Bedeutsamkeit und den Ruf Ihrer Trainings
• Bedeutsamkeitssignale durch Geschäftsführung & Co
• Testimonial-Aussage erfolgreicher AbsolventInnen
• Berichte über Transfererfolge und -interventionen
• Bewerbungsschreiben fürs Training „Transfer Level Trainings“
Stellen Sie Nutzen und Sinn ins Zentrum
• Transferziele definieren und kommunizieren
• Transferziele als Ausgangspunkt der Trainingskonzeption
• Den Nutzen jeder Trainingssequenz (jeder Übung, jedes Inputs) transparent machen
Fördern Sie Selbstinitiative und Selbstverantwortung
• Die Teilnehmenden fragen, wie viel Nutzen sie aus dem Training ziehen wollen
• Die übernommene Selbstverantwortung evaluieren
• Reale Fälle und aktives Lernen
• Theorie auslagern, um Zeit für Übung und realitätsnahe Lernerfahrungen zu schaffen
Framen Sie Transferinterventionen als sinnvoll und nützlich
Teilnehmende nehmen Transfermaßnahmen (seien es Trainerhotlines, Entsendungs- & Rückkehrgespräche, Follow-ups, Peergroups, Praxisarbeiten etc.) immer dann an, wenn sie sie für nützlich und sinnvoll erachten. Wenn Teilnehmende Transferinterventionen nur widerwillig durchführen oder sogar boykottieren, dann tun sie das vor allem, weil sie darin keinen Sinn und Nutzen sehen oder sich unangemessen kontrolliert fühlen. Eigentlich völlig logisch und verständlich! Was heißt das für uns? Ganz einfach: Wenn wir Transferinterventionen planen und einführen, dann ist entscheidend, wie wir sie für die Teilnehmenden framen und kommunizieren. Die Kommunikation über Transfer und die transferfördernden Maßnahmen entscheiden über ihren Erfolg, das Commitment und ihre Wirksamkeit. Die Regel gemäß der Selbstbestimmungstheorie: weg vom kontrollierenden hin zum fördernden, nutzenorientierten Wording!
Beispiele für kontrollierendes Wording
Beispiele für förderndes, nutzenorientiertes Wording
Die Geschäftsführung hat entschieden, dass wir den Transfer sicherstellen müssen. Deshalb werden folgende Maßnahmen getroffen …
Der Geschäftsführung ist es ein Anliegen, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus dem Training ziehen – für das Unternehmen, aber auch für sich selbst. Mit diesen Maßnahmen möchten wir Sie und Ihren Erfolg bei der Umsetzung unterstützen.
Ab sofort werden Entsendungsgespräche durchgeführt. Verwenden Sie bitte dazu das folgende Formular …
Im Gespräch mit Ihrer Führungskraft definieren Sie gemeinsam, wie Sie das Gelernte optimal nutzen können. Anbei ein Gesprächsleitfaden als Unterstützung für ein kompaktes Entsendungsgespräch
Wir sind am Ende des Trainings angelangt. Ich teile Ihnen jetzt einen Test aus, mit dem Sie das Gelernte überprüfen können …
Wir sind am Ende unseres Trainings angelangt. Es war ein langer, intensiver Tag. Ich lade Sie ein, ihn noch einmal auf unterhaltsame Weise Revue passieren zu lassen, und habe dazu folgendes Quiz für Sie mitgebracht …
Zur Sicherung des Trainingstransfers findet ein zusätzliches zweitägiges Follow-up-Treffen statt. Bitte bereiten Sie dazu eine Präsentation Ihrer bisherigen Umsetzungserfolge und -schwierigkeiten vor.
Die Umsetzungsphase ist die wichtigste Zeit des Trainings. Dort entscheidet sich, ob sich Ihre Investitionen gelohnt haben oder ungenutzt verpuffen. Im Follow-up wollen wir uns über unsere Erfolge und auch über manches Scheitern austauschen, offene Fragen klären und Herausforderungen in der Umsetzung gemeinsam bewältigen. Lassen Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben und berichten Sie uns davon in einer Kurzpräsentation.
Sie haben vor drei Monaten das Training XY bei mir besucht und hatten sich folgende Transfervorhaben gesetzt. […] Mit diesem Mail möchte ich Sie an die Umsetzung Ihrer Vorhaben erinnern. Sie haben noch nicht begonnen? Dann tun Sie es jetzt! Führen Sie ein erstes Telefonat, tragen Sie einen Termin in Ihren Kalender ein …
Drei Monate liegt unser gemeinsames Training nun schon zurück. Es interessiert mich sehr, wie es Ihnen bei der Umsetzung ergangen ist. Unter den vielen Inputs, Ideen und Diskussionsbeiträgen gab es einen Punkt, der es als Ihr wichtigstes Vorhaben aufs Papier geschafft hat, nämlich […]. Sie konnten Ihren Vorsatz bereits in die Tat umsetzen? – Ich freue mich für Sie und gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem persönlichen Transfererfolg. – Sie hatten bisher noch keine Möglichkeit zur Umsetzung? Warum dann nicht JETZT den ersten Schritt tun? Ein erstes Telefonat, einen Termin im Kalender oder erste Überlegungen zum Zeitrahmen Ihrer persönlichen Pausenzeit – Warten Sie nicht auf Gelegenheiten, sondern schaffen Sie sie!
Die Transfersicherung ist zentral für den Erfolg unseres Unternehmens. Daher evaluieren wir drei Monate nach Abschluss des Trainings den Transfererfolg …
Es ist uns ein Anliegen, Ihnen Weiterbildungsangebote auf höchstem Niveau und mit größtmöglichem praktischem Nutzen anzubieten. Daher interessiert uns, wie gut Sie das Gelernte in Ihrem Arbeitsalltag anwenden konnten. Mit der Teilnahme an dieser Befragung helfen Sie uns, unsere Angebote stetig zu verbessern.
Ist das nicht Augenauswischerei, Täuschung, manipulatives Marketing? Das kommt auf die Grundhaltung zur Transferförderung an. Ja, wenn Transferinterventionen als „Kontrollmechanismen“ verstanden werden, die dafür sorgen, dass das Gelernte auch angewandt wird. Von dieser Grundhaltung distanziere ich mich aber deutlich. Diese Formulierungen drücken genau das aus, was gemeint ist, wenn Sie Transferförderung, so wie ich, als Unterstützung und Ermöglichung für selbstbestimmte, erwachsene Lernende verstehen. Und das sollten wir in der Kommunikation niemals vergessen!
Stärken Sie die Bedeutsamkeit und den Ruf Ihrer Trainings
Wenn die Teilnehmenden Trainings als bedeutsam wahrnehmen und erleben, steigt deren Motivation. Was können wir konkret tun, um Trainings begehrenswert, wertvoll und bedeutsam zu machen? Ein bewährter Tipp aus dem Marketing: Meinungsbildner und einflussreiche Entscheider zu Wort kommen lassen. Wie wäre es, wenn im nächsten Kick-off für Ihr Leadership-Programm der Geschäftsführer höchstpersönlich erklärt, warum dieses Programm für das Unternehmen entscheidend und bedeutsam ist? Wie wäre es, wenn das Einladungsmail zur internen Vertriebsakademie vom Head of Sales höchstpersönlich kommen würde? Lassen Sie Geschäftsführung, Vorstand und/ oder Führungskräfte selbst ausdrücken, warum dieses Trainingsprogramm bedeutsam und wichtig ist – sei es live, via Videobotschaft oder in schriftlicher Form. Laden Sie GeschäftsführerInnen oder Führungskräfte zu Kamingesprächen ein, oder zur Präsentation der Umsetzungserfolge. Insbesondere bei größeren – und damit teureren – Trainingsprogrammen ist die Bereitschaft dafür meist hoch und die Wirkung beeindruckend. Denn all das signalisiert den Teilnehmenden: „Hoppla – bei diesem Training(sprogramm) gehts ja wirklich um was!“
Was können wir bei kompakteren Trainings tun? Immerhin kann sich der Vorstand nicht um jedes Ein-Tages-Training persönlich kümmern. Kein Problem! Auch AbsolventInnen können geniale Meinungsbildner sein. Lassen Sie TeilnehmerInnen eines früheren Trainings über den individuellen Nutzen und ihre Umsetzungserfolge berichten – beim Kick-off, in der Trainingsbeschreibung, bei der Anmeldung im Intranet, im Einladungsmail usw. Lassen Sie sie prägnant erzählen, wie wertvoll das Training für sie und ihre Arbeit war. Solche persönlichen und personifizierten Erfahrungen sind besonders glaubwürdig für die künftigen Teilnehmenden, weil es leicht fällt, sich mit den ehemaligen Teilnehmenden zu identifizieren (siehe auch S. 57 ff.).
Und was für bestimmte Trainings funktioniert, funktioniert natürlich auch für bestimmte Transfertools und -maßnahmen. Nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Kanäle, um wieder und wieder zu kommunizieren, welchen entscheidenden Sinn, Wert und Nutzen bestimmte Transfertools haben; beispielsweise die Entsendungs- und Rückkehrgespräche mit den Vorgesetzten, das Transferbuch, ein Follow-up und all die anderen Tools, die Sie in diesem Buch noch kennenlernen werden. Der bewährte Grundsatz „Tue Gutes und sprich darüber“ heißt in unserem Fall: Fördere und erziele Transfererfolge und berichte darüber, immer und immer wieder!
Was können Sie tun, wenn sich die Seminarmüdigkeit oder Seminarträgheit im Unternehmen bereits eingeschlichen hat? Wenn nun mal Trainings im Unternehmen den Ruf „ganz nett, aber nicht wirklich verändernd“, oder schlimmer „Zeitverschwendung“ haben? Wie kann man „neue“ Trainings von weniger wirksamen früheren Trainings abgrenzen? Die Antwort: Lassen Sie die Teilnehmer spüren, dass dieses Training anders ist als alle anderen! Wie das geht? Es gibt unzählige Möglichkeiten, auf dieses Anderssein hinzuweisen. Vielleicht gab es bisher keine persönlichen Einladungsmails mit klaren Zielen – warum nicht jetzt damit beginnen und gleich darauf hinweisen, dass dieses Training anders ist. Warum nicht – wie bereits oben diskutiert – durch die Geschäftsführung oder die Führungskräfte kommunizieren, dass dieses Training mit ganz besonderen Erwartungen verbunden ist? Warum nicht für dieses Training eine Bewerbung von den Teilnehmenden einfordern? Oder Sie verbinden all diese Elemente und führen ein eigene Kennzeichnung in Ihrem Bildungsprogramm für diese neue Art von Trainings ein, beispielsweise eine „Transfer Level Training“-Kennzeichnung. Angelehnt an andere Labels oder Qualitätssiegel, zeigt diese Kennzeichnung an, dass bei diesem Training transferfördernde Elemente integriert sind. Auf einer eigenen Seite im Bildungsprogramm können Sie erklären, warum und was „Transfer Level Training“ genau bedeutet. Die Kennzeichnung signalisiert den Teilnehmern: „Das ist etwas Neues, Anderes“, und kann somit helfen, dass vorherige Trainingserfahrungen die Einstellung zu diesem Training weniger negativ beeinflussen. Zudem bereitet es die Teilnehmenden darauf vor, dass es zusätzliche Aufgaben und Entwicklungsschritte geben wird (z. B. eine Vorbereitungsaufgabe, ein Entsendungs- & Rückkehrgespräch, ein Follow-up, eine Transferpräsentation etc.). Schritt für Schritt können dann immer mehr Trainings auf das „Transfer Level“ gehoben werden. Ein guter Weg zum sanften und kontinuierlichen Etablieren von Transferinterventionen.
Stellen Sie Nutzen und Sinn ins Zentrum
Nutzen und Sinn sind die Schlagworte in der Transferförderung. Stellen Sie den Nutzen für den Teilnehmer, das Transferziel, ins Zentrum, in den Fokus jedes Trainings. Das Transferziel legt klar verständlich fest, was konkret nach dem Training in der Praxis anders sein soll und welches Verhalten durch das Training erreicht wird. Ein klar definiertes Transferziel ist die Basis für ein transferwirksames Training – sowohl auf der konzeptionellen Seite als auch aufseiten des Teilnehmers. Die Klärung und Schärfung der Transferziele ist eine anspruchsvolle und zugleich eine der ersten und wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Bedarfs- und Auftragsklärung (siehe auch S. 15 ff)
Kommunizieren Sie die Transferziele – den Nutzen und Sinn – an die Teilnehmenden. Machen Sie sie zum Standard in Ihren Trainingsbeschreibungen und den Eröffnungssequenzen im Training. Die Teilnehmenden können nur motiviert lernen, wenn sie wissen, warum und wofür sie es tun. Während es in jüngeren Jahren noch reicht, zu lernen, um eine Prüfung zu bestehen oder einen bestimmten Abschluss zu erlangen, werden erwachsene Lernende mit zunehmendem Alter kritischer und anspruchsvoller, was das Warum angeht. Ein Abschluss oder ein „Vielleicht brauche ich das in der Zukunft mal“ reicht als Motivationsquelle oft nicht mehr aus. Mehr und mehr sollen Inhalte an sich bereichernd und spannend und unmittelbar im eigenen Umfeld nutzbar sein. Für unseren Trainingskontext bedeutet das: Sorgen Sie von Anfang an dafür, dass Ihre Teilnehmenden Klarheit darüber haben, welchen konkreten Nutzen sie aus diesem Training ziehen, warum sich das Lernengagement lohnen wird und welche Transferziele damit angestrebt werden (mehr dazu finden Sie auch beim Stellhebel 4 – Erwartungsklarheit).
Auf der Seite der TrainerInnen bilden klare, für die Teilnehmenden wichtige Transferziele den wichtigsten und zentralen Ausgangspunkt, die logische Basis für jedes erwachsenengerechte und transferwirksame Trainingskonzept. In der Praxis ist es leider oft so, dass TrainerInnen beim Konzipieren des Trainings mit den Inhalten beginnen. Sie listen beispielsweise alle Inhalte auf, die ihnen zum grob umrissenen Trainingsthema einfallen oder mit denen sie Erfahrungen gesammelt haben. Häufig in Mindmap-Form – das Trainingsthema in der Mitte und rundherum ein Ansammlung von Modellen, Fakten und Konzepten. Die Folge: ein inhalts- und lehrendenzentriertes Konzept, das die Bedürfnisse der Teilnehmenden leider nur zu oft bestenfalls tangential streift. Das ist für den Transfererfolg und die Motivation der Teilnehmenden fatal. Was vielmehr im Zentrum stehen soll, ist nicht das Trainingsthema, sondern das Transferziel, also der konkrete Nutzen, den das Training für die Teilnehmenden haben soll. Wenn Sie als TrainerIn selbst mit Mindmaps arbeiten, probieren Sie es aus! Sie werden zu völlig anderen Ergebnissen kommen und einem viel stärker nutzen- und lernendenorientierteren Konzept.
Ist das Transferziel als Zentrum der Konzeption gesetzt und in der Trainingsbeschreibung kommuniziert, gilt es, die Nutzenorientierung im gesamten Trainingsverlauf beizubehalten. Stellen Sie sich als TrainerIn bei jeder Trainingssequenz – jedem Modell, das Sie bringen, und jeder Übung, die Sie machen – die Nutzenfrage: „Warum ist dieses Modell oder diese Übung nützlich für meine Teilnehmenden? Inwiefern hilft es ihnen, das Transferziel zu erreichen?“ Seien Sie kritisch! Und seien Sie mutig! Wenn Sie keine Antwort auf diese Frage haben, lassen Sie das Modell oder die Übung weg!
Wenn Sie so vorgehen, ist es für Sie ein Leichtes, den Nutzen und Sinn der einzelnen Sequenzen für Ihre Teilnehmenden transparent zu machen. Für erwachsene, selbstbestimmt Lernende ist es absolut entscheidend zu wissen und zu spüren, warum dies oder das wichtig ist und warum sie sich damit beschäftigen sollen. Im Optimalfall sprechen Ihre Teilnehmenden das offen an, sodass Sie darauf reagieren können. Weniger optimal ist es, wenn sie ihre Fragen für sich behalten und erst am Ende des Trainings äußern, „dass eigentlich nicht so viel für mich dabei war“. Oder aber die Teilnehmenden sagen gar nichts. Der Transfererfolg jedoch bleibt aus. Um dem vorzubeugen gilt es, dem (unausgesprochenen) Bedürfnis nach Sinn nachzukommen. Machen Sie es sich zur Angewohnheit, den Sinn und Nutzen der einzelnen Trainingssequenzen schon im Vorfeld zu benennen und zu erklären.
Ein sehr empfehlenswertes Modell, um den Sinn gut und klar zu kommunizieren, ist der Golden Circle von Simon Sinek.11 Einfach mal googeln, vielleicht ist das der optimale Einstieg in Ihr nächstes Training!
Fördern Sie Selbstinitiative und Selbstverantwortung