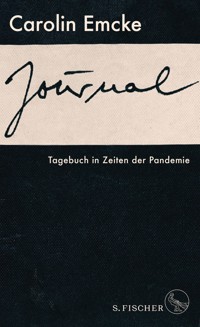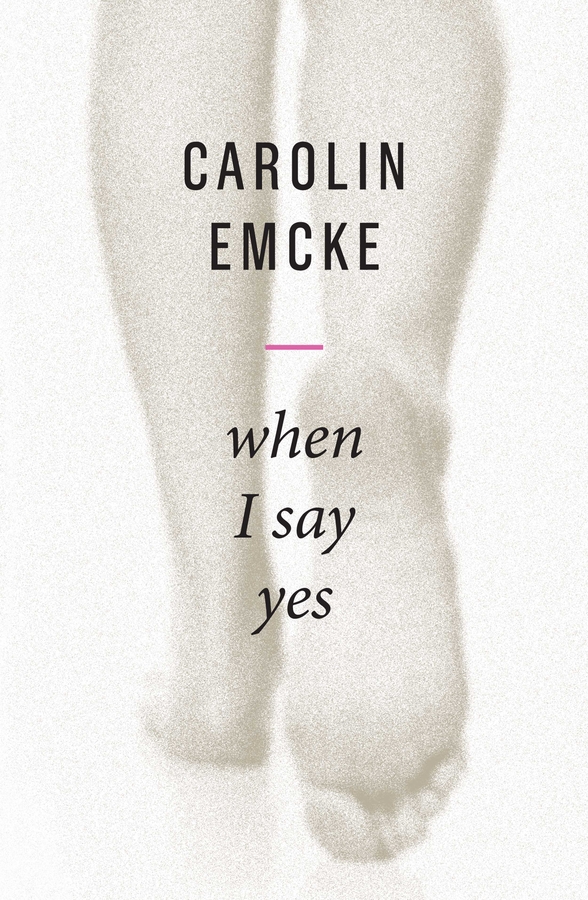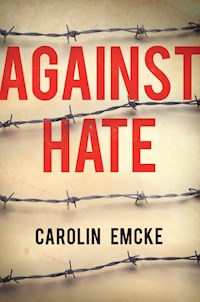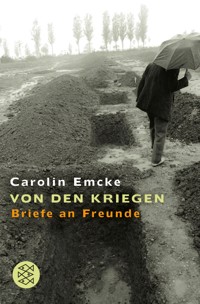Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wuppertaler Poetikdozentur für faktuales Erzählen
- Sprache: Deutsch
Ein Plädoyer für die Ethik des Erzählens und das Denken in Utopien Wie lässt sich von Gewalt erzählen? Wie lässt sich von Erfahrungen erzählen, die alle moralischen Erwartungen, was Menschen einander antun können, außer Kraft setzen? Mit welcher Behutsamkeit, welcher Diskretion und welcher Empathie muss nach einer Sprache gesucht werden im Kontext von Krieg und Gewalt? Carolin Emcke fragt nach der Ethik des Erzählens trotz allem. Für sie ist die Suche nach dem, was wahr ist, immer eine, die auch die eigene Rolle befragt. Wer über Gewalt und Trauma schreibt, muss auch über das schreiben, was als normativer Kern unangetastet bleibt: die menschliche Würde. Wer schreiberisch über das nachdenkt, was wahr ist, wer dabei vor allem über Gewalt nachdenkt und wie sie Menschen versehrt, muss auch über die Gewalt der Klimakrise sprechen: Welche Rolle spielt faktuales Erzählen beim Erzählen von Klimadiskursen? Für Emcke muss sich die Suche nach der Wahrheit im Angesicht der Klimakatastrophe in verschiedene Richtungen aufmachen. Nach rückwärts: Was ist geschehen und wer ist dafür verantwortlich? Aber auch nach vorwärts: Diese Suche nach der Wahrheit im Kontext der Klimakrise muss auch zeigen, was sein wird, sie muss Möglichkeitsräume öffnen und kartographieren. "Was wahr ist" ist ein Plädoyer für die Ethik des Erzählens und das Denken in Utopien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carolin Emcke
Was wahr ist
Über Gewalt und Klima
Wuppertaler Poetikdozentur
für faktuales Erzählen
2023
Herausgegeben von
Christian Klein und
Matías Martínez
Carolin Emcke, geb. 1967, studierte Philosophie in London, Frankfurt a. M. und an der Harvard University. Sie promovierte über den Begriff »kollektiver Identitäten«. Von 1998 bis 2014 bereiste Carolin Emcke weltweit Krisenregionen und berichtete darüber. 2003 /2004 war sie als Visiting Lecturer für Politische Theorie an der Yale University. Sie ist Philosophin und Publizistin und engagiert sich immer wieder mit künstlerischen Projekten und Interventionen, u. a. den Thementagen »Krieg erzählen« und »Archiv der Flucht« am Haus der Kulturen der Welt. Seit fast 20 Jahren kuratiert und moderiert Carolin Emcke die monatliche Diskussionsreihe »Streitraum« an der Schaubühne Berlin. Ihre Bücher »Gegen den Hass«, »Wie wir begehren«, »Ja heißt ja und …« wurden in über 15 Sprachen übersetzt.
Auszeichnungen u. a.: Merck-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (2014), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (2016), Carl-von-Ossietzky-Preis (2020).
Inhalt
Vorwort
Was wahr ist. Über Gewalt und Klima
Vorlesung 1: Gewalt
Vorlesung 2: Klima
Anmerkungen
»Begründen, was faktuales Erzählen leisten kann und muss«Carolin Emcke im Gespräch mit Christian Klein
Für Eva Gilmer
»Dieser Sprache geht es, bei aller unabdingbaren Vielseitigkeit des Ausdrucks, um Präzision. Sie verklärt nicht, sie ›poetisiert‹ nicht, sie nennt und setzt. Sie versucht, den Bereich des Gegebenen und Möglichen auszumessen [...]. Wirklichkeit ist nicht. Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein.«
Paul Celan, Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker, Paris 1958
Vorwort
Wir erzählen nicht nur für uns selbst.
Wir erzählen immer auch für die, die vor uns waren und die es selbst nicht mehr können. Wir erzählen, um an sie zu erinnern, wir erzählen, um anders an sie zu erinnern als die, die sie geleugnet und getötet haben, sie erinnert sehen wollten: als menschliche Wesen.
Wir erzählen immer auch für die, die nach uns kommen und die sich fragen, wie geschehen konnte, was geschehen sein wird. Wir erzählen, um ihre noch ungestellten Fragen zu beantworten, was wir versucht haben, worin wir gescheitert sind, wer wir hofften zu sein.
Als Erzählende muss man uns beim Wort nehmen können.
Das ist anspruchsvoller und belastender, als es klingt.
Als Erzählende müssen wir Rechenschaft ablegen. Nicht nur über das, was wir schreiben, sondern auch über uns selbst. Wer wir selber sind, was wir als wahr zu begreifen bereit sind, wie wir selbst in die Gewaltformationen und Klimakrisen verwoben sind, warum uns das Sprechen und Schreiben nicht immer leichtfällt – all das will bedacht und miterzählt sein.
Über die Bedingungen des Erzählens im Angesicht von Gewalt und Klima wollte ich in den beiden Poetikvorlesungen in Wuppertal nachdenken. Viele Jahre meines Lebens habe ich aus Krisenregionen berichtet und geschrieben. Das liegt lange zurück. Aber das Nachdenken über Ressentiments und Gewalt durchzieht immer noch alle meine Essays und Bücher. Die Klimakrise ist dafür erst in den letzten fünf bis zehn Jahren in meinen Fokus gerückt. Und so war es für mich zentral, beide Kontexte des Erzählens, Gewalt und Klima, miteinander zu verbinden.
Vorlesungen sind gesprochene Texte. Sie müssen vor-lesbar sein. Sie brauchen einen eigenen Klang, einen eigenen Rhythmus, sie lassen sich anders ein auf ein Publikum. Wenn Reden oder Vorlesungen als Texte veröffentlicht werden, geht meist etwas verloren. Ich habe die Manuskripte der Vorlesungen überarbeitet – hoffentlich, ohne den ursprünglichen Ton zu verlieren. Aber zwischen der Einladung in Wuppertal und der Abgabe dieses Texts lag der 7. Oktober, die Zäsur der entsetzlichen Anschläge der Hamas in Israel und die anschließende furchtbare Eskalation der Gewalt in Gaza. Danach war alles aus den Fugen. Es war schwer, weiter zu schreiben. Aber die hier verhandelten Fragen nach Wahrheit und Utopie, nach der Ethik des Erzählens haben ihre Dringlichkeit nicht verloren. Im Gegenteil. Wie Trauma und Gewalt sich einschreiben, wie sie das Weltvertrauen versehren und damit unsere Fähigkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, das hat sich in diesen bitteren Wochen einmal mehr gezeigt.
Und doch bleibe ich dabei: Wir sind sprachliche Wesen. Wir können nur durch und im Sprechen uns verstehen und die Welt begreifen. Und so hoffe ich, dass dieser kleine Band als ein Plädoyer verstanden wird für das Erzählen trotz allem.
Berlin, im Dezember 2023
Carolin Emcke
Was wahr ist
Über Gewalt und Klima
Vorlesung 1: Gewalt
»Every Saturday morning, first thing before breakfast, his parents held conferences with their children requiring them to answer two questions put to each of them: 1. What have you learned that is true (and how do you know)? 2. What problem do you have?«[1]
Toni Morrison, God help the Child
Damit lässt sich beginnen.
»Jeden Samstagmorgen …« Das Nachdenken über das, was wahr ist, ist eine stete Übung, ist nichts, was sich nur einmal fragen und erledigen ließe, das Nachdenken über das, was wahr ist, muss sich wiederholen, muss womöglich das, was einmal als wahr gelernt wurde, wieder betrachten, wieder vorlegen, wieder prüfen, wieder lernen. Jeden Samstagmorgen, wie in der Geschichte von Toni Morrison, oder in anderen Rhythmen, aber: Das Nachdenken über das, was wahr ist, ist unabgeschlossen.
»hielten seine Eltern Konferenzen …« Das Nachdenken über das, was wahr ist, ist dialogisch, es hilft, wenn es andere gibt, mit denen gemeinsam sich erörtern lässt, was wahr ist, und das bedeutet, dass nicht nur jede:r für sich eine eigene Antwort auf die Frage, was wahr ist, finden, sondern sie auch anderen gegenüber mit Gründen versehen muss.[2]
»Was hast Du gelernt, das wahr ist…« Was wahr ist, will gelernt sein, es ist nicht einfach da, es erschließt sich nicht von selbst, was wahr ist, will entdeckt, befragt, begriffen, verstanden sein. Was wahr ist, versteht sich nur, indem gelernt wird, warum es wahr ist, was dafür spricht, dass es wahr sein könnte. Und was dafür spricht, dass es wahr sein könnte, lässt sich nur verstehen, indem gefragt wird, was dagegen sprechen könnte. Das Nachdenken über das, was wahr ist, braucht den Zweifel, die Skepsis, braucht den Test der kritischen Befragung, ob die eigenen Annahmen, die eigenen Indizien, die eigenen Gründe wirklich taugen.
Wer Nachdenken will über das, was wahr ist, braucht also Demut.
Vielleicht ist mir das, vor allem anderen, das Existentiellste: Jenes Schreiben, das nicht erfinden, nicht bloß meinen, nicht einfach lügen will, jenes Erzählen, das sich nicht an der eigenen Phantasie bedienen, sondern mit der Wirklichkeit befassen will, das erzählerische Bezeugen dessen, was geschieht oder was geschehen ist, setzt Demut voraus.
*
Sie haben mich eingeladen, über faktuales Erzählen zu sprechen, so vermute ich, weil mein eigenes Schreiben sich sehr lange im Wendekreis des Elends von Tod und Zerstörung abspielte und weil die Zeugenschaft von Gewalt und Entrechtung, von den Ungeheuerlichkeiten, zu denen Menschen fähig sind, eine besondere Form des Erzählens bedeutet.
Und so möchte ich in der ersten Vorlesung beginnen mit der Frage nach Wahrheit und Gewalt.
Das »Material«, der Stoff, die Anblicke und Erfahrungen, die ich in den meisten meiner Texte zu bearbeiten versuche, sind in poetischer Hinsicht mehrfach beschränkend und beschränkt. Und aus diesem beschränkten Material ergibt sich, fast zwingend, eine Form, vielleicht sogar mehr noch eine Haltung als ein Genre, die sich einer bestimmten Vorstellung der Poetik widersetzt.
Zuallererst, weil es um faktuales Erzählen geht, also um jenes Erzählen, das fragen muss, ob etwas als wahr oder real begriffen werden kann. Nun ist der Begriff der Wahrheit philosophisch anspruchsvoll. Und die Frage, was als real und was als konstruiert gilt, kontrovers. Es lässt sich das faktuale Erzählen leichter definieren über das, was es nicht ist. »Non-Fiction«, keine Fiktion. Es ist jenes Erzählen, das sich nicht an der eigenen Phantasie bedient. Es verhandelt Material, dem etwas in der Wirklichkeit entspricht.[3] Es bezieht sich auf etwas, für das nach Belegen, Spuren, Indizien gesucht werden kann, die sich als möglichst robust und belastbar erweisen.
»Asking what truth is, is asking what it means for something to be accurate or get it right about how things are.«[4]
Das erlegt dem Schreiben gestalterische Beschränkungen auf: Die Lust am Erzählen darf nicht verleiten zum Imaginieren. Nicht die Kunst des kreativen Erfindens wird belohnt, sondern es braucht, bei jedem Wort, jedem Satz, den Anspruch, dass diese Aussagen »zutreffen«, dass eine Sache sich so verhält, wie behauptet.
Das verlangt nicht nur, sich zu disziplinieren, sondern es verlangt auch, skeptisch zu hinterfragen, welche sozialen oder kulturellen Erwartungen die eigene Wahrnehmung unbewusst filtern oder lenken könnten, zu hinterfragen, was lediglich als wahr gesehen oder gehört werden will, weil es vertraut wirkt, weil es anschlussfähig ist an das, was schon einmal erlebt, gesehen, gedacht wurde. Wir registrieren eher das, was uns bestätigt in unseren Erwartungen, als das, was ihnen widerspricht. Da lässt sich noch so gutgläubig das Mantra der distanzierten Beobachtung aufsagen. Eine undurchsichtige, verwirrende Konfiguration aus Prägungen, Vorannahmen, aber auch affektiven Kompetenzen erleichtert oder erschwert die Wahrnehmung.
Gerade in Krisenregionen verleitet mitunter das Mitgefühl mit einer verzweifelten Person oder Gruppe zu empathischem Glauben-Wollen oder die idiosynkratische Abneigung einer unsympathischen Person zum Nicht-Glauben-Wollen. Das geschieht oft unmerklich und intuitiv. Es braucht das Befragen dessen, was einem geschieht und was es mit einem macht. Das Wahrscheinliche wie das Unwahrscheinliche, das Einleuchtende wie das Kontraintuitive wollen gleichermaßen reflektiert werden. Das schließt wohlwollende Zugewandtheit zu den Gegenübern nicht aus, das schließt Anteilnahme nicht aus.
In Caravaggios berühmtem Gemälde »Der ungläubige Thomas« gibt es ein berührendes Detail. In der biblischen Erzählung will Thomas die Erscheinung, von der die anderen Jünger ihm berichten, nicht einfach für wahr nehmen. Er will den auferstandenen Herrn selbst sehen. Er will die Spuren der Kreuzigung am Körper Jesu sehen und berühren. »Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich’s nicht glauben« (Johannes 20, 24–29). In der Geschichte wird Thomas als negatives Beispiel des schwachen Glaubens angeführt (»Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!«). Der wahre Glaube soll der sein, der ohne Prüfung auskommt. Der wahre Glaube soll der sein, der fraglos daherkommt. Thomas wird ermahnt, weil er sich vergewissern muss, weil er selbst sehen und berühren will, weil er Gründe braucht, dem Gehörten zu trauen.
Auf dem Gemälde berührt Thomas nicht nur die offene Wunde, sondern steckt den Finger regelrecht hinein. Caravaggio lässt Thomas schlichter als die anderen Figuren aussehen, sein Hemd ist aufgerissen an einer Seite und dann ist da die schmutzige Hand. Während die Finger Jesu leuchtend sauber gemalt sind, ist bei Thomas noch etwas dunkler Dreck unter dem Nagel zu erkennen. Der ungläubige Thomas soll offensichtlich etwas gröber erscheinen. Was hier abwertend gemeint ist, die von Arbeit noch dreckigen Fingernägel, gefällt mir besonders gut. Das entspricht mir: Wer etwas verstehen will, wer etwas befragen will, muss sich schmutzig machen. Wer das erkennen will, was wahr ist, kann sich und auch andere nicht schonen.
Verstehen ist Arbeit. Immer wieder nachvollziehende, sich erweiternde, korrigierende, vertiefende Arbeit. Das braucht Zeit. Manchmal braucht es auch Mut. Den Mut, nicht schon einverstanden zu sein, nicht schon überzeugt zu sein, sich nicht anzupassen an das, was von einem erwartet wird, was man denken oder glauben sollte. Wer erzählen will, was wahr ist, muss wissen, dass es dafür später auch einzustehen gilt, mit der eigenen Person, dem eigenen Körper, dem eigenen Text.
Und um für meine Worte einstehen zu können, muss ich nachfragen dürfen. Wir erleben gerade, während ich diesen Text für die Drucklegung bearbeite, die furchtbare Gewalt im Nahen Osten. Und wir erleben, wie wechselseitige Vorwürfe, wechselseitiger Verdacht, wechselseitige Ressentiments das öffentliche Sprechen verzerren und belasten. Universalistische Empathie erscheint gerade manchen so schwer wie jenes Verstehen, das Mühe macht, das sich die Finger schmutzig macht, weil es genau sein will. Auch in diesem zutiefst verzweifelten Moment des Terrors und des Kriegs in Israel und Gaza braucht es das ruhige Befragen. Nachfragen und Verstehen-Wollen bedeutet keine Parteinahme. Nachfragen bedeutet keine Absage an Mitgefühl. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht – aus Anteilnahme mit der einen oder anderen Seite, aus Schmerz und Wut über das, was geschehen ist und weiter geschieht – den Anspruch ans Verstehen oder auch die Suche nach dem, was wahr ist, für überflüssig halten oder per se für voreingenommen. Sondern wir müssen immer wieder und immer noch mit dem Finger an den Rand der Wunde oder in sie hineingehen und fragen: »Ist das wahr?«
Nachzufragen bedeutet zum Beispiel, nach Indizien und Belegen zu suchen, die belastbar sind, die gesicherte Hinweise darauf geben können, von wem oder was am 17. Oktober der Parkplatz des christlichen »al-Mustašfā al-ahlī al-‘arabī«-Krankenhauses in Gaza getroffen wurde. Es gibt bislang verschiedene Untersuchungen dazu, wer die Verantwortung für diesen entsetzlichen Beschuss / die Explosion trägt, es gibt sich widersprechende Analysen, es gibt staatliche und nicht staatliche, journalistische und nicht journalistische Ermittlungen und Recherchen, manche korrigieren nicht nur andere, sondern auch eigene, frühere Einschätzungen. Es muss untersucht werden. Nachzufragen und zu recherchieren stellt sich nicht in den Dienst der einen oder der anderen Seite. Sondern es stellt sich in den Dienst der Wahrheitssuche. Damit wird nicht zuletzt den Opfern Respekt gezollt. Nach Indizien und Belegen zu suchen, ist eben keine Absage an Mitgefühl. Im Gegenteil: Diese Suche ist Anteilnahme.
Gewiss, im Krieg lassen sich manche Handlungen und Ereignisse nicht letztgültig aufklären. Allzu oft wird die Wahrheitssuche absichtsvoll erschwert, verzögert, gestört. Allzu oft führen alle Ermittlungen zu einem Urteil, das lediglich mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert. Dann bleibt einem nur, in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die Gründe und Indizien reichen, vernünftigen Zweifel auszuschließen. Mehr haben wir nicht.
*
Wer über Landschaften aus Tod und Zerstörung schreibt, wer davon erzählt, wie Gewalt Menschen versehrt, muss über den Begriff der Zeugenschaft nachdenken. Nicht über den religiösen Zeugen, der Wunder bestätigt (wie der skeptische Thomas), nicht die juristische Zeugin, die als unbeteiligte Dritte in einem Prozess vor Gericht als mutmaßlich neutrale Instanz aussagt. Was ist nun aber jene Form der Zeugenschaft, bei der es um extreme Erfahrung der Entrechtung und Gewalt geht?
Die erste Unterscheidung, die es voranzustellen gilt, ist die zwischen Betroffenen und Beobachtenden. Beide könnten sich als Zeug:innen verstehen, aber sie sind kategorial verschieden. Es gibt jene, die selber Opfer geworden sind, die Gewalt erfahren und durchlitten haben, deren Angehörige gequält und ermordet wurden, es gibt jene, die überlebt haben, die, wie versehrt auch immer, »weiter leben«. Es sind Innen-Zeug:innen, Menschen, die aus dem finsteren Kern der Vernichtung, der Lager und Gefängnisse, von Flucht und Zerstörung erzählen können. Es sind Zeug:innen, die »das Leid als Erfahrungswissen« kennen, wie Avishai Margalit das einmal genannt hat.[5]
Innen-Zeug:innen können natürlich auch diejenigen sein, die zu der Tätergemeinschaft gehörten. Die aus dem Inneren der Gewalt berichten können, weil sie dazugehörten, weil sie mitgemacht haben, weil sie sich im Recht wähnten, weil sie bereitwillig Befehle befolgten, weil sie Freude hatten am Vergewaltigen und Quälen wehrloser Menschen, weil sie als Kinder versklavt und in eine Miliz oder Armee genötigt wurden. Auch dies ist Zeugenschaft. Auch dies sind Innen-Zeug:innen. Allerdings sind ihre Erzählungen seltener.[6]
Diese Erzählungen brauchen – wie bei den Opfern, den Überlebenden – eine einordnende Kontextualisierung: Wo wird gesprochen? In was für einem Rahmen? In einem geschützten Raum, in einem öffentlichen Strafprozess? Sind es heimliche Aufzeichnungen und Abhörprotokolle, von denen jene, die da sprechen, nichts wissen? Wem dient die Zeugenschaft? Sozialer Gerechtigkeit oder persönlicher Rache? Wird Entlastung gesucht oder Verharmlosung der eigenen Verbrechen?
All das sind Fragen, die bedacht sein wollen.