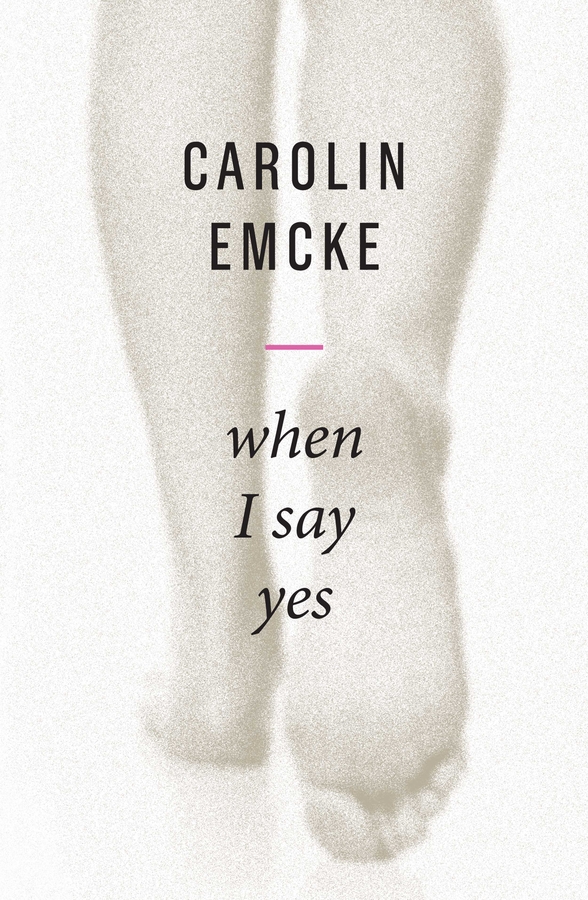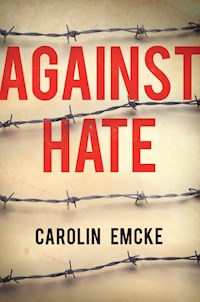9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
***Die vielfach ausgezeichneten Texte der renommierten Journalistin und Intellektuellen Carolin Emcke*** Wie lässt sich von Krieg und Gewalt erzählen? Gibt es dabei Grenzen des Verstehens? Schwellen des Sagbaren? Welche Bedingungen muss eine gerechte Gesellschaft schaffen, damit die Opfer von Gewalt über das Erlittene sprechen können? Diesen Fragen stellt sich Carolin Emcke mit ihren Essays in der Überzeugung, dass es nicht nur möglich, sondern nötig ist, vom Leid anderer zu erzählen – für die Opfer von Gewalt ebenso wie für die Gemeinschaft, in der wir leben wollen. Sie argumentiert gegen das »Unbeschreibliche« und für das Ethos der Empathie und des Erzählens. Für ihre scharfsinnigen und empathischen Texte erhielt sie zuletzt den Merck-Preis 2014, den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und die Auszeichnung »Journalistin des Jahres«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Carolin Emcke
Weil es sagbar ist
Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit. Essays
Inhalt
Weil es sagbar ist Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit
Widmung
Motti
»Weil es sagbar ist« Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit
Einleitung
1. Vielfältige Zeugen oder: Wer spricht zu uns?
2. Verstörung oder: »Ne pas chercher à comprendre«
3. Verwandlung in »ein Ding«
4. Verdopplung oder: Rhythmen, Rituale, Gegenstände und Ausbrüche
Rhythmus
Gewohnheiten, Rituale
Gegenstände
Ausbrüche
5. Verlassen oder: Die Zeit der Stille
6. Vertrauen oder: Erzählen trotz allem
Das Leid der Anderen
Anatomie der Folter
Die geordnete Welt von Buckingham Court, Virginia
Ohne klare Dienstanordnung
Liberaler Rassismus
Der verdoppelte Hass der modernen Islamfeindlichkeit
Heimat – Das Heimatland der Phantasie
Herausforderung Demokratie
Über das Reisen 1
Über das Reisen 2: Haiti erzählen
Über das Reisen 3: Von einer anderen Form des Reisens
Nachweise
Weil es sagbar istÜber Zeugenschaft und Gerechtigkeit
für Silvia
»Das Unsägliche geht, leise gesagt, übers Land«
Ingeborg Bachmann
»So, doch womit soll man anfangen,
mit welchen Worten?
Ganz gleich, fang mit den Worten an …«
Sascha Sokolow
»Weil es sagbar ist« Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit
Einleitung
»In den schrecklichen Jahren des Justizterrors unter Jeshow habe ich siebzehn Monate mit Schlangestehen in den Gefängnissen von Leningrad verbracht. Auf irgendeine Weise ›erkannte‹ mich einmal jemand. Da erwachte die hinter mir stehende Frau mit blauen Lippen, die meinen Namen natürlich niemals gehört hatte, aus jener Erstarrung, die uns allen eigen war, und flüsterte mir ins Ohr die Frage (dort sprachen alle im Flüsterton):
›Und Sie können dies beschreiben?‹
Und ich sagte:
›Ja.‹
Da glitt etwas wie ein Lächeln über das, was einmal ihr Gesicht gewesen war.«
Anna Achmatowa, 1. April 1957, Leningrad
Wieder und wieder bitten Menschen in Not, Eingeschlossene oder Ausgeschlossene, Opfer von Krieg oder Gewalt, ein Gegenüber darum, »davon« zu erzählen.
Warum? Was geschieht in einer solchen Szene?
»Und Sie können dies beschreiben?«, es klingt unsicher, ängstlich auch (»dort sprachen wir alle im Flüsterton«), aber vor allem karg: In einem Wort nur verbirgt sich der Schrecken über eine Erfahrung, die die Fähigkeit, sie zu beschreiben, unterwandert hat: »dies«.
Was ist »dies«? Genauer: Was ist es an diesem »dies«, das es zu einem sprachlichen Problem macht? Was daran ist unsäglich? Warum braucht die Frau »mit den blauen Lippen« eine andere, eine Fremde? Warum kann sie ihre Erlebnisse im Gefängnis nicht selbst beschreiben – so wie sie vermutlich den Besuch der Nachbarin, den ersten Schultag ihres Kindes oder das Einholen der letzten Ernte in Worte fassen kann? Ist etwas dem Unrecht oder Leid zu eigen, das sich nicht darstellen lässt? Lähmt Gewalt wie der Blick der Medusa jene, die sie erfahren?
Bestimmte Erlebnisse scheinen nicht erst die Möglichkeit zu begrenzen, sie zu beschreiben, sondern schon das Vermögen, sie zu erfassen. Extremes Unrecht und Gewalt stellen eine Anomalie dar, sie widersprechen jeder unversehrten Welterfahrung. Sie brechen ein in das Leben von Menschen, die nicht begreifen können, was ihnen da geschieht. Das Erlebnis scheint entkoppelt von allem, was vorher geschah, es reiht sich nicht ein in die eigene Geschichte, in das Verständnis dessen, was und wer man selbst einmal war und wer die anderen waren. Und das Erlebnis scheint entkoppelt von allem, was geschehen sollte, es passt nicht zu der eigenen moralischen Erwartung, zu dem, was und wer andere sein sollten. Der zivilisatorische Bruch eines Unrechts zieht sich durch verschiedene Schichten, erschüttert zweifach: die Beziehung des Opfers zu sich selbst und seine Beziehung zur Welt. Diese normative Störung vertieft den Riss zwischen innerhalb und außerhalb der Zone der Gewalt, zwischen Betroffenen und Außenstehenden.
So werden Leid und Gewalt zu einem sprachlichen Problem: Die Erlebnisse scheinen nicht beschreibbar, weil die Betroffenen sie selbst nicht verstehen, weil sie alles zu übersteigen drohen, was vorher als Erfahrung zählte. Zu harmlos wirken die üblichen Begriffe angesichts des Schreckens, zu flach. Um die Verwüstungen zu beschreiben, müssten Worte, eines nach dem anderen, an »dies« angelegt werden, wie Pailletten an einen Stoff, bis sie alles bedecken.[1]
Und die Erlebnisse erscheinen anderen nicht vermittelbar, weil sie die, die sie durchleiden, absondern von denen, die verschont wurden. Zu kurz scheint jede Erzählung angesichts des Schreckens, zu dünn, um die Last der ganzen Erfahrung tragen zu können.
»Und Sie können dies beschreiben?« Die Satzstellung suggeriert, die Fragende selbst habe sich schon daran versucht – und sei gescheitert. Als ob es einer speziellen Gabe bedürfte, Elend zu beschreiben. Schon als sie nur ahnt, dass eine Dichterin unter ihnen, den Opfern des Regimes, sein könnte, »erwachte« sie »aus jener Erstarrung«.
Was ist »jene Erstarrung«, aus der die Frau mit den blauen Lippen erst mit der Aussicht auf Zeugenschaft durch eine andere »erwacht«?
Verzweiflung und Schmerz legen sich wie eine Schale um die betroffene Person und schließen sie ein. So vergrößert sich der Radius der Gewalt, weitet sich aus und beschädigt. Erlittene Gewalt nistet sich ein, sie lagert sich ab, lässt »erstarren«, artikuliert sich in Gesten, Bewegungen, Wortfetzen oder im Schweigen.
Darin aber, in dem Schweigen der Opfer von extremem Unrecht und Gewalt, liegt die perfideste Kunst solcher Verbrechen: seine eigenen Spuren zu verwischen. Denn wenn sich strukturelle und physische Gewalt einschreibt in ihre Opfer, wenn sie die physische und psychische Integrität einer Person verletzt, wenn extremes Unrecht und Gewalt die erzählerische Kompetenz angreift, dann bleibt sie unbemerkt und wirkt fort.
»Da glitt etwas wie ein Lächeln über das, was einmal ihr Gesicht gewesen war«, schreibt Achmatowa und verweist so auf das Ethos der Zeugenschaft, auf die Kraft des Erzählens für eine andere.
»… das, was einmal ihr Gesicht gewesen war«? Die Frau bleibt in Achmatowas Text namenlos, sie ist anfangs nur eine weitere Person in einer der Schlangen im Gefängnis, »die hinter mir stehende Frau«, sie erscheint als eine von allen, sie hat jene Erstarrung, »die uns allen zu eigen war«, sie flüstert, »dort sprachen alle im Flüsterton«, sie scheint ihrer Individualität (ihres Gesichts) beraubt, das einzige Merkmal sind die »blauen Lippen«.
Erst als sie weiß, dass ihre Erlebnisse durch eine andere in Worte gefasst werden, erhält sie ein menschliches Antlitz zurück. Erst als sie weiß, dass eine andere zu sprechen, zu erzählen in der Lage ist, erhält sie ihre Subjektivität wieder zurück. Sie weiß: diese Erlebnisse werden nicht unbeschrieben bleiben. Mindestens eine von ihnen allen wird erzählen können, was geschah, mindestens eine von ihnen wird aus den Erlebnissen der Einzelnen eine Erfahrung machen, von der andere hören können und müssen.
Als ich, vor ungefähr zwanzig Jahren, diese Zeilen von Anna Achmatowa zum ersten Mal las, damals noch Studentin der Diskurs-Ethik in Frankfurt am Main, war es dieser Zusammenhang von Gewalt und Sprachlosigkeit, der mich umtrieb. Wenn Opfer von Gewalt in ihrer Fähigkeit beschädigt würden, das erfahrene Leid zu beschreiben, wenn es keinen oder keine gab, der oder die für sie spräche, dann wäre die Sprachlosigkeit nicht nur ein hermeneutisches oder psychologisches Problem, sondern auch eines der Gerechtigkeit. Wenn Opfer von Gewalt das, was ihnen widerfahren war, nicht erzählen könnten, würden Diktatoren und Folterer obsiegen.
Wann immer ich in der Folge diesen kleinen Text von Achmatowa las, konzentrierte ich mich auf den ersten und den letzten Teil: auf die Versehrung der Frau mit den blauen Lippen und ihre Frage »Und Sie können dies beschreiben?« Und auf ihre Wandlung aus der Erstarrung, dem Flüstern, hin zu »da glitt etwas wie ein Lächeln über das, was einmal ihr Gesicht gewesen war«, dieser Hoffnung, die sich in dem Lächeln andeutet. Dieses Lächeln, das mit der Würde zu tun hat, die es allein nicht gibt, die immer nur zu zweit aufscheint – hier in jenem Moment, in dem eine für eine andere zu erzählen verspricht.
Zwischen der Leserin von damals und der von heute liegen vierzehn Jahre, die ich reisend und zuhörend als Reporterin in Kriegs- und Krisengebieten verbracht habe. Nicht nur, aber auch. Vierzehn Jahre, in denen ich vor Frauen mit blauen Lippen saß und vor erstarrten Männern, in Flüchtlingslagern oder Verstecken, in Gefängnissen oder Wellblechhütten, am Wegesrand oder auf den Ladeflächen von Traktoranhängern, eingesperrt oder ausgesperrt, vertrieben oder verloren, und versuchte zu verstehen, was ihnen widerfahren war.
Sie konnten nicht einfach nur »dies« sagen. Denn ich war nicht eine von ihnen. Ich wusste nicht, was »dies« bedeutete. Ich war eine Fremde, zugereist in diese Landschaft aus Gewalt und Zerstörung. Ich teilte ihre Erlebnisse nicht. Sie mussten mir mitteilen, was sie durchgemacht hatten. So gut es ging. Manche schwiegen, manche stockten, manche erzählten rückwärts, manche verhaspelten sich, so schnell wollten sie ihre Geschichte mitteilen, manches kam nur bruchstückhaft heraus, nicht selten gab es erzählerische Schwellen, über die sie nicht hinwegkonnten oder -wollten, viele weinten, manche nicht, ihre Erzählungen klangen oft unwahrscheinlich, auch nicht eigentlich intelligibel, aber wieder und wieder, in zahllosen Begegnungen überall auf der Welt, tauchte, in allen Sprachen, diese eine Frage auf: »Schreibst du das auf?«, flehend oft, fordernd auch, manchmal begleitet von einem nachdrücklichen Blick in mein Notizbuch, auf die schwarzen Buchstaben, die doch, bitte, ihre Erfahrung dingfest machen sollten.
Erst mit der Zeit begann ich zu ahnen, dass sie mich nicht allein darum baten, weil sie das Unrecht und Leid, das ihnen widerfahren war, bestätigt und erinnert wissen wollten, sondern auch, weil sie als die Person bestätigt und vergewissert werden wollten, die sie waren, bevor ihnen all das widerfuhr: jemand, die es wert ist, wahrgenommen zu werden, als Individuum, als menschliches Subjekt.
All die Jahre blieb mir die Geschichte von Anna Achmatowa im Gedächtnis, all die Jahre begleitete mich die Vorstellung von dem »Lächeln, auf dem, was einmal ihr Gesicht gewesen war«, und sie schien sich zu spiegeln in den Gesprächen und Begegnungen im Kosovo, in Afghanistan, Irak, Haiti oder Israel.[2]
Aber erst heute, nach all diesen Reisen, zwanzig Jahre nach der ersten Lektüre von Anna Achmatowa, fällt mir der Teil der Geschichte auf, dem ich früher keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte: das »Ja«.
Vielleicht weil sie mir früher so selbstverständlich erschien, diese Antwort, vielleicht weil ich damals, bevor ich zu reisen begann, als Schülerin der Frankfurter Schule, mich meiner Fähigkeit so sicher wähnte, die eigene Perspektive wechseln, die existentiellen Erfahrungen eines anderen nicht nur nachvollziehen, sondern auch artikulieren zu können.
Gewiss, daran glaube ich noch immer: dass es das kategorial »Andere« nicht gibt, dass es sich einfühlen lässt in andere kulturelle, religiöse, ästhetische Lebenswelten, dass sich andere Praktiken und Überzeugungen als die eigenen verstehen lassen. Nicht nur das, sondern dass diese Empathie unverzichtbar ist, für uns alle.
Aber heute, mit dem Wissen auch um die ethische Last der Zeugenschaft, mit der Angst des erzählerischen (und damit auch moralischen) Versagens, nämlich eben »dies« nicht angemessen beschreiben zu können, erstaunt mich vor allem das selbstbewusste »Ja«.
Es mag seltsam altmodisch erscheinen, das doppelte Ansinnen dieses Essays: einerseits die Schwellen des Erzählbaren zu lokalisieren und andererseits ebendiese Schwellen als – gemeinsam – überschreitbare zu behaupten. Einerseits die Wirkungsmacht von Leid und Gewalt zu beschreiben, wie sie ihre Opfer verunsichern, verstören, versehren, wie sie die eigene Vorstellungskraft übersteigen, das Vertrauen in die Welt irritieren, die Fähigkeit, »dies zu beschreiben«. Andererseits aber die Möglichkeit des Mitteilens, des An-Vertrauens an jemand anderen, und die Aufgabe der »Re-Humanisierung durch Zeugenschaft« zu beleuchten.[3]
Darin artikulieren sich Zweifel an zwei geläufigen Überzeugungen: erstens der selbstbewussten Vorstellung von der Leichtigkeit der Augenzeugenschaft, sei es durch professionelle Beobachter oder durch Laien.
In digitalen, bildlastigen Zeiten, in denen es selbstverständlich scheint, das Erlebte festzuhalten und mitzuteilen, noch bevor es eigentlich erfahren ist, ob es sich um den Bürgerkrieg in Syrien, den arabischen Frühling oder den Börsengang von Facebook handelt, droht die selbstkritische Skepsis, ob es auch Erlebnisse gibt, die sich nicht gar so leicht erzählen lassen, zu verschwinden.
Und zweitens, gleichsam am gegenüberliegenden Pol, die Vorstellung vom »Unbeschreiblichen« oder »Unaussprechlichen«, dass also bestimmte Verbrechen, bestimmte Erfahrungen nicht beschrieben werden könnten und dürften. Abgesehen davon, dass dieser These vom »Unaussprechlichen« stets auch eine gewisse hermeneutische Faulheit innezuwohnen scheint, die gehörig irritiert, schreckt mich an dieser Position vor allem, dass Unrecht und Gewalt unfreiwillig sakralisiert werden.[4] Wenn sie »unbeschreiblich« sind, bleiben sie auch undurchdringlich. Wenn die Erfahrungen nicht, wie immer unvollkommen und gebrochen, beschrieben werden dürfen, wenn nicht einmal der Versuch unternommen wird, ihrer habhaft zu werden, bleiben auch die Opfer für immer damit allein.
Stattdessen versucht dieser Essay beides zu ergründen: die Zweifel an dem, was sich verstehen und beschreiben lässt (die Frage der Frau mit den blauen Lippen), und das Versprechen des »Ja« (die Antwort Anna Achmatowas), das Ethos des Erzählens füreinander. In Anlehnung an Georges Didi-Hubermann versucht dieser Essay ein Plädoyer für das Erzählen trotz allem.[5]
1. Vielfältige Zeugen oder: Wer spricht zu uns?
»Wer weiß schon was das heißt,
mit dem Wort am Leben hängen.«
Reiner Kunze
Welcher Zeuge?
Wer über Zeugenschaft schreibt, muss deutlich machen, welche Art von Zeugenschaft unter welcher Perspektive untersucht werden soll. Es kann um den religiösen Zeugen gehen, der das Wunder bestätigt, oder um die juristische Zeugin, die als unbeteiligte Dritte in einem Streitfall vor Gericht aussagt, oder um den moralischen Zeugen, der als Opfer vom eigenen Leid berichtet.[1]
Mich beschäftigen weniger die religiösen oder juristischen Kontroversen um Zeugenschaft. Die damit verbundenen Fragen nach der epistemischen Autorität der Zeugenschaft, also: ob Zweifel an den Aussagen von Zeuginnen und Zeugen angebracht wären und ob ihnen überhaupt der Anspruch auf Wahrheit innewohnt, werden hier vernachlässigt.[2] Die erkenntnistheoretischen Debatten um Zeugenschaft als Wissensvermittlung sind wichtig, und letztlich, wie Sibylle Schmidt sagt, auch nicht von der ethisch-politischen Frage der Zeugenschaft gänzlich zu entkoppeln.[3] Gleichwohl treten sie hier zurück.
Es ist ein sehr schmaler Ausschnitt aus den möglichen und nötigen Perspektiven auf Zeugenschaft, um den es hier gehen wird: Zeugenschaft von extremen Erfahrungen mit Entrechtung und Gewalt. Was bedeutet es, dass eine Zeugin das Erlebte nicht in Worte zu fassen weiß? Woran scheitert die Frau mit den blauen Lippen? Was ist es genau, worum sie eine andere bittet? Was birgt die Zeugenschaft für eine andere? Das Versprechen des Erinnerns? Der Empathie? Oder doch der Gerechtigkeit? Und was braucht es, damit Zeugenschaft gelingen kann?
Oft wird dieses Dilemma der Zeugenschaft von Grenzerfahrungen als ein psychisches Problem einer traumatisierten Person, des »Überlebens-Zeugen«, formuliert. Mit dem wachsenden Interesse an der Traumaforschung hat sich der Fokus von der verstörenden Gewalt hin zu dem traumatisierten Opfer der Gewalt verschoben. Als gestört gelten nun oftmals nicht mehr die Strukturen und Praktiken der Entrechtung und Gewalt, sondern die Menschen, die ihr unterworfen wurden.
Mir scheint in der ausschließlichen Betonung des beschädigten Opfers die Gefahr zu liegen, die moralisch-hermeneutische Aufgabe der Zeugenschaft zu ignorieren. Die Erfahrung extremer Entrechtung und Gewalt, die Einzelne durchlitten und überlebt haben, stellt auch eine Vielzahl an normativen Problemen einer sozialen Gemeinschaft dar, die einen solchen zivilisatorischen Bruch zugelassen hat. Wie von diesen Erfahrungen zu erzählen sei, ist – in dieser Perspektive – nicht nur eine subjektive Frage der Überlebenden, sondern eine kollektive Frage aller, die nachfragen und beobachten, aller, die zuhören oder weitererzählen wollen, es ist die kollektive Aufgabe einer Gemeinschaft, die sich an Gerechtigkeit orientiert. Und diese Aufgabe wächst, wenn die Generation der Zeuginnen und Zeugen langsam ausstirbt.
Wann wird jemand Zeuge?
Was müssen wir wissen, um sein oder ihr Zeugnis zu verstehen? Was müssen wir wissen, um ihrem Zeugnis zu glauben? Ist es eine Betroffene oder eine Beobachterin? Was müssen wir tun, dass sie zu uns sprechen kann? Ist es ein Augenzeuge oder ein Ohrenzeuge? Ist das Zeugnis Beschreibung oder Symptom? Belegt es ein Verbrechen selbst oder nur die Wunden, die es im Zeugen schlug?[4] Wird bezeugt oder bekannt? Ist jemand Zeuge aus Zufall oder aus Profession? Welche Demütigung wird öffentlich gemacht, wenn die eigene Misshandlung wiederzugeben ist? Welche Schuld wird eingestanden, wenn die eigenen Vergehen zu beschreiben sind? Welche Entwertung des Selbst wird wiedererlebt in der Beschreibung? Wer hat die Kraft dazu? Wer den Mut?
Wie viel Zeit ist vergangen seit dem Erlebten, das es zu beschreiben gilt? Geht es um einen einzelnen Akt oder eine längere Phase? Ist es die erstmalige Suche nach Worten für das Geschehen? Ist es ein kreisendes, zögerndes, ein zielloses Sprechen? Oder schon ein formelhaftes Zitieren eigener oder fremder Redeschablonen, ein gestanztes, lückenloses, selbstgewisses Wiederholen des bereits im kollektiven Gedächtnis Festgeschriebenen? Ist es eine mündliche Überlieferung? Ein beiläufiges Gespräch, achtlos dahingeworfen? Oder eine Aussage, ein protokollarischer Vorgang, etwas zum Archivieren Bestimmtes?
Wem oder was dient das Zeugnis? Sozialer Gerechtigkeit oder individueller Rache? Historischer Wahrheit oder persönlicher Wahrhaftigkeit? Wem wird etwas erzählt? Denen, die aus demselben Dorf stammen, denen man die reißende Strömung des Flusses oder den Klang der einschlagenden Gewehrsalven nicht beschreiben muss? Oder Fremden, die das schamhafte Zögern, das bejahende Kopfschütteln, die verspätete Wut nicht nachvollziehen können? Oder gar denen, die mitverantwortlich sind für die Gewalt? Die zugeschaut haben, aber nichts wissen wollten? Die das Verbrechen nicht als Verbrechen erkennen wollten? Oder wird den eigenen Kindern und Enkeln erzählt, die die lückenhafte Geschichte, den unverstandenen Albtraum, die übertragenen Ängste geerbt haben, ohne zu wissen, wie?
In welchem Rahmen findet das Sprechen statt? Zu Hause, in der vertrauten Umgebung, oder vor Gericht, in einem fremden, formalisierten Kontext? Wird entlang innerer oder äußerer Bilder erzählt? Ist das Tempo der Erzählung selbstbestimmt? Oder gibt es Fragen, wohlmeinende oder argwöhnische, die dem Zeugen narrative Pfade bahnen? Welche Motive drängen die Zeugin? Oder fühlt sie sich bedrängt? Wird aus innerer Not oder äußerem Zwang erzählt? Muss die Erzählung geborgen werden, sind die Begebenheiten versunken, verstreut, versteckt? Oder liegen die Erfahrungen parat, drängen hinaus, lassen sich nicht bändigen? Erfüllt der Bericht die Nächsten mit Stolz oder mit Scham? Wird ein anderer, ein Nächster in Mitleidenschaft gezogen, entblättert vor aller Augen? Welche Normen kanalisieren die Wahrnehmung, und welche steuern die Bereitschaft zu erzählen?
Wer spricht?
Unter den Überlebenden extremer Ausnahmesituationen gibt es manche, die sofort Zeugnis ablegen wollen, aus denen die schrecklichen Erlebnisse hervordrängen, die gleichsam »unter einem inneren Diktat« sprechen oder schreiben.[5] Primo Levi beginnt mit dem Erzählen des Grauens in einem Bericht für den russischen Kommandanten des Auffanglagers Kattowitz, direkt nach seiner Befreiung.[6] Und dann erzählt er weiter auf der Odyssee seiner Rückkehr nach Italien. Er »übt« das Sprechen, er erzählt probeweise, unsicher, ob sich diese Grenzerfahrungen überhaupt vermitteln lassen. Noch im Zug berichtet er Unbekannten von der so fremden Welt.[7] Und er testet dabei nicht zuletzt auch die Zuhörer. Können sie diese Erfahrung nachvollziehen? Wollen sie sie nachvollziehen? Glauben sie das Unglaubliche? Lassen sie es zu, dass der Schrecken, von dem er berichtet, in ihre Welt eindringt? Oder wehren sie sich gegen die ausgemergelte Erscheinung mit den tiefliegenden Augen und ihre Geschichte?[8] Gleich nach seiner Ankunft im Oktober 1945 beginnt er zu schreiben. Und er schreibt, »ohne es zu bemerken«, »ohne Plan«, »ohne Ordnung«. »Geschichte der Menschen ohne Namen« sollte der ursprüngliche Titel seiner Erinnerungen lauten. Ein Zeugnis für die, die kein Zeugnis mehr ablegen können.
Auch Jan Philipp Reemtsma schreibt kurz nach der Befreiung aus seiner Geiselhaft. Ein Schreiben scheinbar ohne Hast, aber motiviert durch Ekel und den Unwillen, die schreckliche Erfahrung der Entführung nur mit den Verbrechern teilen zu sollen. Es ist ein Erzählen, das nicht nur aus der Vereinzelung des einsamen Inhaftierten befreien soll, sondern auch aus der erzwungenen Intimität mit den verhassten Tätern. Anders als Levi kann Reemtsma nicht im Namen anderer schreiben. Nicht aus Zuneigung zu anderen Leidensgenossen, sondern aus Verachtung für diejenigen, die ihm das Leid angetan hatten, schreibt er.
Mit dem Schritt an die Öffentlichkeit unterwandert Reemtsma in gewisser Hinsicht die Bedürfnisse seiner Familie, die sich nach der dauernden Begleitung durch Polizeibeamte, Freunde, Anwälte und Psychologen vor allem die Rückkehr zu einem abgeschiedenen, ruhigen Leben wünscht. Beide, das Entführungsopfer selbst und seine Familie, sehnen sich nach einer verlorenen Normalität, aber sie können sie nicht auf dieselbe Art erlangen: Reemtsma muss sich mit seinem Zeugnis einer möglichst breiten Öffentlichkeit zuwenden, sich öffnen, weil er nur damit die Eigenschaften seiner gerade durchlittenen traumatischen Erfahrung konterkarieren kann. Isoliert, versteckt, angekettet, jeder selbständigen Handlungsfähigkeit benommen, hatte Reemtsma die erzwungene Intimität einer Geiselhaft ertragen müssen, um anschließend mit dem Text seine Subjektivität zurückzuerobern.[9]
Es gibt auch jene, die sprechen, aufgefordert durch allgegenwärtige Kameras und Mikrophone, direkt am Ort des Geschehens, und die dadurch mehr und mehr ihre eigene Subjektivität zu verlieren scheinen. Einerseits bei einzelnen historischen Ereignissen wie den Anschlägen vom 11. September, als den Überlebenden aus den Türmen des World Trade Center in der medialen Wiederaufbereitung mit dem wiederholten Erzählen die eigene Erfahrung eher entglitten ist. In der dauernden Repetition derselben Geschichte verselbständigen sich die Worte und die Erzählweise nach und nach, entkoppeln sich von jedem Nachdenken oder Wiedererleben beim Sprechen. So wird der Bericht mit der Zeit eine eigene fertige Form, die man einfach nur abrufen muss. Es entsteht keine Erzählung mehr, die den Erzählenden noch herausfordert, die noch veränderlich ist und den Sprecher wie den Zuhörer verändert. Die Geschichte wird gleichsam eingefroren, und alle Emotionen und Reflektionen erstarren mit.
Andererseits, bei einem fortdauernden Schrecken, kann sich die wieder- und weitererzählte Erfahrung auch verflüchtigen: Die Bewohner von Aleppo, die inmitten des Krieges den internationalen Reportern von ihrem Leid berichteten, konnten zwar sicher sein, dass ihre Erfahrungen in die Welt hinausgetragen würden, manchmal sogar in Echtzeit, aber ob sie erinnert würden, blieb offen. Im Tempo der Berichterstattung eines nicht enden wollenden Krieges schienen die einzelnen Eindrücke und Kommentare, ganz gleich wie dramatisch und entsetzlich, nichtig zu werden.
Wer schweigt?
Und schließlich gibt es jene Menschen, die nicht sprechen nach ihrer Befreiung. Die eine Erfahrung überleben, aber sie nicht übermitteln. Mit deren Schweigen auch die erduldeten Leiden in unzugänglichen Tiefen versinken. Wie soll über sie zu sprechen sein? Oder über das, was sie erlebt haben? Wer kann von sich behaupten, das Schweigen der anderen zutreffend zu erklären? Können sie nicht sprechen, wie so oft unterstellt wird? Weil die Ereignisse zu verstörend waren oder weil sie selbst zu verstört sind? Oder wollen sie vielleicht nicht sprechen? Weil sie sich oder uns schonen wollen?
Von allen diesen verschiedenen Zeuginnen und Zeugen und den Bedingungen, die ihnen das Erzählen ermöglichen (oder verunmöglichen), soll hier die Rede sein. Mich interessiert, wie sie selbst »dies« beschreiben, wie sie selbst das Verstörende an Grenzsituationen ausloten und ob es wirklich ihre erzählerische Kompetenz versehrt – oder nicht vielmehr dessen Voraussetzung: das Vertrauen in einen anderen.
2. Verstörung oder: »Ne pas chercher à comprendre«
»Seelenblind, hinter den Aschen,
im heilig-sinnlosen Wort,
kommt der Entreimte geschritten,
den Hirnmantel leicht um die Schultern.«
Paul Celan
Gewalt und Zerstörung überraschen. Sie verletzen nicht nur oder schmerzen, sie irritieren auch. Sie scheinen unbegreiflich – noch bevor sie als unbeschreiblich gelten. Extreme Grenzsituationen, ob ein Erdbeben, eine Geiselnahme oder Folter, stellen zunächst einmal, jenseits von dem Grad des Leids und der moralischen Verstörung, die sie auslösen, einen Verlust an kognitiver Sicherheit dar: Die vertraute Ordnung des Lebens zerfällt, wenn Menschen in einen Kontext geworfen werden, der all ihre lebensweltlichen und normativen Erwartungen zerschellen lässt.
Die Traumaforschung weist darauf hin, dass gerade diese Unfähigkeit, das in extremen Situationen Erlebte einzusortieren, den Kern des Traumas ausmacht. Es wäre demnach nicht der Inhalt der Erfahrung entscheidend für die traumatische Erschütterung, sondern die Entkopplung von früheren Erlebnissen, die es unmöglich macht, sie sinnvoll zu begreifen.[1] Nicht allein das, was die Opfer von extremem Unrecht und Gewalt erleben, lässt sie verstört zurück, sondern wie es das eigene Leben unterbricht, in ein Vorher und Nachher einteilt. Aus diesem Grund werden hier ganz verschiedene Stimmen (und Textgattungen) erörtert werden. Dabei geht es nicht um eine Vereinheitlichung des Leids oder eine Relativierung von Gewaltphänomenen, sondern um den Versuch, die Verstörungen, die sie in den Menschen auslösen, zu verstehen.
Über die fundamentale Irritation eines Individuums in extremen Situationen haben zahlreiche Überlebende der Shoah geschrieben. In ihren Erinnerungen und Berichten zeichnet sich die allererste Konfrontation mit dem Lager vor allem durch das Gefühl der Verwirrung aus, des Nicht-Verstehens. Es ist noch nicht einmal ein moralisches Entsetzen, dessen sie gewahr werden, kein empörtes Anklagen der Logik der Vernichtung. Sondern zunächst einmal ein Suchen nach irgendeiner Logik, wodurch sich das Undenkbare in Einklang bringen ließe mit dem, was vorher denkbar schien.
Charlotte Delbo, Mitglied der französischen Résistance, die 1943 nach Auschwitz deportiert wurde, beschreibt diese Desorientierung besonders eindrücklich: »In Fünferreihen schlagen sie die Straße der Ankunft ein. Es ist die Straße der Abfahrt, sie wissen es nicht. Das ist die Straße, die man nur einmal geht. Sie gehen in guter Ordnung – man soll ihnen nichts vorwerfen können. Sie kommen zu einem Haus und seufzen. Endlich sind sie angekommen. Und als die Frauen angeschrien werden, sie sollen sich ausziehen, ziehen sie zuerst die Kinder aus und geben acht, dass sie sie nicht ganz wach machen. Nach der tagelangen und nächtelangen Reise sind sie gereizt und quengelig, und sie fangen an, sich vor den Kindern auszuziehen, nun, anders geht es nicht, und als jede ein Handtuch bekommt, machen sie sich Gedanken, ob die Dusche auch warm sein wird, denn die Kinder könnten sich erkälten, und als die Männer, ebenfalls nackt, aus einer anderen Tür in den Duschraum treten, halten die Frauen die Kinder vor sich. Und vielleicht verstehen jetzt alle.«[2]
Bei Delbo bestätigt jede Geste, jeder Schritt noch die Ahnungslosigkeit der Deportierten. Sie belegen mit jeder Handlung im Lager ihre Unwissenheit. Noch immer funktionieren ihre Impulse und Intuitionen, als ob sie sich in einer vertrauten, sicheren Welt befänden: Sie strengen sich an, als ob sie in dieser Umgebung noch etwas richtig machen könnten, sie behalten die »Ordnung«, als könnten sie damit Eindruck hinterlassen. Ihre Rücksichtnahme ist noch geeicht auf minimale Störungen der Empfindsamkeit: Mit den Kindern sind sie »achtsam« nach der »langen Reise«, als sei das Härteste an Belastung schon vorbei. Sie fürchten eine »Erkältung«, als sei das die größte Gefahr für ihre Gesundheit. Überhaupt glauben sie sich noch in der Lage, ihrer Rolle als Mütter gerecht zu werden, sie glauben sich noch fähig, andere beschützen zu können. Ihre Schamhaftigkeit ist noch empfänglich für feinste Eindrücke. In ihrem gesamten Gebaren sind die Ankömmlinge noch konditioniert auf eine andere Welt. Sie verstehen einfach nicht, wo sie da gelandet sind, was für einer Ordnung des Terrors sie von nun an unterworfen sein werden.
»Wir sahen uns wortlos an«, so beschreibt Primo Levi die Ankunft am Bahnsteig von Auschwitz, wo er im Scheinwerferlicht zwei Trupps sonderbarer Gestalten sieht: schattenhafte Wesen in langen Kitteln, verdreckt und zerrissen, mit unsicherem Gang und ängstlicher Körpersprache. »Alles war unbegreiflich und irrsinnig.«[3]