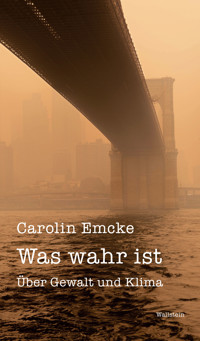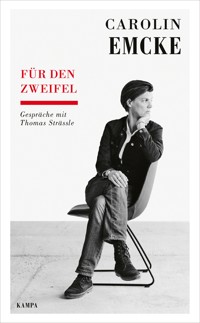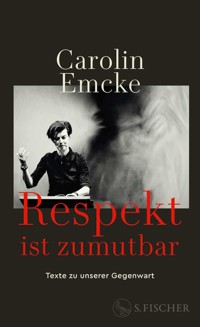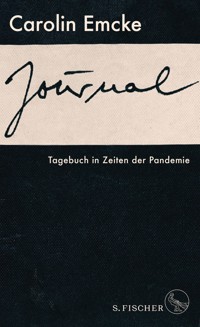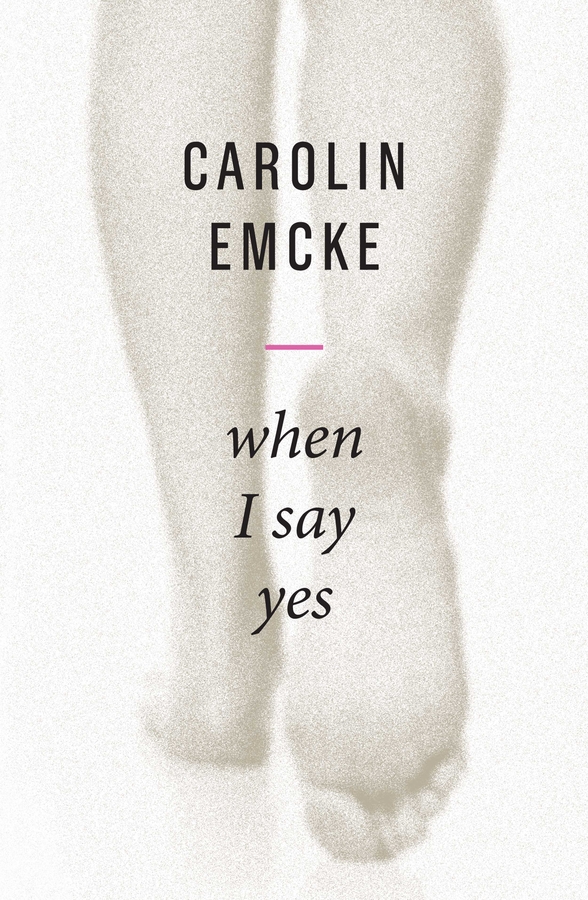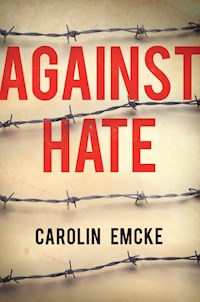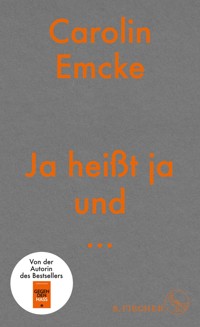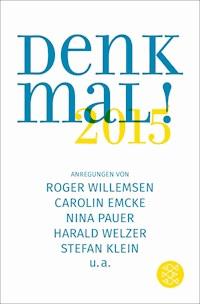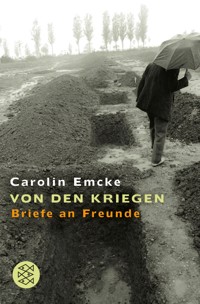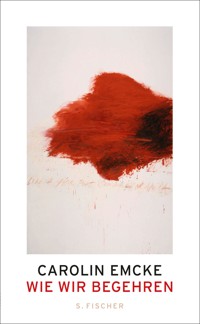
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer sind wir? Wer können wir sein, wer wollen wir sein, wenn wir anders sind als die Norm ? Entdecken wir das Begehren oder entdeckt das Begehren uns? Wie frei sind wir, unser Begehren zu leben? Hat es nur eine Form oder ändert es sich, wird tiefer, zarter, radikaler? In ihrem so persönlichen wie analytischen Text schildert Carolin Emcke das Suchen und die allmähliche Entdeckung des eigenen, etwas anderen Begehrens. Sie erzählt von einem homosexuellen Coming of Age, von einer Jugend in den 1980er Jahren, in der über Sexualität nicht gesprochen wurde. Sie buchstabiert die vielen Dialekte des Begehrens aus, beschreibt die Lust der Erfüllung, aber auch die Tragik, die gesellschaftliche Ausgrenzung dessen, der sein Begehren nicht artikulieren kann. Eine atemberaubend ehrliche Erzählung, die gleichermaßen intim wie politisch ist. »Ein eindrückliches Buch über Liebe und Freiheit.« Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung »Carolin Emcke (…) arbeitet mit einer gedanklichen und sprachlichen Präzision, die ihresgleichen sucht, und einem intellektuellen Mut, der bewundernswert ist.« Heribert Prantl
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Carolin Emcke
Wie wir begehren
Über dieses Buch
Carolin Emcke erzählt die Geschichte einer Jugend, ihrer Jugend, in den siebziger und achtziger Jahren. Über Sexualität wurde nicht gesprochen, es gab keinen Raum für Begriffe wie »Lust« oder »Begehren«, ganz zu schweigen von Arten der Lust, die sich von der Norm unterscheiden.
Sie beschreibt die Spiele und Rituale, die Mechanismen der Ausgrenzung und Eingrenzung, die Lügen und Sehnsüchte, aus denen diese Jugend sich formte. Sie erzählt von der Not und Verzweiflung eines Mitschülers, der an den Rand gedrängt wird, ohne Grund, und der am Ende zerbricht, sie erzählt von ihrer eigenen Suche nach einer Form, in der das Anderssein sich artikulieren darf, und von dem existentiellen Glück, diese Sprache des Begehrens schließlich gefunden zu haben.
Sie recherchiert, wie in den achtziger Jahren über Homosexualität von Jugendlichen, gedacht, geschrieben, geurteilt wurde, sei es in der »Bravo«, am Bundesgerichtshof oder im Verteidigungsministerium und sie beschreibt, wie Tabus und Ressentiments noch heute ihre Wirkungsmacht behalten.
Carolin Emcke gelingt das Kunststück, anhand der Geschichten, die sie erzählt, eine ganze Theorie des Begehrens zu entwickeln, ohne den Zauber, das Zarte und zugleich Radikale, das ihm eigen ist, zu nehmen. Zugleich ist ihr Buch ein Text von großer politischer Kraft, in dem es um Ausgrenzung und Gewalt wie um das Ringen um Individualität im Zeitalter des Kollektiven geht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Carolin Emcke, geboren 1967, studierte Philosophie in London, Frankfurt/Main und Harvard. Sie promovierte über den Begriff »kollektiver Identitäten«. Von 1998 bis 2013 bereiste Carolin Emcke weltweit Krisenregionen und berichtete darüber. 2003/2004 war sie als Visiting Lecturer für Politische Theorie an der Yale University. Sie ist freie Publizistin und engagiert sich immer wieder mit künstlerischen Projekten und Interventionen, u.a. die Thementage „Krieg erzählen“ am Haus der Kulturen der Welt. Seit über zehn Jahren organisiert und moderiert Carolin Emcke die monatliche Diskussionsreihe »Streitraum« an der Schaubühne Berlin. Für ihr Schaffen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Theodor-Wolff-Preis, dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus, dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und dem Merck-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 2016 erhält sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Bei S. Fischer erschienen ›Von den Kriegen. Briefe an Freunde‹, ›Stumme Gewalt. Nachdenken über die RAF‹, ›Wie wir begehren‹ und ›Weil es sagbar ist: Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit‹. Im Oktober 2016 erscheint ihr neues Buch ›Gegen den Hass‹.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2012 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: Cy Twombly, Fifty Days at Iliam: The Fire that Consumes All before It, 1978, Philadelphia Museum of Art © 2011 Cy Twombly Foundation.
ISBN 978-3-10-401083-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Wie wir begehren
Wie wir begehren [Fortsetzung]
»Il y a autant de différence de nous à nous-même que de nous à autrui.«
Montaigne
»Die Saite des Schweigens gespannt auf die Welle von Blut …«
Ingeborg Bachmann
»So quälte ich mich mit der Welt,
dass ich begann, mir Sprichwörter auszudenken.
Lange Wahrheiten gibt’s und kurze.
Und folgt die Strafe nicht auf dem Fuß,
musst Du die Schuld ableben durchs Leben.«
Jan Skácel
Vielleicht ist das der Grund für diese Geschichte. Vielleicht muss sie so beginnen: mit der Schuld, einer Schuld, die sich nicht abtragen, sondern nur ableben lässt durchs Leben. Vielleicht ist es eine Illusion, dass sich Schuld abbauen ließe, als sei sie aus Erz oder Kohle, als ließen sich Brocken herausschlagen, kleine Klumpen, die fortgetragen, zerkrümelt, aufgelöst werden könnten. Vielleicht gehört das Erzählen so zum Leben wie das Schweigen zum Tod. Und vielleicht lässt sich nur so, erzählend, die lange Wahrheit dieser Geschichte begreifen.
Warum gerade wir ausgewählt wurden, weiß ich nicht. Die anderen Schüler, vor allem die Jungen, standen um uns herum und stichelten. Vielleicht waren es außer mir auch nur Jungen. Das wäre mir nicht aufgefallen. Es war eine Zeit, in der die Unterschiede noch nicht besonders relevant waren. Oder zumindest für mich nicht. Sie lauerten wie ein Rudel Wölfe, im unförmigen Kreis, ohne klare Ordnung. Linkisch und bissig wagte sich mal einer, mal ein anderer vor und schubste uns, Daniel oder mich, mit einem Schlag gegen die Schulter: »Na los!«
Wir standen am Rand des lehmigen Fussballfeldes, das eigentlich kein richtiges Fussballfeld war, sondern nur eine größere Lichtung im waldigen Hügel, gleich neben dem Schulgebäude. Heutzutage gibt es das vermutlich gar nicht mehr, einen nichtasphaltierten Hof. Damals war der Platz etwas verwildert, neben dem eigentlichen Hof mit den Bänken und Geländern und dem ewig zugigen, grauen Toilettenhäuschen. Es gab zwei Tore ohne Netze und ein Feld ohne Linien.
»Na los!«, sie waren erschrocken über den eigenen Mut, ängstlich vor der eigenen Feigheit, immer darauf bedacht, was die anderen von ihnen denken könnten. »Na los, prügelt euch.« Sie schnappten und wichen wieder zurück, jeder beobachtete jeden, die schmächtigen Körper etwas gebeugt, den Kopf tief, etwas zu aggressiv, etwas zu devot, immer auf der Hut, ob sich die Gewalt, die sie gerade auf uns lenken wollten, im nächsten Moment gegen sie selbst kehren könnte, eine Meute aus Kindern.
Es war der erste Schultag am Gymnasium. Der Tag hatte in der Turnhalle begonnen. Warum die Begrüßungszeremonie der Neuankömmlinge und die Vorstellung der Klassenlehrer für die drei fünften Klassen nicht in der Aula stattfanden, weiß ich nicht. Wir saßen auf hölzernen Bänken neben unseren Müttern oder Vätern und warteten darauf, welcher Klasse wir zugeordnet würden. Was wir von den Lehrern zu erwarten hatten, ob sie beliebt oder unbeliebt waren, konnten wir heraushören am klatschenden Kommentar der älteren Schüler, die der Veranstaltung aus Langeweile oder Gehässigkeit beiwohnten. Wenn ich es heute recht bedenke, muss es sich für die drei Lehrer, die da am Ende der Halle unter dem Basketball-Korb standen, entsetzlich angefühlt haben. Wie ihre Namen aufgerufen wurden, sie mit lauten Pfiffen oder allzu leisem Applaus bedacht wurden und sie so, schon im Moment der Ernennung zum Klassenlehrer, vor ihren neuen Schülern jede Autorität verloren. Vermutlich waren sie deswegen da, die älteren Schüler, weil dies der einzige Moment im Jahr war, an dem sie sich rächen konnten. Ich weiß noch, dass sie mir ein wenig leidtaten, die Lehrer, die sich da ausliefern mussten. Und ich weiß noch, dass mir diese Atmosphäre des kollektiven Urteils, das ich als solches damals gar nicht hätte benennen können, unheimlich war.
Wir verfolgten nur die alphabetischen Namenslisten, warteten unseren Buchstaben ab, hörten unseren Namen und bangten dann, ob auch all die vertrauten Freunde aus der Grundschule genannt würden. Ich hatte Glück. Meine liebsten Spielgefährten aus den vorangegangenen Jahren wurden alle derselben Klasse zugeteilt. Wer die anderen Unbekannten waren, die folgten, war gleichgültig. Entscheidend war nur, nicht allein in diese neue Welt gestoßen zu werden. Dann löste die Versammlung sich auf, die Eltern verabschiedeten sich, und wir gingen in der gerade neusortierten Gruppe hinter der neuen Klassenlehrerin die Treppen zum Gebäude der fünften und sechsten Klassen hinunter. Wir waren etwas abseits, am Fuß des Hügels, in einer eigenen versunkenen Welt, nicht mehr ganz Grundschule, aber auch noch nicht Gymnasium.
Und da standen wir nun. An der Ecke von diesem Fußballfeld. Gleich neben dem mit Brennnesseln bewachsenen Abhang. In einer der ersten Pausen. Sie muss eine kurze Pause gewesen sein. Die lange Pause wurde immer als wirkliche Pause, also zum Fußballspielen genutzt. Die kurzen taugten für nichts Halbes und nichts Ganzes. Da unten, bei den Unterstufengebäuden, gab es keinen Bäcker, keine Eisdiele, nichts, wohin man eben mal hätte verschwinden können. Für eine Raucherecke, wie es sie später geben sollte, waren wir zu jung oder zu wenig verwegen. Vielleicht hatten wir auch einfach zu wenig Phantasie, wie sich die Lust an der Grenzüberschreitung ausdrücken sollte.
Wir wollten nicht, weder Daniel noch ich. Etwas verstohlen schauten wir uns an. Wir kannten uns ja gar nicht. Von welcher Grundschule Daniel auf dieses Gymnasium gewechselt war, wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Er hatte blonde Haare und weit auseinanderstehende grüne Augen. Er war ein bisschen größer als ich, aber nicht viel. Seine Schultern waren eckig. Die Arme etwas zu lang. Aber auch das ist mir damals bestimmt nicht aufgefallen. Schließlich war bei jedem von uns irgendetwas zu lang oder zu kurz, war jeder von uns irgendwie leicht daneben, und sei es nur, weil wir dachten, die anderen könnten das von uns denken. Daniel hatte eine angenehme Erscheinung. Es gab keinen Grund, warum er ausgewählt wurde in diesem Moment am ersten Schultag. Es war wahllos. Es traf einfach uns.
Ich wusste nicht richtig, was das sollte, warum wir uns denn schlagen sollten. Daniel hatte mir nichts getan. Es gab kein Motiv. Ich hatte mich schon oft gerauft. Schon an meinem ersten Tag im Kindergarten. An meinem ersten Tag in der Grundschule auch. Grundsätzlich sprach also nichts gegen eine Prügelei am ersten Tag auf dem Gymnasium. Ich habe einen älteren Bruder. Raufen gehörte zum gewöhnlichen Repertoire des Überlebens. Aber ich musste wütend sein über etwas, das der andere getan hatte, was ich gemein fand. Einfach so, ohne angegriffen worden zu sein, auf jemanden loszugehen, das konnte ich nicht. Vielleicht verstand ich auch einfach das Spiel nicht: diesen Versuch einer amorphen Gruppe, in sich eine Hierarchie zu schaffen, diesen Versuch jedes einzelnen Schülers, nur ja nicht selbst im Kreis zu landen, nur nicht selbst getestet zu werden, nur nicht selbst, schon am ersten Tag, ausgegrenzt zu werden. Nur deswegen formten sie diesen Kreis, nur deswegen trauten sie sich so viel zu, weil sie sich nichts zutrauten, nur deswegen brauchten sie diese Situationen, in denen andere als Schwächlinge markiert werden konnten.
Als Schwäche konnte allerdings beides gelten: sich zu prügeln wie sich nicht zu prügeln. Wer sich von den anderen aufstacheln ließ, traute sich vielleicht nicht zu, sich gegen die Gruppe zu wehren. Wer sich nicht aufstacheln ließ, traute sich vielleicht nicht zu, gegen einen anderen zu gewinnen. Eine psychische Niederlage das eine, eine physische das andere. Ich gebe zu, dass mich die Aussicht zu verlieren als erfahrene kleine Schwester keineswegs beunruhigte. Das war ich gewohnt. Jede Kraftprobe, jeden athletischen Wettkampf, jede Prügelei verlor ich. Meine ganze Kindheit hindurch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die einzelnen Wettkämpfe als besondere Niederlagen empfand, auch wenn sie nur aus einer Aneinanderreihung von Niederlagen bestanden. Ob es mich aus athletischem Ehrgeiz reizte, es zu versuchen, ob es aus Stolz darum ging, gegenzuhalten, das kann ich gar nicht sagen. Vermutlich war ich bloß stur.
Wenn ich überlege, warum ich in dieser Situation, damals, am ersten Schultag, keine Angst vor dem Verlieren hatte, kann ich nur ahnen, dass es etwas damit zu tun haben muss, dass ich ja ohnehin immer verlor. Ich glaube, darüber dachte ich nicht einmal nach. Vielleicht war das, die Angstfreiheit, der beste Schutz.
Die Szene verging, wie sie entstanden war, plötzlich und wortlos. Weil das Pausenzeichen ertönt oder irgendein Lehrer in der Nähe aufgetaucht war. Alle stoben auseinander. Die Anspannung war verflogen, wie sie entstanden war. Die meisten erinnerten schon am nächsten Tag nicht mehr, dass sie uns hatten aufstacheln wollen. Das war meine erste Begegnung mit ihm.
Warum er sich das Leben genommen hat, weiß ich nicht. Ich habe niemanden dazu befragt. Niemanden außer mir selbst. Gewundert habe ich mich nicht. Dabei ist das sonst so üblich. Jemand stirbt durch eigene Hand, und wir tun überrascht. Natürlich war ich erschrocken, als ich Jahre später, Jahre nach diesem ersten Schultag am Gymnasium und einige Zeit, nachdem Daniel unsere Schule verlassen hatte, hörte: »Daniel ist tot.« Da war er noch nicht einmal achtzehn. »Daniel ist tot.« Das klang schäbig. In dem Moment, in dem ich den Satz hörte, ekelte er mich auch schon an. Es war niemals nur ein erschrockener Ton, der angeschlagen wurde mit diesem Satz, immer lag unter der Betroffenheit noch etwas anderes. Erst dachte ich, das Intervall, das ich hörte, wenn über diesen Selbstmord gesprochen wurde, sei die gemeine Lust am Skandal, die mit angestimmt wurde, die voyeuristische Freude an dem Eklat, der dazu dient, im Niedergang des anderen vor allem das eigene Überleben zu feiern. Aber es war noch etwas anderes. »Daniel ist tot«, das war auch eine Art Bestätigung. Je entsetzter die Stimmen taten, die den Freitod kommentierten, desto zufriedener schienen sie zu sein. Als sei der Tod von Daniel ein später Triumph, als sei die Hetzjagd zu einem erfolgreichen Ende gekommen, der Schwächling doch noch ausgemacht.
Natürlich habe auch ich mich gefragt: Warum hat er sich das Leben genommen? Ich wollte wissen, gab es einen Brief, eine Ankündigung, eine Erklärung, etwas, das er hinterlassen hat. Aber ich habe mich das nicht gefragt, weil mir keine Gründe eingefallen wären. Ich habe mich das gefragt, weil mir Gründe einfielen. Weil ich wissen wollte, ob die Gründe, die mir einfielen, auch seine waren. Weil ich wissen wollte, wie viel sein Tod mit uns zu tun hatte, mit all diesen Kreisen, die gezogen werden, die einschließen und ausschließen und die sich nicht immer so schnell wieder auflösen wie jener erste Kreis, damals, am ersten Schultag. Was war an ihm, das ihn nicht überleben ließ? War da überhaupt etwas an ihm? Was fehlte ihm? Gab es eine Schwelle, die er nicht überschreiten konnte, eine, die ihn bewahrt hätte? Gab es eine Schwelle, die wir ihm verstellt hatten? Hatte sein Tod überhaupt mit ihm zu tun? Oder mit uns? Mit der Welt um ihn herum? Warum er und nicht ich? Hätte es nicht genauso viele Gründe für mich geben können? Warum war ich aus dieser Zeit hervorgegangen? Ich war mit ihm im Kreis gewesen. Hätte es nicht genauso für mich gelten können? Ist das nicht willkürlich, wen es trifft? Wer aus dieser Zeit der Kindheit, die keine mehr ist, wer aus diesen Jahren der Unbestimmtheit hervorgeht, ist das vorhersehbar?
War der Grund, warum ich noch Jahre nach dem Abitur gebraucht habe, um mein Begehren zu entdecken, derselbe wie der, warum er sich das Leben genommen hat? War die Sehnsucht, die wir nicht verstehen, nicht entdecken, nicht leben konnten in dieser Zeit, dieselbe?
Die Liste war ordentlich. Der Winkel, an dem sich die beiden Achsen kreuzten, war mit einem Geodreieck gezogen worden. Die Linien alle schnurgerade. Als sei es eine Hausaufgabe gewesen, die uns einer der Lehrer aufgetragen hätte. Als kontrollierten uns die Lehrer noch in all den Bereichen, in denen sie uns nicht kontrollierten. Feinsäuberlich waren die Namen alphabetisch in die Tabelle geschrieben worden. Es gab zwei Listen. Auf der Liste der Jungen verliefen die Namen der Jungen von oben nach unten, die der Mädchen von links nach rechts, die Liste der Mädchen war genau anders herum.
Die Welt teilte sich. Sie spaltete sich auf in Geschlechter, schon bevor die Körper sich dessen bewusst wurden, bevor sie eigentlich noch recht als Geschlechter entdeckt waren. Gewiss hatte es das auch vorher schon gegeben, diesen Riss in der Welt, der sich auftat als ein Naturgesetz ohne jede Natürlichkeit. Aber eigentlich spielte es vorher keine besondere Rolle. Es gab Jungen und Mädchen, Brüder und Schwestern. Natürlich hatten wir uns in unserer Verschiedenheit betrachtet und einander gezeigt. Ich hatte im Alter von gerade mal vier Jahren immerhin einen geliebten Schlumpf hergegeben, um den Nachbarsjungen zu bestechen, mir zu zeigen, wie er seine Vorhaut verschieben konnte. Ich hatte zwar einen Bruder, bei dem ich das auch hätte sehen können. Aber das wäre ganz gewiss niemals so billig zu haben gewesen. Natürlich gab es das schon, die feinen Unterschiede, aber sie bedeuteten bislang nur selten einen Unterschied.
Es gab getrennte Umkleidekabinen beim Sport. Da tauchten wir dann vorübergehend ab. In diese düsteren, etwas moderigen Räume, die die Geschlechtlichkeit von Anbeginn mit Dunkelheit und Schweiß assoziieren lassen sollte. Wir verschwanden aus dem gemeinsamen Leben, halbierten uns gleichsam für diesen kurzen Moment der Nacktheit, um uns direkt danach, angezogen, wieder zusammenzufügen. Am Ende, nach der Sportstunde, gingen wir wieder zurück in die Kabinen und schlüpften in unsere Anziehsachen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die verkalkten Duschen, die es gab, jemals benutzt hätten. Der Stundenplan sah auch gar nicht vor, dass Schüler ihre nassgeschwitzten Körper duschen sollten. Wir stoppten mit dem Sport kurz vor der Pause, und dann begann auch gleich die nächste Stunde im anderen Gebäude. Für langes Duschen – von Schminken war ohnehin noch nicht die Rede – blieb keine Zeit. Die Körperlichkeit von Jugendlichen oder das Waschen des jugendlichen Körpers kam den Lehrern oder der Schulleitung gar nicht in den Sinn. Einerseits hielten sie uns für zu jung, als dass wir überhaupt sinnlich genug sein könnten, um auf einen frischen und sauberen Körper Wert legen zu können. Andererseits hielten sie uns aber für zu alt, als dass wir uns noch hätten voreinander entblößen dürfen. Die Gemeinsamkeit, die Einheitlichkeit sollte es nicht geben. Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität waren gesetzt, noch bevor Geschlechtlichkeit oder Sexualität recht herangereift waren.
Mehr als fünfzehn Jahre später lernte ich im Urlaub zum ersten Mal einen Hermaphroditen kennen. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es das gab. Ich kannte nicht einmal das Wort. Zwitter waren göttliche Figuren aus der griechischen Mythologie, ineinandergeschobene Wesen. Etwas anderes kannte ich nicht. Ich hatte mich gerade von meinem Freund getrennt und war mit einer Freundin von der Universität in den Urlaub gefahren. Wir waren bei Freunden zu Gast und betranken uns den Nachmittag über und spielten Trivial Pursuit.
Irgendwann tauchte ein befreundetes Paar der Gastgeber auf. Ein italienischer Fotograf und seine Freundin Nicola. Sie war jung und hübsch, schmal und elegant, und sie spielte vergnügt mit bei diesem absurden Spiel. Es war nichts Besonderes an ihr, außer, dass sie in auffälliger Weise die simpelsten Fragen nicht beantworten konnte. Nun passiert das bei Trivial Pursuit jedem gelegentlich. Die Beliebtheit des Spiels erklärt sich schließlich nicht dadurch, dass es klassische Bildung belohnt. Auch noch so enzyklopädisch Gebildete scheitern an der Frage, wie die Schwiegermutter von Fred Feuerstein heißt oder wer auf der Bahn neben Jürgen Hingsen lief, als der disqualifiziert wurde. Insofern war es nichts Ungewöhnliches, dass jemand passen musste. Aber Nicola schien Fragen nicht nur nicht beantworten zu können, sie schien Fragen nicht einmal einem bestimmten Kontext zuordnen zu können. Es war nicht irritierend, was sie nicht wusste, sondern dass es gar keine Assoziationsfelder zu geben schien, an die sie einzelne Themen hätte koppeln können, keine gestuften Schichten des Wissens, in denen sich hätte suchen lassen. Nicola hatte anscheinend Blüten von Wissen, wie vereinzelt auf einer Wasseroberfläche, hin und her gespült, vom Wind herangetragen, ohne Anbindung.
Sie war keineswegs unglücklich über den Spielverlauf, sie schien noch nicht einmal zu bemerken, dass es unterschiedliche Arten von Fragen gab, leichtere und schwerere, Fragen, die Peripherien des Wissens erkundeten, und solche, die aus den geläufigeren Gebieten stammten. Sie lachte über ihre Ahnungslosigkeit und über unsere, sie zog Karte um Karte mit der gleichen Hoffnung, nun eine Frage erfolgreich beantworten zu können. Sie fischte wie mit einem großmaschigen Netz im Wasser und freute sich über jede Blüte, die sich darin verfing. Ihre Sorglosigkeit vor der eigenen Ignoranz war ansteckend und befreiend, und so lachten wir, tranken und spielten und wunderten uns nur ein wenig über diese charmante Frau.
Etwas später gingen einige zum Schwimmen zum Strand. Ich blieb im Haus und begann zu kochen. Ich wusch Zucchini und Auberginen, halbierte sie der Länge nach, dann pellte ich Knoblauchzehen langsam aus ihrer Haut und schnitt sie in dünne Scheibchen, ich weiß nicht, warum ich mich daran noch so genau erinnere, ich ging auf die Terrasse, um etwas Oregano aus dem Gewürzkasten zu pflücken, als meine Freundin plötzlich neben mir stand und sagte: »Etwas stimmt nicht.« Sie hatte nicht gesagt: »Etwas stimmt nicht mit ihr« – und doch war sofort klar, über wen sie sprach. Beim Schwimmen war sichtbar geworden, dass die junge, schöne Frau einen männlichen Unterleib hatte. Keiner sprach, worüber alle den Rest des Abends nachdachten. Bis Nicola und ihr Freund wieder gegangen waren. Dann erzählten uns unsere Gastgeber, was sie wussten von Nicola.
Nicola hatte einen Körper, der sich keinem eindeutigen Geschlecht zuordnen ließ. Sie war nicht transsexuell, sie hatte keine operative Geschlechtsumwandlung hinter sich, sondern sie war intersexuell. Sie war nicht in einen Körper hineingeboren, dessen eindeutiges Geschlecht ihr fremd war. Sondern sie war in einen Körper hineingeboren, der zwei Geschlechter entwickelt hatte und gleichsam unentschieden geblieben war. Ihre Pubertät, in der sich die Brüste gleichzeitig zu ihrem Penis ausbildeten, war eine Geschichte der fortlaufenden Ausgrenzung, weil die Ambivalenz ihres Geschlechts vor allem als soziale Bedrohung wahrgenommen worden war. Eine der qualvollsten Erfahrungen ihrer Schulzeit waren ausgerechnet die Umkleidekabinen beim Schulsport gewesen: Orte der Normierung, in die sie nicht eingelassen wurde, weil sie Eindeutigkeit verlangten. Sie hatte irgendwann die Schule aufgegeben. Nicht, weil sie die Anforderungen nicht hätte erfüllen können oder nicht gerne lernen wollte, sondern weil sie nicht passte in diese aufgeteilte Welt. Das war der Grund für ihre Wissenslücken.
Nicola führte vor, was für uns andere genauso galt: die Verordnung der Geschlechtlichkeit, die uns selbstverständlich erscheinen soll und die wir als Unhinterfragbares annehmen, weil es uns, in unseren Körpern, leichter fällt. So gleiten wir hinein in Normen wie in Kleidungsstücke, ziehen sie uns über, weil sie bereitliegen für uns, weil sie uns übergestülpt werden, weil sie sich anpassen oder weil wir, unbemerkt, uns anpassen. Normen als Normen fallen uns nur auf, wenn wir ihnen nicht entsprechen, wenn wir nicht hineinpassen, ob wir es wollen oder nicht. Wer eine weiße Hautfarbe hat, hält die Kategorie Hautfarbe für irrelevant, weil im Leben eines Weißen in der westlichen Welt Hautfarbe irrelevant ist. Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie sexuelle Orientierung für irrelevant, weil die eigene sexuelle Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann. Wer einen Körper besitzt, in dem er oder sie sich wiedererkennt, dem erscheint die Kategorie Geschlecht selbstverständlich, weil dieser Körper niemals in Frage gestellt wird.
Wer den Normen entspricht, kann es sich leisten zu bezweifeln, dass es sie gibt.
Besonders kurios war diese Zweiteilung beim Schwimmen im Freibad, das zum Gymnasium gehörte und zu dem wir, lange bevor es auch nur annähernd sommerlich und warm wurde, jedes Jahr genötigt wurden. In meiner Erinnerung gab es weder Schließfächer noch richtige Bänke, auf denen wir unsere Sachen ablegen konnten. Eigentlich gab es gar nichts außer dieser Trennung von Jungen und Mädchen. Was mich allerdings keineswegs daran hinderte, noch in Badehose zu schwimmen. Solange es bei mir nichts gab, das durch einen Badeanzug zu verdecken gewesen wäre, solange gab es für mich keinen Grund, einen Badeanzug zu tragen. Einfach als Marker weiblicher Identität leuchtete mir der Badeanzug nicht ein. Meiner Mutter glücklicherweise auch nicht. Das war noch nicht einmal ein bewusster Akt der Rebellion, kein Widerwillen dagegen, etwas Mädchenhaftes zu verkörpern. Ich verkörperte es ja kaum. Das war’s ja gerade. Wozu also ein Badeanzug? Vermutlich hätte ich es andersherum genauso wenig gewollt: wenn alle Kinder zunächst einen Badeanzug getragen hätten, und dann, ab einem bestimmtem Alter, die eine Gruppe zu einer Badehose hätte wechseln sollen. Vermutlich hätte ich das auch vermeiden wollen: anders zu werden als die anderen, sich plötzlich unterscheiden zu sollen von dem, was vorher einmal als normal gegolten hatte.
Wie wäre es wohl gewesen, wenn es diese Trennung nicht gegeben hätte? Wenn die Verschiedenheit als nicht bedeutsam gegolten hätte? Wenn Jungen und Mädchen als Kategorien irrelevant gewesen wären? Wenn das Geschlecht so wie die Haarfarbe eingestuft worden wäre: als Eigenschaft, als individuelle Körperlichkeit, die unterschiedlich ausfallen könnte, aber die keinerlei soziale Folgen hätte, die keinerlei kollektive Kasten schaffte? Und was wäre, wenn die Tabelle nicht nach Mädchen und Jungen unterschieden hätte, sondern einfach nur die Namen der Schüler untereinandergereiht hätte. Das war uns ja nicht einmal als Möglichkeit erschienen, dass auch Jungs hätten Jungs und Mädchen hätten Mädchen mögen können.
Sie kursierte, diese Tabelle, wanderte von Tisch zu Tisch, und dann trugen wir uns ein, mit dem gebeugten Arm vor unserem Nachbarn geschützt, als würde der nicht wenige Minuten später alles sehen können, und schrieben in die Zeile hinter unserem Namen in jedes Feld eines jeden Jungen eine Note. 2, 3–, 5, 1– oder 4+. Wir bekundeten unsere Zuneigung oder Abneigung, nicht im direkten Gespräch, nicht im heimlichen Liebesbrief, sondern in einer Liste, die durch die ganze Klasse gereicht wurde. Mit Noten, als sei es ein Leistungsnachweis, zeigten wir unsere Gefühle oder das, was wir dafür hielten. Eine andere Sprache hatten wir nicht. So trugen wir diese Ziffern ein, so vergaben wir Zahlen und Urteile, für jeden einzelnen in der Klasse, für jeden einzelnen des anderen Geschlechts zumindest, selbst für diejenigen, für die wir eigentlich gar nichts empfanden, weder Zuneigung noch Abneigung. Die bekamen dann eine 3– oder eine 3+, etwas Belangloses. Und wir vergaben hemmungslos, ohne Zögern, schlechte Noten für die, die uns nervten oder ekelten, die uns sonderbar erschienen oder unheimlich und wofür wir keine andere Form des Ausdrucks hatten als diese Liste. Ob die Betroffenen dann enttäuscht waren oder gekränkt, das bekümmerte niemanden.
Woher kam das? Wer hatte diese entsetzliche Idee gehabt? Hatte das jemand aus meiner Klasse erfunden, oder übernahmen wir nur etwas, das alle neuen Jahrgänge am Gymnasium wiederholten, zitierten wir eine Tradition, ohne sie als solche zu erkennen, so wie man im Herbst das Laub zusammenkehrt und verbrennt, allein weil das die Jahreszeit zu diktieren scheint?
Es war grauenhaft. Da lasen wir nun, im Wissen darum, dass alle anderen es auch lasen, dass der Junge, den wir mochten, uns unausstehlich fand oder, mindestens so schlimm, dass der Junge, den wir mochten, von allen anderen genauso gemocht wurde oder … Es gab zahllose Möglichkeiten der Demütigung und der Pein. Die Liste wurde durch die Reihen gereicht, und jeder wurde Zeuge der eigenen Beliebtheit oder Unbeliebtheit. Heutzutage ersetzt Facebook diese handgefertigten öffentlichen Arenen, aber das ändert nichts an der Sichtbarkeit der eigenen Verletzung, die darin möglich gemacht wird. Warum machten wir das?
Daniel und ich hatten Glück. Wir kamen davon auf diesen Listen. Wir bewegten uns im oberen Bereich, versammelten gute Noten und konnten uns darauf konzentrieren, ob wir die beste Note auch von denen bekamen, von denen wir sie auch haben wollten.
Sie wanderten eine Weile lang herum, diese Zettel, wurden neu ausgefüllt, die einzelnen Kandidaten neu bewertet, und dann, eines Tages, nachdem auch bei der x-ten Wiederholung dieselben Namen immer die guten Noten auf sich vereinten und dieselben Namen immer nur die schlechten Noten sammelten, wurde die Liste verkürzt. Wer sich das ausgedacht hatte, weiß ich nicht. Als spielten die weniger Beliebten gar keine Rolle mehr, als seien sie überflüssig, als wären sie so aussichtslos unbeliebt, bei allen und jedem, dass es gar keinen Sinn mehr hatte, sie überhaupt auch nur zu bewerten, als gehörten sie nicht mehr dazu, wurden sie ausgeschlossen und weggelassen. Es wurde eine neue Liste entworfen. Wieder mit den Namen der Jungen in der senkrechten Achse und den Mädchen in der waagerechten für die Jungen und eine andersherum für die Mädchen. Doch jetzt gab es nur noch sechs und sechs Namen. Die Liste der Jungen und die Liste der Mädchen waren jetzt so kurz, dass beide Skalen auf einen Zettel passten.
Der Rest kam einfach nicht mehr vor.
Mein erster Freund war Ben. Er hatte dunkle Locken und diesen lässigen, leicht schlurfenden Gang. Warum Ben mein erster Freund war, war eigentlich unklar. Das hatte sich durch die Listen so ergeben, er gefiel mir, und es war nun mal die Zeit, in der wir mit jemandem befreundet sein sollten, und diese Freundschaften sollten anders sein, als es bisher die Freundschaften waren. Das hatte mehr von einem Beschluss als von Begehren. Vielleicht war das einfach, weil das Gymnasium eine andere Welt sein sollte, weil wir, die wir auf der Beobachtungsstufe waren, uns zwar nicht besonders beobachtet fühlten, aber uns selbst beobachten wollten.
In diesen ersten Jahren am Gymnasium fand noch alles gleichzeitig statt: die Spiele von Kindern und die Rituale von Jugendlichen. Wir spielten stundenlang auf den rutschigen Steinen am Fluss, bei Flut, wenn das Wasser hoch stand und wir auf den Steinen hockten und warteten, bis die Bugwellen von vorbeiziehenden Containerschiffen uns erwischten, und wir spielten »ditschen« mit kleinen, möglichst flachen Steinen bei Ebbe und möglichst ruhigem Wasser. Am Fluss war die Zeit etwas, das zu sehen war: an den Linien am Strand, die das Dunkle vom Hellen, das Feuchte vom Trocknen teilten. Am Wrack des gestrandeten Schiffs, das zu weit im Wasser lag, als dass die Ebbe den Weg dorthin hätte freilegen können. Es stand düster und unerreichbar. Mal, bei Hochwasser, fast ganz versunken, mal, bei Ebbe, mit dem Wasser bis zum oberen Drittel der Rumpfwand. Nur im Winter, wenn der Fluss fror und die Schollen günstig lagen, konnte man es riskieren, auf jedes Knirschen im Eis horchend, ob sich unter den eigenen Schritten Risse bildeten, bis zu dem geheimnisvollen Schiff zu gelangen.
Wir tauchten ab im Wald, kletterten in die Fuchsbauten im Farnkrautfeld oder bauten Baumhütten auf den klettergünstigen Rotbuchen. Der Wald war kaum besucht. Ganz selten kamen Hundebesitzer des Weges. Wir verschwanden, mittags, nach der Schule, manchmal mit belegten Knäckebroten als Proviant, und tauchten abends wieder auf, verdreckt und meistens mit aufgeschürften Armen und Beinen.
Und irgendwie hatten wir den richtigen Rythmus nicht gefunden. Oder vielleicht auch nur ich nicht. Nachträglich scheint es so, als sei ich immer entweder zu früh oder zu spät gewesen, aber nie im Takt der Zeit. Ich hatte den Moment verpasst, an dem es nicht mehr schicklich war, im Wald zu verschwinden oder am Fluss herumzustromern. Der Wald war meine eigene Welt, eine unerschöpfliche Landschaft aus Sträuchern mit wilden Beeren und ausgetrockneten Bachbetten, aus Gerüchen und Geräuschen, aus Pflanzen und Bäumen, die Spuren hinterließen und Ankündigungen demjenigen versprachen, der all die Zeichen des Waldes zu lesen verstand.
Allein hatte ich mir das vorgenommen und nur meinem Hund diesen Beschluss leise ins Ohr geflüstert, dass ich mir den Wald hinter dem Haus meiner Eltern aneignen wollte, seine verwachsenen, schmalen Wege, mir das Innere der Rhododendren mit ihren knorrigen Zweigen erschließen wollte, ganz langsam, ohne die Äste zu brechen, nur zurückbiegen, und dann hinein in die tiefe, kugelige Pflanze, die nach außen so geschlossen wirkt mit ihrem dunkelgrünen Dach und nach innen dann so großzügig luftigen Raum freigibt.
Ich wollte Bäume blind unterscheiden lernen: Ich schloss die Augen, legte die Hände an die Rinde der Bäume, die ich kannte, und ertastete langsam ihre Haut, mit den Fingerspitzen fuhr ich durch die Rillen, fühlte ihnen nach, vertikal, erspürte die knorpeligen, spröden Erhöhungen, wie hölzerne Adern, und prägte mir ein, das war die Haut einer Eiche, trocken wie ein Händedruck. Ich übte weiter: diese glatte Haut, mit einem leicht körnigen Staub darauf, der herunterrieselte, wenn man die Hände an dem Stamm rieb, eine pralle Rinde, als drängte es von innen, als platze gleich ein neuer Trieb direkt unter der eigenen Hand hervor, das war die Haut einer Buche.
Es gab eine besondere Buche im Wald, die stand unterhalb des Weges, und wenn es regnete, füllte sich der Spalt zwischen den Ästen und dem Stamm etwas mit Wasser; es fühlte sich wie eine Achselhöhle an, nur mit der Vertiefung nach oben, so dass Regen sich darin sammeln konnte. Wenn ich in die Achsel der Buche klopfte, sprang mein Hund an dem Baum hoch und trank das Wasser aus der hölzernen Mulde.
Oder dieser Baum mit pergamentener Haut, ein dünner Stamm, schmal, jungenhaft, aber mit papierener Schale, mit brüchigen Stellen wie Schorf, das waren Birken, aschene Bäume, die ich später, mein Leben lang, mit Bergen-Belsen assoziieren sollte, weil wir einmal das ehemalige Konzentrationslager an einem kalten, nebligen Frühlingstag besucht hatten, mein Vater hatte beschlossen, dass wir, auch als Kinder, das sehen sollten, und mich die zahlreichen Birken an den Massengräbern mit ihrer milchigen Farbe so irritiert hatten. Vermutlich hatte mich nicht eigentlich die Farbe gestört, sondern einfach nur, dass sie da überhaupt standen und wuchsen, aus dieser Erde herauswuchsen, dass sie nicht verdorrten, eingingen, zerbrachen.
Mit der Zeit wurde mir der Wald immer vertrauter, und ich begann mir auch die Gerüche vorzunehmen, ich brach Zweige ab und roch daran, köpfte Blüten von ihrem Stengel und roch daran, ich wühlte feuchtes Laub auf, schichtete Moorfladen von Steinen oder der Erde und hielt meine Nase hinein, ich legte Archive an, innerlich, über den kurzen Moment, vielleicht die letzte halbe Stunde, vor einem Wolkenbruch, und für die ersten Minuten danach, wenn der Regen den Wald eingetaucht hat, wenn alles anders riecht, die nassen, dampfenden Steine, die Sträucher, das Gras. Ich speicherte die Erfahrung dieser Verwandlungen, wie sich die Natur öffnen, recken, strecken, entblößen und von innen nach außen kehren kann, wie sie ihre Konsistenz ändern kann, weicher wird, nasser, poröser, glatter, oder eben trockener, brüchiger, knorriger, wie sie sich zusammenziehen kann, kleiner oder größer werden, ein lebendes, atmendes, vielsprachiges Wesen.
Und so schien es mir das Normalste von der Welt zu sein, für den ersten Kuss zu der Höhle in den Wald zu gehen. Die Geschichten vom ersten Kuss klingen bei anderen immer so romantisch, so verzaubert. An meinem ersten Kuss war eigentlich das Aufregendste, dass es der erste Kuss war. Zu der Höhle im Wald waren wir schon oft gegangen. Es war der vertrauteste Ort, der nur uns gehörte. Das selbstgebaute Versteck bestand aus einem querliegenden Stamm einer Fichte, inmitten von Buchen und Eschen. Der Baum war so gebrochen, dass ein Teil des Stammes eben oberhalb des Waldbodens lag. Mit etwas gesammeltem Geäst verflochten, war es wie ein kleines hölzernes Iglu. Da küssten wir uns dann, und es mengte sich der leicht metallene Geschmack von Ben mit dem von frischem, warmem Laub.
Auf der nächsten Klassenfahrt hatte Ben abends an mein Zimmer geklopft, und als ich dann die Tür aufmachte, stand er im Türrahmen und sang »All my loving« für mich. Ben mochte die Beatles. Und er mochte offensichtlich mich. Er kannte alle Liedtexte auswendig. Ich hockte auf der Kante vom unteren der beiden Stockbetten und hörte zu und wusste nicht, warum ich mir so komisch vorkam. Ich schaute abwechselnd auf Ben, der im Halbrund der anderen Jungen aus der Klasse stand, mit denen er offensichtlich gewettet hatte, ob er sich das trauen würde, und auf die Mädchen aus meinem Zimmer, die mich um etwas beneideten, das ich eher ein wenig peinlich als beneidenswert fand.