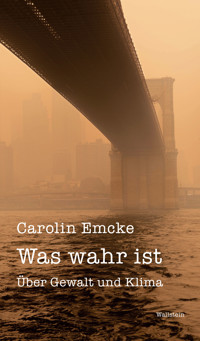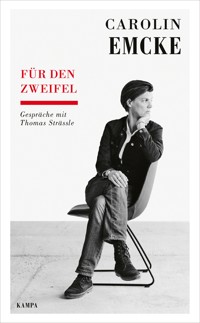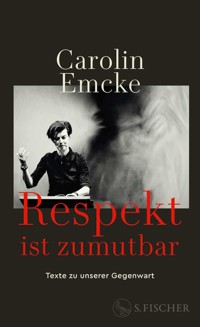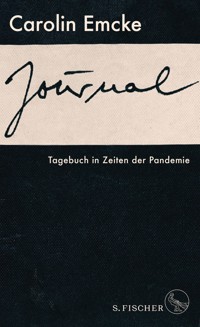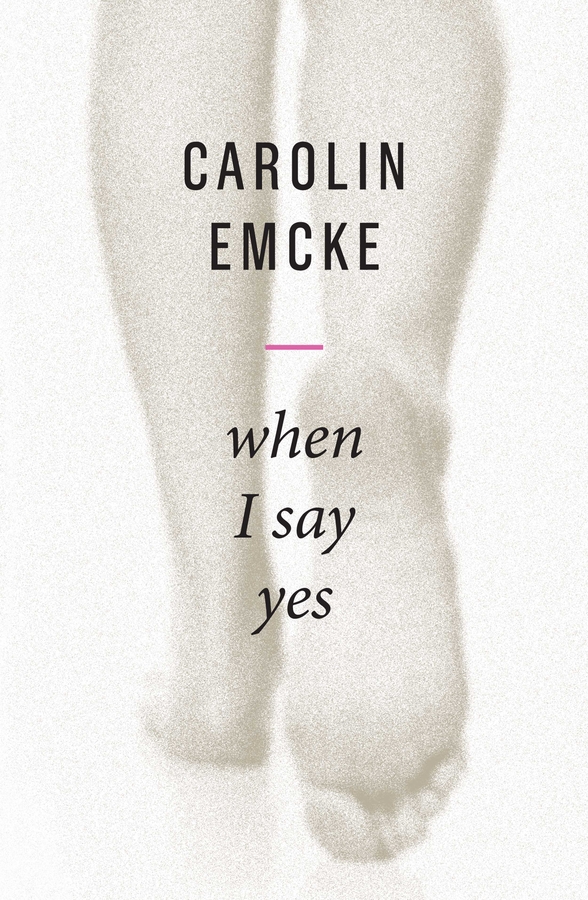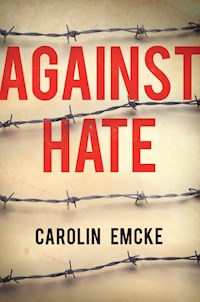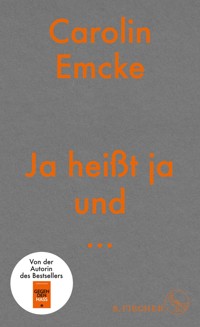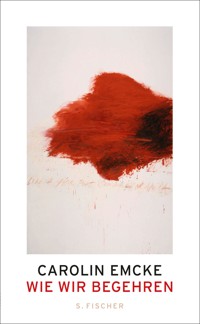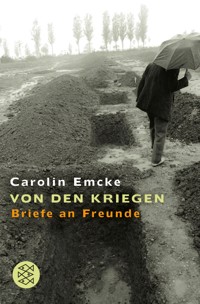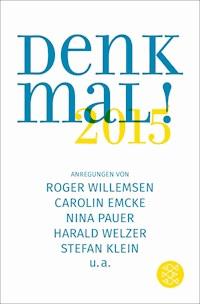
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
+++ Die wichtigsten Vor- und Nachdenker unserer Zeit in einem Band+++ Mit Denkanstößen von Roger Willemsen, Carolin Emcke, Nina Pauer, Harald Welzer, Stefan Klein u.a. Ein guter Text kann uns die Augen öffnen und unsere Art, die Welt wahrzunehmen, für immer auf den Kopf stellen. Wir haben uns also auf die Suche gemacht und unsere Bücher nach den spannendsten, erhellendsten und wichtigsten Texten durchforstet. In unserem Netz fanden wir dabei interessante und inspirierende Texte von großen Denkerinnen und Denkern unserer Gegenwart, von denen wir glauben, dass sie uns Hinweise und Antworten auf einige der wichtigsten Fragen unserer Zeit liefern können. Beiträge von Kai Biermann & Martin Haase, Carolin Emcke, Rainer Erlinger, Joachim Helfer, Gerald Hüther, Stefan Klein, Nina Pauer, Robert Pfaller, Antje Rávic Strubel, Arnold Retzer, Hanne Tügel, Harald Welzer und Roger Willemsen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Denk mal! 2015
Anregungen von Roger Willemsen, Carolin Emcke, Nina Pauer, Harald Welzer, Stefan Klein, u.a.
FISCHER E-Books
Inhalt
Roger Willemsen
»Kinderleben«
»Am Anfang war alles beisammen«, sagt der griechische Philosoph Anaxagoras, »dann kam der Verstand und schuf Ordnung.« Der irreparable Mensch ist der Mensch, der das Chaos hinter sich hat und die Ordnung in der Marotte, in der Konvention, in den Tröstungen der Gewohnheit, im Tic, in der Routine, im Stil findet. Er wird nichts mehr. Kultivierte er früher vielleicht noch das aufklärerische Ideal, das Ich-Gebilde müsse stetig, plausibel, aus sich heraus entwickelt aufsteigen, so blamiert das Selbstbild im Knacks jede Vorstellung einer sich zielgerichtet entwickelnden Persönlichkeit. Am Ende erweist er sich als allenfalls amüsierbar.
Es gibt selbst im Leben des Kindes einen Ernst, der das Eigentliche vom Uneigentlichen trennt. Das Eigentliche verbindet sich dem Überleben.
In der Nacht wachte ich als Kleinkind davon auf, dass ich nicht mehr atmete. Die Luft war in der Brust stehengeblieben, vielleicht eine Tasse voll, in ihrem reglosen schwarzen Spiegel reflektierte nichts. Das war früher schon passiert, ich musste nur warten, dass der Atem wieder zu fließen beginnen würde, aufwärts, um die Lungen zu füllen, oder abwärts, um sie endlich auszuleeren.
Ich schlug mit den Wimpern, um die Sauerstoffzirkulation anzuwerfen. Nichts zu sehen, kein Schatten, keine Aufhellung. Als sei ich zeitgleich erblindet. Dazu ein Zehren in der Brust, so als müsse jeden Augenblick das Vakuum dort implodieren und das Licht fiele wieder durch einen Riss in der Nacht: aber nur um den Tod zu beleuchten. Und während die Luft immer noch stand und das Dunkel durch die geöffneten Augen in den Kopf eindrang, harkte ein Croupier mit dem Rechen lauter Kinderbilder zusammen – ein sonniges Mauerstück im Hof, ein schmutziges Läppchen, ein Butterkügelchen auf einem geschnitzten Brett –, warf sie durcheinander und ließ sie verschwinden, bis nur noch das Spielfeld blieb, und dann die Angst, jetzt, in diesem Augenblick, abgeschafft zu werden.
Und als es schon fast zu spät ist, weil selbst die Angst durchlässig wird und unbedrängten Bildern Platz machen will, ruckt der Atem, nur zwei Zentimeter höher (also aufwärts ging es), und dann in einer Talfahrt hinab, in einem langen seufzenden Gleiten. Du atmest. Es wird dir nichts geschenkt. Am nächsten Morgen ist alles zunächst ein bisschen leerer.
Als Kind habe ich geglaubt, man käme direkt aus dem Nichts. Warum sollte ich auch nicht noch mit dem Nichts behangen sein, mit einer Sphäre des Unbewussten? Ich war noch nicht lange am Leben. Kannte ich nicht deshalb den Tod besser? In einer Selbstmord-Statistik aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts sind schon Fünfjährige erfasst, die sich das Leben nahmen. Die meisten von ihnen sprangen aus dem Fenster, ich dachte damals, wie Eichendorff schreibt, »als flögen sie nach haus«.
Warum sollte das Gefühl des Heimwehs nicht älter sein als die Erfahrung der Heimat? Warum sollte nicht fehlen können, was man nie besaß? Wahrscheinlich ist selbst anderen Gefühlskomplexen – der Liebe, der Begierde, der Enttäuschung – manchmal etwas wie Heimweh beigemengt.
Trotzdem spricht die erwachsene Welt gerade dem Kinder-Suizid gegenüber gern vom »Appell«, von »Signalfunktion«. Als ob es eine einzige menschliche Handlung gäbe, die nicht auch sprechen und eine Wirkung hinterlassen wollte! Bei der Betrachtung eines solchen Kinderlebens aber findet man vielleicht nichts: keine Sünde, keine Angst vor Strafe, keine Herzlosigkeit der Alten, kein Trauma der Institutionen. Der Tod steht in sich, als sei er schon vorher da gewesen.
Das Kind, der Halbwüchsige, sie können vielleicht, was das 19. Jahrhundert in seinen Totentänzen konnte: Den Tod als Freund denken, so wie er am Bett wacht, hinter dem Schreitenden auf der Brücke wartet, im Kellergewölbe die Kerzen behütet, ganz wie ein Schutzengel. Diese Jungen, sie kennen den »Gevatter Tod« der Märchen nicht als Dämon, nicht ausgestattet mit der Psychologie des Verführers, des Schurken oder Betrügers. Den Tod als Mentor kennen sie, als Seelsorger. Als das erhabene Hohlbild aller realen Freunde können Kinder ihn denken, sind sie doch von den Zudringlichkeiten öffentlicher Lebensfreude erst gestreift und den Anforderungen des erwachsenen Lebens vielleicht nicht besser gewachsen als dem Mysterium des Todes.
So hat, wenn Kinder und Halbwüchsige aus dem Leben gehen, ihr Gestus etwas von der österreichischen Wendung für den Suizid: Die Sich-heim-Drehenden sind es, die erkennen durch Erfahren.
Die erste Verstandesordnung, in die das Kind von der Schule des Lebens eingeführt wird, ist die logische. Wer nicht zählen kann, kann auch nicht erzählen. Also unterwirft sich das Kind die Welt zuerst durch die Grundrechenarten und lernt so den Vorgang des Addierens und Substrahierens. Es sagt nicht »Substrahieren«, und es sagt nicht »Minus«, es sagt: »Abziehen« und »Weniger«. Es ist die Zeit, in der ein Verb noch »Tu-Wort« heißt und ein Adjektiv »Wie-Wort«. Denken wir also an Abertausende geballte Kinderfäuste, in denen ein Stift steckt, und diese Kinder lernen auf dem Papier zu kalkulieren: Fünf weniger Drei, Zehn weniger Sieben. Vielleicht bringt das Bewusstsein hier eine Erfahrung auf den Begriff, die es in der materiellen Welt als Erstes erfährt: Etwas wird weniger, die Milch, das Essen, das Tageslicht, selbst die Tafelkreide.
Dass die Welt schrumpfen kann, dass sie jeden Einzelnen mit dem Mangel bedroht und das Geschenkte entziehen kann, mit dieser Erfahrung beginnt die Reife. Denn einerseits entfaltet das Glück seine Großherzigkeit gerade darin, dass es den Glücklichen in die Mitte des Überflusses setzt, andererseits findet dieser seinen Platz darin, indem er sich bescheidet. Das Unerschöpfliche erweist sich als erschöpflich, das dem Einzelne Zugemessene rationiert.
Der Prozess der Reife beginnt also, wo der Einzelne in die Kategorie des »Weniger« eintritt, weil er weniger Habe, aber auch weniger Geist, weniger Gefühl, weniger Urteil, weniger Sprache, weniger Emphase besitzt, weil er sich als Mangel erkennen und seine Individualität aus soviel Mangel gewinnen muss. Das ist eine soziale Erfahrung, die Geburt des Einzelnen als »zoon politikon«.
Zugleich mischt die Erfahrung der eigenen Minderwertigkeit dem Heranwachsen und Reifen ein Kontrastmittel bei, das hilft, alle Farben einer Persönlichkeit umso stärker hervortreten zu lassen. Wie ein Mensch sich der Erfahrung des Mangels, der Niederlage, des Scheiterns, der Verminderung seines Selbstgenusses stellt, sagt mehr über seine Persönlichkeit aus als sein Umgang mit Triumphen.
Es handelt sich also um gegenläufige Prozesse: Während sich der Mensch im Verlauf der Kulturgeschichte erst zur vermeintlichen »Krone der Schöpfung« emanzipiert, gewinnt er in der Individualgeschichte allmählich das Bewusstsein, auch weniger zu sein und zu werden.
Es ist dies der Prozess, den man das Altern nennt, das Welken, Vergehen, Verfallen, Hinscheiden, eine Erfahrung, die vom Leben immer reicher orchestriert wird: Weniger Haare, weniger Zähne, weniger Luft, weniger Schlaf, weniger Spannung, weniger Kraft. Und diese Verminderung findet in der Welt außen ihre Entsprechung: Weniger Spezies, weniger Wälder, weniger Atemluft, weniger Natur, weniger Ruhe, weniger Sicherheit.
Am Ende bewegt sich der Mensch zwischen zwei Sphären der Verminderung. Beide entziehen sich seinem Einfluss. Doch auch wenn man die Geschichte der Kultur nicht zuletzt als Anpassung an Prozesse der Verminderung verstehen kann und auch wenn das Altern den Einzelnen weniger werden lässt und ihm seine Hoheit sukzessive entzieht, bleibt es sein Privileg, den Mangel kompensieren zu können. Zuletzt kommt er, reduziert und reich zugleich, bei seinen Anfängen an, beim Schlichten, bei der Fülle im Wenigen, bei Dürers Satz: »Als ich jung war, erstrebte ich Vielfalt und Neuheit; nun in meinem Alter habe ich begonnen, das natürliche Gesicht der Natur zu sehen, und fange an zu begreifen, dass diese Einfachheit das allerletzte Ziel der Kunst ist.«
Die wirkliche Wirklichkeit, »das natürliche Gesicht der Natur«: Das Einfache, versiegelt durch eine Tautologie, der Verlust als Rettung in einer Sphäre des Verlierens.
Inseln, immer Inseln oder Halbinseln, meine ganze Kindheit ist voll von ihnen. Wann immer meine Eltern Ende der fünfziger Jahre ihren weißen NSU »Neckar« bepackten und Auslauf suchten, wussten wir Kinder: Meerumschlungen musste das Ziel sein und dem Freigang eine natürliche Grenze setzen. Meinem vor allem, denn gerne habe ich als Kind das Weite gesucht, bin aber nie weit gekommen. Das heißt, bis ans Meer bin ich immer gekommen, deshalb rührte mich später jene Zeile aus einem alten Seemannslied, in der es heißt: »Und des Matrosen allerliebster Schatz muss weinend steh’n am Strand.« In meiner Kindheit war ich Seemannsbraut, jedenfalls stand ich weinend am Strand.
Doch zugleich konnte mich dieser Zustand an sich ziehen mit erotischer Intensität. Immer hatte ich ein gepacktes Köfferchen unter dem Bett, bereit, jederzeit aufzubrechen, und später legte ich im Keller einen Vorrat aus Büchsen an, die ich bei meiner Flucht aus dem häuslichen Leben, einer Flucht in die Unbehaustheit, brauchen würde. »Ohne festen Wohnsitz«, das war damals als Prädikat so verführerisch wie »Staatsfeind Nr. 1«.
Auf der Insel Reichenau im Bodensee fing alles an. Mit einem Eimerchen und vollen Windeln über eine steinige Uferstrecke watscheln, das geht als Erholung durch in einer Zeit, in der man sich noch nicht erholen muss. Wenn man das Fruchtwasser noch nicht lange hinter sich hat, ist das Meerwasser eigentlich nur geschmacklich sensationell.
Außerdem ist man als Kind der Kindheit der Menschheit wahrscheinlich näher. Man bewegt sich gewissermaßen den ganzen Tag lang in vorgeschichtlichen Epochen, wird zu einem Teil der hackenden und sammelnden Kulturen, buddelt Gruben, Gräben, ganze Stollen, um die Erde zu gestalten, ihr etwas abzutrotzen, ihre Kraft zu brechen oder in ihr fündig zu werden. »Zeigebewegungen sind zu kurz geratene Greifbewegungen«, hat der Völkerpsychologe Wilhelm Wundt bemerkt. Kinder weisen in alle Himmelsrichtungen, und sie finden sogar die romantische Idee von den Schätzen im Erdinnern äußerst plausibel. Deshalb habe ich Jahre meiner Kindheit in der schließlich enttäuschten Hoffnung zugebracht, das Meer werde mir einen Goldklumpen oder Bernstein, den ich mir schwarz vorstellte, vor die Füße spülen.
Reichenau, Norderney, Borkum, Vrouwenpolder: In meinem Gedächtnis sind alle diese Eilande eins. Sand, Kies, Schlick: Geblieben ist nichts als Materie. Ich schmecke kein Wasser-Eis, sehe keine Bikinis, rieche kein Piz Buin mehr, denn diese Inselferien waren wie Leben vor dem ersten Schöpfungstag. Diese Zeit bewegt sich nicht, sie ist gefeit vor dem Morbus der Veränderung. Mal ist Licht auf ihr, mal nicht. Was war, wird wiederkommen, es wird am nächsten Tag ganz genauso sein. Wenn es etwas gibt, das idyllisch ist an der Kindheit, dann ist es die Wiederholbarkeit: Man kann dieselbe Stelle in einem Märchen immer und immer wieder hören. Man kann die gleiche Speise immer und immer wieder auf die gleiche Weise verzehren. Zeige- und Greifbewegungen sind noch identisch.
Beim Betrachten von Kinderfotos: Man zieht eine Linie zwischen dem Erwachsenen und seinem Vorläufer. Von allen möglichen Metamorphosen der Person, herausdifferenziert aus dem Gesicht des Kleinen, erstarrt zu diesem einen Ausdruck – eine Variante bloß, aber offenbar die hartnäckigste, robusteste. Auf Fotos sieht man oft erst im Rückblick, welches der »eigentliche« Ausdruck dieses Gesichts ist, welches Gesicht hinter dem Gesicht saß und nicht gesehen werden wollte, welches das verdrängte, welches das überlagerte, welches das heraustretende Gesicht war. Man blickt Tote so an, Selbstmörder vor allem, um erkennen zu können: Vom Grund ihrer Augen aus wankt dem Betrachter ein Sterbender entgegen.
Er wolle die Erkenntnis ausschöpfen, »dass alles für nichts« ist. Davon war der wenig ältere Freund aus meinen Kindertagen wie besessen. »Dass dahinter nichts ist!« Er redete mir in die sperrangelweit offenen Augen, redete sich selbst in einen nihilistischen Rausch, so früh schon. Er hatte zuerst die Welt der Ideen entdeckt, dann die Welt und konnte also denken, ehe er erzählen konnte.
»Mach, dass du Land gewinnst«, wiederholte er. In seinem Mund bedeutete das nicht: Verschwinde, sondern erwirb sie rasch, die Fähigkeit, Abstand zwischen dich und die Welt zu bringen. Er blickte auf die Erde wie ein Kosmonaut und konnte keinen Eiffelturm, keinen Kölner Dom, keine Nordsee erkennen und keinen anderen Konflikt außer jenem, der die Welt eines Tages das Leben kosten könnte. Ein Untergangsversessener war er, den ich kaum verstand und der sich manchmal schon auf geschriebene Sätze berief.
Zur gleichen Zeit lernte ich meinen ersten Satz schreiben. Er lautete: »Heiner ist im Auto.« Ein enttäuschender Satz, von dem nichts ausging, den ich ohne Stolz schrieb, der keinen Sog besaß und den ich nie mehr brauchen sollte. Aus den Sätzen des Freundes dagegen drang das süße Gift des Pessimismus. Er besaß Aura und bewährte sich als das erste Ordnungsprinzip der kindlichen Welt.
Von meinen vier Großeltern sind drei erschossen worden. Ich kenne den Krieg nicht, bin aber unter den Augen von Hinterbliebenen aufgewachsen. Sie hatten nicht allein den Verlust in sich aufgenommen, sondern die Geschichte des Verlierens. Vom Krieg zu Leidensempfängern verurteilt worden, verbarrikadierten sie sich im Fatalismus.
Die einzige überlebende Großmutter hatte eine eigene Ikonographie für ihren Gram gefunden: Lebhaft interessierte sie sich für die Zeitungsfotos von in den Weltraum geschossenen Tieren: Affen, die mit einer zerdrückten Nase aus der Schwerelosigkeit heimgekehrt waren, der Raumhund Laika, dem, wie man damals glaubte, zu wenig Futter mitgegeben worden war, so dass er im Orbit verhungerte.
Meine Großmutter studierte diese Fotos mit dem Vergrößerungsglas, aß Dextropur mit dem Esslöffel dazu und versuchte, die Erfahrung der Reise im Blick der Heimgekehrten zu rekonstruieren. Das machte sie heiter, selbst wenn unter dem Vergrößerungsglas manchmal kaum mehr erschien als eine Masse von Rasterpunkten.
Offenbar lag im Schicksal dieser dem Experiment geopferten Tiere, in der Schwerelosigkeit, in der sie Opfer waren, im Mutwillen, mit dem man sie Gedeih oder Verderb auslieferte, etwas Symbolisches, das auf meine Großmutter heilsam wirkte, vielleicht, weil sich eine Gesellschaft darin fand.
Einmal, ich ging noch nicht einmal zur Schule, spielten wir in ihrem Häuschen Verstecken. Meine Schwester und ich deklarierten die fast achtzigjährige Greisin mit ihrem schlohweißen Haar und ihren komischen, nach Zigarettenrauch und 4711 riechenden Seidenkleidern zur Hexe und legten das Spiel als »Hänsel und Gretels Revanche« an. Als wir die Großmutter hinter dem Bett aufgespürt hatten, überzogen wir sie mit Vorwürfen, geißelten sie im Spaß, stellten ihr Strafen in Aussicht, aber ich war es, der sagte: »Und froh sind wir, wenn du tot bist.«
Unter diesem Satz richtete sich die Großmutter – immer noch eingeklemmt in ihrem Versteck hinter dem Bett – zu Überlebensgröße auf. Sie konnte sich gerade nicht befreien, sagte aber mit großer Stimme und todernstem Gesicht: »Raus!« Wir dachten, sie wolle heraus aus ihrem Versteck, aber als ihr Arm mit den hellen Sommersprossen auf dem weißpudrigen Grund hochzuckte und mit ausgestrecktem Finger auf der Höhe der Tür einrastete, trollten wir uns.
Entlassen in ein moralisches Delirium, aus dem es kein Entrinnen gab, war mir nicht mehr zu helfen – gegen den stummen Vorwurf meiner Großmutter nicht, die bis zu ihrem Tod, Jahre später, nur noch das Nötigste mit mir redete, und gegen den Selbstvorwurf auch nicht, mit dem ich ihren Vorwurf gewissermaßen beglaubigte.
Hatte ich unbewusst das Überleben dieser Großmutter als ihre Schuld empfunden? War das Spiel nötig gewesen, um etwas Ernstem zur Selbstbefreiung zu verhelfen? War meine Anhänglichkeit an die Alte – als Liebe lässt es sich rückblickend, verzerrt durch das Prisma der Schuld, nicht mehr bezeichnen – getragen von einer Faszination für ihre Fähigkeit, dem Tod zu entkommen? Und war ihre Liebe zu den Weltraum-Tieren nicht Indiz für ihr sinnlos spezialisiertes Greisinnen-Alter? Das Gefühl der Schuld hat sie jedenfalls überlebt. Aber als sie starb, so viel weiß ich, mischte sich in das Bedauern die Erleichterung darüber, meiner Schuld nun wenigstens nicht mehr ins Auge sehen zu müssen. In diesem Gefühl erlebte die Schuld ihren nächsten Schub.
Ein offenbar geistig behindertes Kind wird von zwei jungen Frauen in kurzen Röcken durch eine Allee geschoben. Der Kinderwagen ist zu klein für das Kind, weil dieses dem Alter nach schon nicht mehr hineingehört. Außerdem geht sein Blick nur schielend in die Welt, erfasst aber ein einzelnes, vom Himmel taumelndes trockenes Blatt, besteht auf »Anhalten« und wendet den Kopf jetzt seitlich, um dem Blatt weiter folgen zu können, bis dieses liegt und liegen bleibt, von keinem Wind aufgehoben. Das Kind lässt es ruhen, ruht mit den Augen, mit dem Gemüt selbst auf dem Blatt und lächelt selig. Es wirkt, als sähe es gerade, was die Frauen nicht sehen: Schöpfung an sich, eine Kreatur namens Blatt. Das Kind schielt, aber mit einem Ausdruck, als könne es nur so der Natur auf den Grund gucken.
Kinder enthalten das Ideal der Menschheit. Während sie das scheinbar Sinnlose tun, spielen, werken, streunen, sieht man darin nicht die Bautätigkeit von Persönlichkeiten, die einmal Briefträger, Dienstleister, Formel-1-Fahrer werden. Natürlich sagt man nicht: Da geht der werdende Trickbetrüger, Hochstapler, Jahrmarktschläger, der Urologe, der Feldwebel. Wir wollen uns Kinder »rein« vorstellen, vorhistorisch. Lieber machen wir für ihr Abweichen und Abirren eine widrige Umwelt, schädliche Einflüsse, Traumata verantwortlich, lauter Kräfte, die eine Persönlichkeit abrupt verändern, stören, vom Pfad abbringen können, der nie ein Pfad ist. Kinder werden gedacht als die Blaupausen zu idealen Lebensmöglichkeiten, nicht als tickende Zeitbomben eines vor der Selbstentfaltung zum Amoklauf stehenden Homunkulus. Schicksal und Aufklärung, so wird unterstellt, bestimmen seinen Weg. Alles kommt von außen. Da ist auch die Sicht besser.
Mit etwa sieben Jahren spielte ich in Gesellschaft von ein paar Schulfreunden auf dem Gelände einer Glasfabrik. Zwei der Jungen kletterten auf eine Palette voller Einweckgläser, kamen ins Rutschen und rissen die aufgestapelte Ladung mit sich. Der eine verstauchte sich das Bein, der andere wurde von den Scherben tranchiert. Das in alle Richtungen geflossene Blut verband die verstreuten Leichenteile.
Der Augenblick war rabiat und wuchtig, und während ich zusah, wie sich der Mund meines in seinem Blut liegenden Freundes öffnete, um zum letzten Mal seinen Kinderatem unhörbar in die Frühlingsluft entweichen zu lassen, hatte ich als der reglose Zuschauer meine erste Begegnung mit dem Ernst des Lebens, das ich hier wohl zunächst von ganzem Herzen anstaunte, weil es solche Tragödien schrieb.
Der Freund war ein Gezeichneter gewesen, zumindest kam es uns hinterher so vor, einer, der markiert und in diesem Adel unter uns war, ein »früh Vollendeter«, wie man ehemals gesagt hätte, »ein Todgeweihter«, den niemand als solchen erkannte. Der Tod des Freundes adelt auch die Hinterbliebenen, schon weil er die Dimension des Posthumen in ihr Leben bringt. Sie lassen zum ersten Mal etwas zurück, schließen ab und überleben.
Schon im Gefühl der Exklusivität solcher Erfahrungen, befreundete ich mich anschließend mit einer unscheinbaren und verdrossenen Mitschülerin, einer Besonderen, die als Erste von uns ihre Mutter verloren hatte. Von unseren Lehrern waren wir angehalten worden, in ihrer Gegenwart kein lautes Wort zu sagen. Das muss quälend für sie gewesen sein. Aber weil die Konventionen es einfacher machen, lernten wir sie rascher als die Gefühle und umgaben die Mitschülerin als nachtragende Kondolenzgemeinde, und das heißt auch, wir entließen sie keinen Augenblick aus ihrer Trauer.
Während an der Mitschülerin aber nur ein Gesetz des Lebens vollstreckt worden war, schlich sich in die Gedanken an den fatalen Sturz des Freundes ein symbolisches Element. Das tödliche Kinderspiel, sein Zustandekommen und seine Konstellation an diesem Tag waren zu sehr Ergebnis des Zufalls, als dass sie nicht eine besondere Deutung hätten herausfordern müssen. Also poetisierte man den Zufall: Der Tod des Freundes besagte, dass man an etwas Willkürlichem zugrunde gehen kann. Dieses »Etwas« war weder der Aufstieg noch der Sturz. Auserwählt war der Tote, gezeichnet durch eine bestimmte Krümmung, einen Knick in seinem Leben, den wir rückblickend deuteten.
So wurde der Tod des Freundes mehr und mehr zu einem Urtext unseres jugendlichen Weltschmerzes. Wir interpretierten ihn dauernd, und an seinem Grab beschloss ich, dass er aus einem bestimmten Grund gestorben sei, er also, bewusst oder nicht, auf diesen Grund zugegangen war und ihn, sobald er fassbar wurde, mit beiden Händen ergriffen hatte. Im Grunde behandelten wir den Tod, als sei er gewählt worden, und später sagte ein älterer Mitschüler sogar, er habe den Tod des Kleinen gespürt, wie der Letzte den Vorletzten spürt. So bewegten wir uns vertraulich in der imaginären Gemeinschaft von Toten und behandelten das Ende des Freundes, als habe es in der Welt des Kindes nichts Bedeutungsvolleres gegeben als dem Heimweh nach dem Tod zu folgen.
Als Benvenuto Cellinis Bruder, »der Pfeifer«, starb, ließ ihm Benvenuto eine Grabinschrift meißeln, die den Knacks in den Text einließ: alle Buchstaben mit Ausnahme der ersten waren zerbrochen.
In ihren Spielen kämpfen Kinder auch um den souveränen Raum, und die dabei frei werdende Kindergrausamkeit verrät nicht allein ein unmittelbares Verhältnis zum Tod, sie ist auch ein Mittel, dieser Souveränität Durchsetzung zu verschaffen. Außerhalb der engen Grenzen des Spiels oder der Tierquälerei hat das Kind keine Möglichkeit zur Herrschaft. Deshalb trägt die Vorstellung des eigenen Todes ein doppeltes Gesicht.
Einerseits wird hier der Verlust antizipiert, den das eigene Verschwinden in der Mitwelt auslösen würde, andererseits überantwortet sich das Kind in der Idee des selbst gewählten Todes der Hoheit dieses Todes und wird darin souverän. Allem unterworfen, kann es nur das eigene Leben zur Machtausübung aufrufen. Insofern besteht die Souveränität des Kindes – ganz anders als bei jedem anderen Glied der Gesellschaft – in der Macht einer Verneinung, die sich nicht Einzelnem gegenüber durchsetzen kann, aber dafür dem Leben. Deshalb wird in mancher Niederlage des kindlichen Willens gleich der selbstmörderische Impuls frei und reklamiert das Recht der eigenen, im Leben nicht frei werdenden Existenz.
Auch später noch gilt: Jede Lebenshemmung stimuliert den Wunsch, den beschädigten Egoismus wieder zu ergänzen, und so wie jede Einschränkung Phantasien der spontanen Selbstbefreiung und Emanzipation wecken kann, so mobilisiert der Gedanke an die Selbsttötung eine ganz eigene Art der Ich-Lust, einen narzisstischen Überschwang. Die Phantasie der eigenen Zerstörung wird Medium für die kühnen Vorspiegelungen der eigenen Möglichkeit und der in ihr eingeschlossenen Freiheit.
Für eine solche Freiheit hatte ich als Kind einen eigenen Topos: den Himmel. Zu dritt teilten wir uns in diese Freiheit, legten uns, ein mürrischer Freund und ein sportliches Mädchen, in die Wiese und versenkten uns stundenlang in das leere Firmament, und je höher hinauf der Blick drang, um hinter jedem Jenseits ein neues Jenseits zu erschließen, desto klarer wurde dieser Himmel als idealer Raum.
Dann schlossen wir die Augen, aufgehoben im Immensen, und stellten uns den Tod vor, den endgültigen. Nie wieder Leben, dachte ich, aber hinter dem letzten »Nie« folgte ein »Dann«, und ich musste noch einmal imaginieren: Nieniewieder, und dahinter Nienienienienie …
So versuchten wir, uns im Anblick des Himmels die Unendlichkeit des Raums und einer Zeit zu veranschaulichen, in der wir nicht leben würden. Keine Vorstellung erschien uns bodenlos wie diese, und schon seine Befristung machte das Leben schadhaft. Es ist ein Unterschied, ob man die eigene Endlichkeit streift oder ob man in ihr schwelgt. Wir taten Letzteres, wohl wissend, dass man sich davon nicht mehr erholt. Der Tod des Freundes unter den Gläsern war das eine. Der Suizid eines anderen Freundes schien mir verwandt, doch, heroisch gewendet, war dieses Hineingesogen-Werden in die Unendlichkeit jenes Nicht-Seins, das man aus sich selbst heraus produzieren muss, etwas grundsätzlich anderes und Eigenes, mit Angstlust Ergriffenes.
In Romanen ist dies die Schrecksekunde, in die der Satz fällt: »Von da an sollte ich nie wieder ganz froh werden« oder »Von diesem Moment an habe ich nie wieder geliebt«. Außerhalb von Romanen existiert vorausgreifende Gewissheit nicht, und wenn, dann weiß man nicht um sie, weil man immer an die Wiederkunft des Verlorenen glaubt. Selbst die Jugend hält man eigentlich für ein Geschenk, das eines Tages zurückerstattet wird, samt ihrer überbordenden Vitalität und ihrer Grenzenlosigkeit. Als könnte man wieder sein, was man nie gewesen ist.
Manchmal hat die Selbsttötung des Kindes etwas von jenem Handlungstypus, den man zu Beginn des letzten Jahrhunderts auch »acte gratuit« nannte. Er ist vielleicht nicht ohne Motive und Auslöser, aber im Wesen eine akausale, in sich stehende, von sich selbst mitgerissene Tat, die sich während der Ausübung nahezu erschöpft.
Insofern ist eine solche Selbsttötung vielleicht kein Akt, den die ganze Last des Lebens bedrückt, aber vielleicht verrät er die Belastung einer einzigen Stelle. Er besteht aus Müdigkeit, Sehnsucht, Weltschmerz, ist ein nachgeholter »plötzlicher Kindstod« oder folgt einem Sehnen und Schwärmen, wie man es auf großer Höhe spüren kann, angezogen von der Tiefe. Meine Begegnung mit dem Erstickungstod nachts im Bett war jedenfalls nur eine Episode aus einer ganzen Sequenz von Zuständen inniger, wenn auch schüchterner Sterbeerfahrungen.
Der Anblick des eigenen Endes hinterließ selbst auf den Euphorien des Tages einen diffusen Film, und der Enthusiasmus, mit dem sich das Leben im Essen und Spielen strapazieren ließ, fiel ab und wurde unwesentlich, sobald abends das Licht gelöscht wurde, die Stimmen im Haus verklangen und Dunkel und Ruhe ihre Bedeutung darin gewannen, den Schlaf und im Schlaf den Tod herbeizufaszinieren.
Vermutlich war genau dieses Gefühl das Weckmittel der großen Anbetung, die allabendlich der Überantwortung an den Schlaf vorausging. In tiefer, nie wieder erreichter Religiosität faltete ich die Hände und redete auf Gott ein mit den peinlichen, der dörflichen Liturgie nachgestammelten Ausdrücken altkluger Anbiederung an das Erhabene.
Kaum war aber das Gebet vorüber, fiel ich in den Zustand bloßer Devotion zurück, einen Zustand ohne Kommunikation und voller Unterwerfung, ähnlich jenem, den ich dem Tod gegenüber kultivierte und den ich hier nur mit einem Gesicht versah. Gott war nicht weniger als die liebevolle Seite des Todes; mit ihm zu sprechen bedeutete, dem Sterben durch Gutwilligkeit zuvorzukommen.
Insofern enthielt die jugendliche Religiosität weit mehr von einer Verarbeitung des kommenden Todes als von einer Vorbereitung oder Begleitung des Lebens – eine Situation, die zur Folge hatte, dass ich später nicht nur vom Glauben abfiel, ihn zeitweilig sogar verachtete und sich erst später Indifferenz in kulturhistorisches Interesse verwandelte. Die größte Sympathie empfand ich immer dort, wo sich Gottes- und Todesanbetung als identisch erwiesen. Damals kam mir die gesamte christliche Religion wie ein Kanon der Vertröstung vor. Das Leben wurde gestaltlos, das Überleben blindlings vorbildlich, auch wenn nichts mehr da war, dieses Überleben sinnvoll zu erfüllen.
In diese Zeit fiel der Tod jenes Freundes, mit dem ich jugendliche Reisen unternommen hatte. Ein mürrischer Melancholiker und Schwärmer, klein und kompakt, ohne fassbare Begabung und ohne Attraktivität, voller unausgefalteter Wünsche, hatte er erst eine Handvoll Valium eingeworfen, dann noch den Weg bis zur Bahnlinie gefunden. Sein Tod war eine sichere Sache, und jedenfalls konnte niemand sagen, er habe eigentlich rechtzeitig gefunden werden wollen.
Wenn ich später an meine Kindheit dachte, kam es mir vor, als sei dieser Freund immer mit einer offenen Seite durchs Leben gegangen. Seine Öffnung zum Tod war die geheime Lyrik seiner Persönlichkeit. Mit dieser Seite begriff er, mit dieser schwieg er, mit dieser sah er den kleinen Verlusten, dem Scheitern zu. An diese Seite wandten sich die großen, pathetischen Dichterworte, die er zitierte: »Große Götter, schaut auf unsere Tränen«, nach William Butler Yeats oder »Curae leves loquuntur, ingentes stupent« nach Seneca. Ja, leichte Sorgen reden, ungeheure schweigen.
Nicht nur das große tote Wort, selbst die Betrachtung des Erhabenen in der Natur, der alpinen Felsmassive oder der Brecher an der Nordsee korrespondierte mit der kleinen Tragödie seines Ablebens. Was er immer wieder gesucht hatte, das war dies sublime Zu-Nichts-Werden vor so viel aufgetürmter Kraft. Seine Ausflüge in die Landschaft – schlafwandlerische, ratlose Inspektionen – endeten immer wieder mit einer Mimikry ans Tote: Sie waren abgeschlossen, wenn die Tiere um ihn herum seine Gegenwart vergessen hatten und er selbst von seinem Atem keinen Gebrauch mehr zu machen glaubte. Ideale Stimmungen.
Wir zurückbleibenden Freunde aber haben seinen Tod nicht als Produkt einer Summe von Anlässen und Erschütterungen gedeutet. Er war in ihm immer schon anwesend gewesen, hatte sich mal gezeigt, mal verhüllt. Man könnte auch sagen, der Tod war das Wesen der Krise, in der der Freund existierte, er war der Zustand, in dem dieser leben und untergehen sollte.
Als Kind bewegt man sich in der Idee seines eigenen Todes wie der Angehörige einer Geheimloge. Da sich die erwachsene Umwelt erkennbar nur an der Organisation der Lebenspraxis abarbeitet und deshalb die Idee des Todes im Wahrnehmungsraum des Kindes ohne Wirklichkeit bleibt, wird ihm die Welt des Sterbens zum exklusiven Raum. Das Kind zieht sich in die Intimität seiner Gegenwelt zurück und bezieht Stärke aus der heimlichen Bereitschaft, jederzeit gehen zu können.
Kinder weichen ihrer Selbsttötung vielleicht aus, weil sie Besseres zu tun haben, weil es Geheimnisse gibt, die sie noch stärker faszinieren als der Tod es tut, oder sogar, weil die Schönheit des Todesgedankens verführerischer ist als der Tod selbst und er sie so auf paradoxe Weise am Leben hält. Das Kind lebte zu lange an einem Ort namens Mutterleib, lebte, als warte es auf die Feile im Brotlaib. Kinder haben sich an das Leben vielleicht noch nicht genug gewöhnt, um es für unverzichtbar zu halten. Es ist auch nicht ihr einziges, und es spricht vielleicht nicht einmal lauter als der Tod.
Vor die Leere des Nichts-Seins stellt man die Ideen der Wiedergeburt, der Auferstehung, der Erlösung der Seelen und des Aberglaubens: Die Toten sind nicht tot, sondern unter uns, und bei Hölderlin fällt einmal der tröstlich raunende Satz: »Es ist schön, dass es dem Menschen so schwer wird, sich vom Tode dessen, was er liebt, zu überzeugen, und es ist wohl noch keiner zu seines Freundes Grab gegangen, ohne die leise Hoffnung, da dem Freunde wirklich zu begegnen.«
Im frühen Leben regiert das Provisorische, die Aussicht auf das Mögliche, Eigentliche. Gefangen in einem Interim, dringt man nicht dazu vor, dieses Jetzt als die einzige zu machende Erfahrung zu identifizieren. Doch dann geht der Zustand des Noch-Nicht in das Zu-Spät über. Plötzlich steht die nicht erfahrbare Kulisse, plötzlich sind die nicht-korrigierbaren Züge im Gesicht, und was war dauerhaft in all der Zeit? Die Lust zu verschwinden, sich »um die Ecke zu machen, in den Duft«, wie Walter Serner gesagt hätte.
Im dörflichen Weichbild meiner Jugend existierten noch zwei Typen, die inzwischen verschwunden sind: Die einen waren die »Dorfbekloppten«, Verwirrte, Mongoloide, Schizophrene, dem religiösen Wahnsinn Anhängende, anderweitig zu Berücksichtigende. Eine von ihnen, meine Mitschülerin in der Volksschule, biss und spuckte ins Heft, wenn ihr eine Aufgabe unlösbar schien, ein anderer, sechs Körperjahre älter als wir, doch mit dem Gemüt eines Kindes, pflegte sich zu verabschieden mit den Worten:
»Auf Wiedersehen, hübscher Herr Lehrer, einen schönen Gruß auch an deine Mutter.«
Manchmal wurde er nach dem Unterricht über die Bank gelegt und mit dem Lineal verhauen. Dann trollte er sich, steckte nur den Kopf durch die Tür und schrie den Lehrer an:
»Geh die Orgel spielen!«
Eine klein gewachsene, immer riechende »mongoloide« Frau mit fröhlichem Kopftuch spielte gern auf der Straße und leitete das den Berg hinunterfließende Wasser im Rinnstein um. Manchmal versuchte sie es sogar mit ihrem Kopftuch einzufangen und schrie laut dazu.
Solche Störungen waren Teil der alltäglichen Wahrnehmung auf dem Dorf, und sie trugen dazu bei, dass wir die Wirklichkeit für eine Sache der Konvention hielten und uns dauernd mit Varianten konfrontiert sahen, Varianten zu denken, zu sehen, sich auszudrücken und zu agieren.
Es war die Zeit, in der man andere wie Ausschuss bezeichnen durfte, als schadhaft, mangelhaft, berieben und bestoßen, wie in den Auktionskatalogen. Es war die Zeit, da diese eine große Familie bildeten: die Kriegsbeschädigten, wie man sie nannte. Sie waren alle auch »Heimkehrer«, und so hingen diese beiden Zustände des Menschen, ein Heimkehrer und ein Beschädigter zu sein, als Kind für mich zusammen.
Als Kinder waren uns Verletzungen, die der Krieg mit sich bringt, nicht recht fasslich, aber dass da »Beschädigte« waren, Schadhafte also, das erschien uns, den anderen gegenüber, ungerecht, und so erfuhr auch unser Rechtsempfinden durch die Beobachtung der Humpelnden und auf Krücken Daherkommenden eine Korrektur.
Die Gestörten und die Beschädigten zogen ein Netz der Brüche durch die vorindustrielle Idylle des Dorfes. Sie waren das prägnanteste Indiz für die Anfälligkeit dieser Welt durch Erosionen von innen. Zerstört aber wurde diese Welt von außen, indem sie von ökonomischer Rationalität, Zweckmäßigkeit, Pragmatismus eingenommen, schließlich großflächigen Industriezonen eingemeindet und unterworfen wurde. Wir kamen nie wieder in ihr an. Das Verschwinden der Unvernunft hat diesen Lebensraum schließlich auch von innen zerstört.
Wenn ich allein an das Anwachsen des zeitlichen Horizonts in Kindertagen denke! Wie sich die Vergangenheit ausdehnte, wie die Zukunft Raum griff und ein »Immer und Ewig« berührte! Wie denkbar wurde, was jenseits der Lebenszeit lag, und wie die ferne Zukunft bedrohliche Schatten in die Gegenwart warf, so wie es der Krieg mit seinen Warnungen aus der Vergangenheit immer noch tat! Dieses Kinder-Ich wurde zusammengepresst auf ein Pünktchen in der Zeit, bestürmt von Vorläufer- und von Folgezeiten. Ich erinnere mich, wie ich kaum zehnjährig mit einer Klassenkameradin in einem Zugabteil saß und jemand den Tod, den fernen Tod erwähnte, den wir alle sterben würden, woraufhin die Klassenkameradin in Tränen ausbrach und wir alle versprechen mussten, in ihrem Beisein nie wieder, nie-nie wieder vom Sterben, vom Ende des Lebens und dem aller Zeiten zu sprechen. Sie kannte bisher nichts Endgültiges, wurde also erst durch Erzählungen befristet und wusste kein Mittel gegen den Tod, als das Erzählen von ihm zu unterbinden.