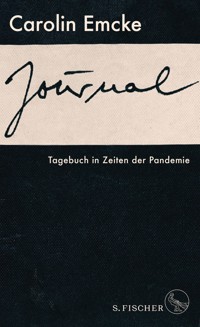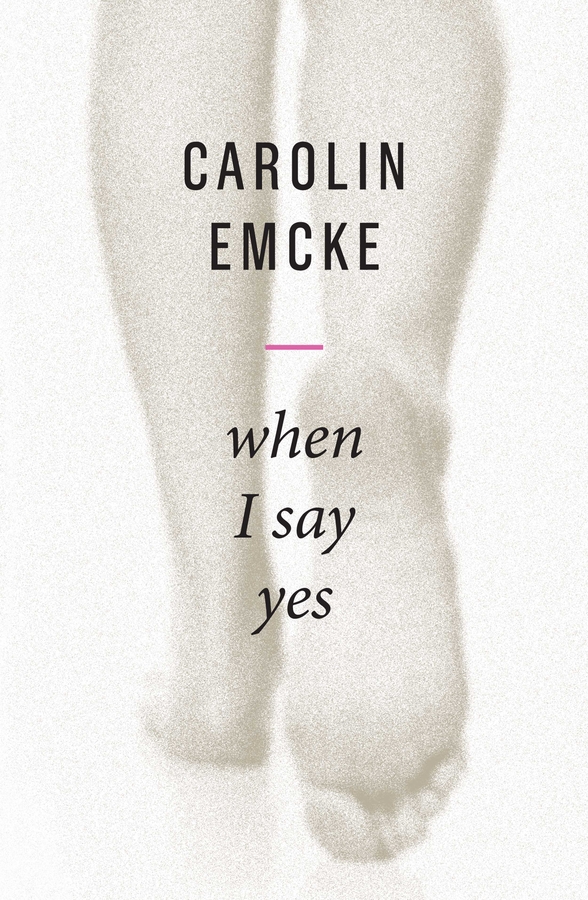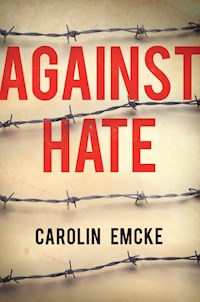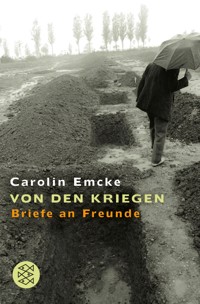
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unterwegs in den Krisengebieten der Welt – wie gehen Menschen mit Krieg und Gewalt um, was verändert sich angesichts des fremden Leids im Berichterstatter, welche Rolle kommt dem Zeugen zu? Carolin Emcke schreibt in ihren Briefen von Orten, die aus dem Blickfeld der Medien geraten sind, obwohl Krieg und Leid dort andauern: vom endlosen Bürgerkrieg in Kolumbien, von der Sklavenarbeit in den Freihandelszonen Nicaraguas, vom Überlebenskampf der Straßenkinder in der Kanalisation von Bukarest, von den serbischen Massakern an Kosovo-Albanern und den Vergeltungsanschlägen an Serben, dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September und den Kriegen in Afghanistan und im Irak. »Das Werk von Carolin Emcke wird Vorbild für gesellschaftliches Handeln in einer Zeit, in der politische, religiöse und kulturelle Konflikte den Dialog oft nicht mehr zulassen … ihr Werk mahnt, dass wir uns dieser Aufgabe stellen müssen.« Begründung des Stiftungsrats zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2016
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dr. Carolin Emcke
Von den Kriegen
Briefe an Freunde
Über dieses Buch
Unterwegs in den Krisengebieten der Welt – wie gehen Menschen mit Krieg und Gewalt um, was verändert sich angesichts des fremden Leids im Berichterstatter, welche Rolle kommt dem Zeugen zu? Carolin Emcke schreibt in ihren Briefen von Orten, die aus dem Blickfeld der Medien geraten sind, obwohl Krieg und Leid dort andauern: vom endlosen Bürgerkrieg in Kolumbien, von der Sklavenarbeit in den Freihandelszonen Nicaraguas, vom Überlebenskampf der Straßenkinder in der Kanalisation von Bukarest, von den serbischen Massakern an Kosovo-Albanern und den Vergeltungsanschlägen an Serben, dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September und den Kriegen in Afghanistan und im Irak.
»Das Werk von Carolin Emcke wird Vorbild für gesellschaftliches Handeln in einer Zeit, in der politische, religiöse und kulturelle Konflikte den Dialog oft nicht mehr zulassen … ihr Werk mahnt, dass wir uns dieser Aufgabe stellen müssen.«
Begründung des Stiftungsrats zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2016
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Die ursprünglichen Texte wurden von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt und für die Druckfassung von der Autorin überarbeitet
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2004 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg
Coverabbildung: Sebastian Bolesch
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490508-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Einleitung
Kosovo 1 (Juli 1999)
Die Aufgabe
Tod und Zerstörung
Spuren 1
Spuren 2
Kleine und große Gesten des Widerstands
Zeugen und Zeugenaussagen
Absurde Normalität
Roma
Ethnische Konflikte oder Zirkel der Gewalt
Libanon (Oktober 2000)
Wie wir reisten
Sichtblenden
Die Palästinenserlager
Hisbollah 1
Spurensuche
Diskussion um die libanesische Nation
Hisbollah 2
Hitler
Nicaragua (April 2001)
Verzweiflung 1
Verzweiflung 2
Die Aufgabe
Die Maquilas
Zeitschichten 1
Zu alt für die Prostitution
Chinesisches Nicaragua
Zeitschichten 2
Kosovo 2 (Oktober 2000)
Rückkehr wohin?
Wahltag
Nach dem Krieg/nach der Wahl
Serbische Enklaven im neuen Kosovo
Reisen zwischen den Zonen
Bücher 1
Bücher 2
Kein Vergessen, kein Vergeben
Power
Angelus novus
Rumänien (August 2001)
Der Auftrag
Bukarest
Liberté toujours
Weil es sauber ist
Wortschatz
Waisen
Genug Zeit, um eine Lektion zu lernen
Ohne Definition kein Verbrechen
Bogdan und die Menschenjagd auf den Straßen von Bukarest
New York/Pakistan/Afghanistan (September 2001–Februar 2002)
New York – ein Klagelied
Der Tag
Die erste Nacht
Pakistan und seine blinden Flecken
Cherat: die sandige Oberfläche der Verzweiflung
Die Anti-Baby-Pille oder Lügen in gegenseitigem Einvernehmen
Afghanistan – oder die Büchse der Pandora
Der Schleier oder Wer entscheidet über die Bedeutung der Burkha?
Osama – der Selbstmordattentäter in einem Kabuler Gefängnis
Grenzgebiet – oder Kafka in Pakistan
Deutsch – oder vielversprechend antisemitisch
Kriegsgebiete – von Tod und Normalität
Kolumbien (Oktober 2002)
Kolumbien
Bogotá oder die Details des Krieges
Uribe, Geld und der Kampf gegen den Terror
Catch 22 und der Ausnahmezustand 1
Rechtsfreie Zonen
Turbo und die Wandelbarkeit des Feindes
Montería und der Regen
Catch 22 und der Ausnahmezustand 2
Comuna 13, Medellín
Draußen
Rückkehr 1
Rückkehr 2
Nordirak/Irak (April 2002 – März/April 2003)
Die Reisen
Vom journalistischen Fehlurteil oder wie sich Kriegsgründe produzieren lassen
Vom gerechten und ungerechten Krieg
Das neue Jahr
Von denen, die auszogen, das Fürchten zu verlernen
Zwischen den Fronten
Der heimatlose Terrorist
Die amerikanische Landung
Luftkrieg
Asymmetrien oder eine Lektion in Toleranz
Der langsame, schleichende Krieg
»Embedded Journalism« oder die intelligenteste Form der Zensur
Kleine Gründe, die das Leben retten können
Der Sturz der Statue in Bagdad
Der eingebildete Konflikt zwischen Arabern und Kurden
Kirkuk
Nation-building ohne Manieren
Der Flüchtling
Danksagung
Editorische Notiz und Nachweise
Für Sebastian Bolesch
»Stumm ist nur die Gewalt.«
Hannah Arendt
Einleitung
»Aber das Eigene will so gelernt sein wie das Fremde.«
Friedrich Hölderlin
Am Anfang war nur Sprachlosigkeit.
Nach anderthalb Monaten in Albanien und im Kosovo während des Krieges kam ich im Sommer 1999 nach Berlin zurück und wusste meinen Freunden nichts zu erzählen.
Wie sollte ich das Erlebte in Worte fassen, die sie nicht abschreckten? Wie diese Begegnung mit Tod und Zerstörung beschreiben? Wie sollte ich erklären, dass Krieg und Gewalt sich in uns einnisten?
Meine Freunde wussten nicht zu fragen, und ich wusste nicht zu antworten.
Im Versuch, diese Sprachlosigkeit zu überwinden, ist der erste Brief entstanden, den ich per E-Mail an einen Kreis von vielleicht zwanzig Freunden verschickte.
Ich wusste damals noch nicht, dass aus diesem Bedürfnis, meinen Freunden von dem Krieg und seinen Opfern zu erzählen, nach und nach ein Ritual werden würde: Nach jeder eindrucksvollen Reise schrieb ich einen Brief.
Ich wusste damals auch nicht, dass dieses Brief-Schreiben am Ende weniger eine intellektuelle als eine kathartische Funktion erfüllen würde. Mehr und mehr wurden die Briefe zu einer brauchbaren Form, über das Erlebte noch einmal nachzudenken und mir so die Rückkehr in mein Berliner Leben zu erleichtern.
Die Briefe basieren alle auf Reisen, die ich im Auftrag des »Spiegel« in den Jahren von 1999 bis 2003 unternommen habe. Über alle Reisen habe ich journalistische Artikel geschrieben, die sich in einzelnen Passagen und Szenen auch in diesen Briefen wiederfinden.
Nicht alle schildern die kriegerischen Ereignisse selbst, manche erzählen auch von deren Folgen, den verwüsteten inneren und äußeren Landschaften. Sie erzählen von Wut, die immer wieder auflebt, von Verwundung, die nicht heilen will.
Zwei Briefe, über Rumänien und Nicaragua, handeln nicht von den Kriegen im engen Verständnis. Sie thematisieren strukturelle Gewalt, nicht unmittelbar physische oder militärische.
In allen Briefen, die ich schrieb, wollte ich etwas mitteilen, das über die klassische Berichterstattung hinausgeht. Die Gattung des Briefes gestattete mir, unterschiedliche Erzählformen zu mischen: Sehr persönliche Passagen wechseln mit eher essayistischen Reflexionen, politischer Kommentar wird durchbrochen von szenischen Reportageelementen.
Vermutlich hätte ich so nie schreiben können, wenn ich immer schon an eine Veröffentlichung gedacht hätte.
Aber ich hatte an Freunde geschrieben: Intellektuelle und Künstler aus aller Welt, unterschiedlicher religiöser und kultureller Herkunft, die ich in den vergangenen 15 Jahren kennen gelernt hatte. Anfangs hatte ich kein klares Konzept vor Augen. Ich erzählte einfach von den Reisen, von dem, was mich umtrieb, was mich nicht losließ, ich versuchte, ihre stummen Fragen zu beantworten: Welche Motive mich leiteten, in diese Gebiete zu reisen? Wie neutral ich dabei sein könne?
Im Laufe der Jahre haben sich dann bestimmte Themen herauskristallisiert: der Krieg, seine Opfer und der Zeuge.
Die Briefe legen Zeugnis ab auch über mich, die Zeugin selbst. Es gab Gründe, diese persönliche Anschauung bei einer Veröffentlichung nicht aus den Briefen zu entfernen. Immer wieder haben meine Freunde, die die Briefe lasen, mit Erstaunen und Entsetzen reagiert: Das hätten sie sich so nicht vorgestellt. Das hätten sie nicht gewusst.
Alle meine Freunde sind politisch interessiert und gut informiert, und dennoch schienen ihnen die Briefe einen besonderen Blick auf die kriegsbedingte Zerstörung an den Rändern der Welt zu ermöglichen.
Susan Sontag schreibt in ihrem Buch »Das Leiden anderer betrachten« von einem Phänomen, das auch ich an meinen Freunden entdecken konnte: Die Zuschauer oder Leser, die jeden Tag von Berichten aus Krisenregionen in der ganzen Welt überflutet werden, sehen zwar die Bilder des Grauens – aber mit der Zeit stumpfen sie ab, sie können die Nachrichten nicht in einen für sie anschaulichen Zusammenhang bringen, und am Ende glauben sie nicht, dass sie wirklich einer Realität entsprechen.
In diesem Sinn können Briefe von einem Zeugen, den man sich vorstellen kann, der auch von sich erzählt, von dem eigenen Umgang mit der Gewalt, von jemandem, der pendelt zwischen den Welten, jemandem, der auch mitteilt, was beschämend ist, was misslingt, was unerträglich ist, unversehens zu einem glaubwürdigen Dokument von den Kriegen und ihren Opfern werden.
Berlin/New York, im Februar 2004
Carolin Emcke
Kosovo 1 (Juli 1999)
»War kills. That is all it does.«
Michael Walzer
Liebe Freunde,
seit zwei Wochen bin ich zurück.
Auf Fragen nach der Zeit in Albanien und im Kosovo weiß ich nichts zu antworten – als ob ich nicht da gewesen oder nicht angekommen wäre.
Die Erfahrungen sind präsent, die Bilder, Gerüche, der Lärm – alles ist deutlich und lässt sich doch nicht in eine zutreffende und verständliche Erzählung des Grauens verwandeln.
Wir glauben gern daran, dass es uns möglich ist, Gefahren zu entschärfen, wenn wir ihnen einen Namen geben können. Rumpelstilzchen verliert seine Macht, wenn wir erraten, wie es heißt. Doch manchmal tobt und wütet Rumpelstilzchen, selbst wenn wir wissen, wie es heißt. Manchmal vermag das Wort nicht zu bannen, und sein Ungenügen verstärkt nur die Trauer über das Erlebte.
Vielleicht weiß ich auch nur nicht recht, wo beginnen.
Vor Ort, in den Flüchtlingslagern, in denen die Vertriebenen verharrten, stumm – die Männer auf dem Boden hockend und rauchend, unter bunten Wolldecken verkrochen, die Frauen über kleine Waschbottiche aus Plastik gebeugt im Schlamm, später auf den Feldern, auf denen die Leichen in der Sonne verwesten, in den Krankenhäusern mit diesem unnachahmlichen Geruch nach Desinfektion und Tod, auf den überquellenden Marktplätzen, in den verwüsteten Moscheen, hatten wir, ob Fremde oder Einheimische, den gleichen Erfahrungshorizont.
Wir waren in der gleichen Welt alltäglichen Elends und unaufhörlicher Zerstörung. Innerhalb dieses Umfeldes hatten all die entsetzlichen Einzelszenen einen »Sinn«. Nicht, dass uns nicht permanent alles unwirklich erschienen wäre. Aber es war gleichzeitig zu real, als dass wir es ununterbrochen hätten in Frage stellen können. Unsere Gespräche und Gebärden waren ja eingelassen in diesen Kontext. Es war ein Leben im gemeinsamen Radius der Gewalt.
Erst hier, wieder zurück in Berlin, jetzt, da es darum geht, von jener Zeit zu erzählen, wird deren Absurdität zugleich spürbarer und unverständlicher.
Rückblickend kann ich sagen: Diese Erlebnisse waren von unserer hiesigen Erfahrung abgetrennt wie der Teig, den ich als Kind mit einer Keksform auf dem Backblech meiner Großmutter ausstach. Möglicherweise erklärt das, warum Journalisten im Zerrbild kritischer Anmahnungen oft als zynisch gelten: Weil die Wirklichkeit, über die sie sprechen, ein Zerrbild der Wirklichkeit, die wir kennen, zu sein scheint.
Das ist die Last des Zeugen, stets mit einem Gefühl des Unangemessenen, der Leere zurückzubleiben, weil selbst der akkurateste Bericht die Trostlosigkeit des Gesehenen nicht einzufangen vermag.
Die Aufgabe
Wir waren in Tirana, als das Friedensabkommen unterzeichnet wurde und die serbische Delegation zustimmte, binnen 48 Stunden nach Inkrafttreten des Vertrags sämtliche Einheiten aus dem Kosovo in die verbliebene Rumpfrepublik Serbien und Montenegro abzuziehen. 78 Tage hatte der Luftkrieg der NATO-Allianz gedauert, in dem sie Angriffe geflogen hatten gegen Regierungsgebäude in Belgrad, gegen Stellungen der serbischen Armee im Kosovo – aber auch gegen zivile Einrichtungen: Brücken, Fabriken, Elektrizitätswerke, die Fernsehstation von Belgrad und mehrere Flüchtlingstrecks, »Kollateralschäden«, wie es die Propaganda-Behörde in Brüssel nennen sollte.
Mit dem Ende des Krieges konnten wir schließlich, gemeinsam mit den bisher untätig gebliebenen Bodentruppen der Allianz und Tausenden Kosovo-albanischer Flüchtlinge, in das Kosovo einreisen und von dort aus schreiben.
Unser Team im Kosovo bestand aus unserem albanischen Fahrer Kujtim Bilali, seinem Neffen und unserem Dolmetscher Noni Hoxha, Joanne Mariner von der Organisation Human Rights Watch, die wir in den albanischen Flüchtlingslagern kennen gelernt hatten, dem Photographen Sebastian Bolesch und mir.
Wir blieben zwei weitere Wochen im kriegsversehrten Kosovo und reisten durch die ganze Region. Wir sahen, wie die Kosovo-albanischen Jungen und Männer, die sich vor den Schwadronen der Serben versteckt hatten, nun aus den Bergen zurückkehrten und aus den Kellerverliesen hervorkrochen. Wir sahen verhungerte Kosovo-albanische Gefangene mit tief liegenden Augen auf einem Lastwagen angebunden. Sie sollten nach Serbien verschleppt werden und waren vergessen worden. Wir sahen, wie Kosovo-Albaner das Ende der Unterdrückung feierten. Wir sahen allerorten, wie die serbischen Einheiten gewütet hatten: Die verkohlten Höfe, die demolierten Minarette der Dorfmoscheen, wir sahen die verstümmelten Leichen, dort, wo für die serbischen Schergen die Zeit zu knapp geworden war, um die Spuren ihrer Taten zu beseitigen und die Opfer zu verscharren. Wir sahen die serbischen Truppen auf ihrem Rückzug, betrunken vom geraubten Schnaps. Aber wir sahen auch, wie serbische Zivilisten flohen aus Angst vor Vergeltung. Wir sahen die Viertel der unbeteiligten Roma in Flammen aufgehen.
Tod und Zerstörung
Seit meiner Rückkehr werde ich gefragt: »Wie verarbeitet man das Erlebte? Wie wird man damit fertig?«
Die Antwort lautet: »Gar nicht.«
Manche Eindrücke lassen sich nicht »verarbeiten«.
Der Anblick eines siebzehnjährigen Kosovo-albanischen Mädchens im Krankenhaus von Prizren im Kosovo, das am Tag vor dem Einmarsch im Kosovo von einem Heckenschützen angeschossen wurde. Sie hatte eine Gehirnverletzung und hätte zur Operation nach Priština ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Seit jener Nacht lag sie in einem Zimmer mit fünf schwer verletzten Männern: Serben, UÇK-Kämpfer und Albaner, die Feinde des Krieges versammelt in einem überhitzten Raum.
Man konnte sie atmen hören.
Sie würde vermutlich im Laufe der nächsten fünf Stunden sterben: Das Krankenhaus konnte sie nicht nach Priština transportieren – die serbischen Truppen hatten den einzigen Krankenwagen für ihre Flucht nach Kriegsende gestohlen.
Der Anblick des verkohlten Rückens eines toten katholischen Kosovo-Albaners zwischen Hunderten von Büchern in seinem Haus in Koronica. Die Muskeln in dem zusammengeschrumpften Leib waren noch zu erkennen – es sah aus wie auf einem jener Schaubilder aus dem Biologieunterricht, auf denen schematisch alle Muskeln des Körpers abgebildet waren. Nur war der Mann in Koronica schwarzbraun, sein verbranntes Fleisch hatte eine poröse Konsistenz und sah behaart aus wie ein kratziger Pelz. Arme und Beine fehlten – vielleicht hatte man sie ihm abgeschnitten, vielleicht waren sie völlig verbrannt, vielleicht waren auch die Hunde schuld.
In der Ilias fürchten die homerischen Helden weniger den Tod als die Vorstellung, in der Fremde, außerhalb der eigenen Stadtmauern, unbeerdigt den streunenden Hunden ausgeliefert zu sein. Es schien mir bei der Lektüre stets die abstruse Furcht eines Lebenden zu sein, der seinen Leichnam nicht von Hunden zerfleddert wissen möchte. Ich konnte mir eine Welt nicht vorstellen, in der Hunde mit menschlichen Gliedmaßen im Maul durch die Straßen traben könnten.
Zu dem Paket aus verdorrtem Fleisch brachte uns der Bruder des Toten. Er ging von Raum zu Raum mit uns, in einem bröckelnden Haus aus Schutt und Asche, und sprach, als ob es noch stünde und als ob das Bündel auf dem Boden noch irgendetwas mit dem Menschen zu tun hätte, mit dem gemeinsam er aufgewachsen war.
Auch nicht verarbeiten lässt sich: Der Anblick von Leichen ohne Kopf, von abgetrennten Körperteilen, von verrenkten Leibern, die man gefesselt hinter einem Lastwagen hergeschleift hatte (auch das wie ein homerisches Zitat); der Anblick von aufgedunsenen oder verbrannten Leichen, solchen, die zwei Monate alt waren, eine Woche, einen Tag.
Die Rede von »Massengräbern« ist irreführend. Meist findet man einfach Leichen, die seit Wochen in der Sonne lagen … Im »besten« Fall haben die serbischen Einheiten die Toten in ihren Häusern verbrannt. Für den Augenzeugen noch der schonendste Anblick.
Und ich kann auch dieses Bild nicht vergessen: Den Fuß einer männlichen Leiche, die auf einem Feld bei Meja im Gebüsch lag. Ich erinnere mich noch gut an die fünf Zentimeter zwischen dem schwarzen Lederschuh am rechten Fuß und der blauen Baumwollhose, die zu dem Körper ohne Kopf und Arme gehörte. Der, der einmal gewesen war, trug eine blaue Jacke und eine blaue Hose, eine Art Bauernkluft, wie ich sie während der nächsten beiden Wochen bei so vielen getöteten Kosovo-albanischen Zivilisten sehen sollte. Die Leiche lag dort, offensichtlich unbemerkt, seit dem 27. April.
In der Zwischenzeit hatte es vermutlich geregnet, und es war so heiß gewesen, wie es im Sommer in Jugoslawien eben sein kann. Eine Schlange huschte in dem Geäst der Böschung herum, und überall lag Abfall, achtlos hingeworfen wahrscheinlich lange vor dem Massaker.
Es ist vor allem ein Bildausschnitt, der mich nicht loslässt, ein kleines Detail: die fünf Zentimeter zwischen dem zugeschnürten Schuh und dem Hosensaum. Ohne die Kleidung, die zeigte, dass dies irgendwann einmal ein Mann gewesen war, gab es nur fünf Zentimeter totes, lebendes Fleisch. Sonst nichts.
Und da war dieses Geräusch, ganz leise, zunächst unbemerkt, und dann so penetrant in seiner Widerwärtigkeit, dass kein noch so wirksames Tabu, keine tief sitzende Scham seine Wahrnehmung hätte unterdrücken können: Eine Vielzahl von Parasiten fraß sich ungestört durch den Rest eines Menschen.
Und ich kann das zehnjährige Mädchen in Gjakova nicht vergessen, das vor den ausgebrannten Trümmern seines früheren Hauses stand und keine zwei zusammenhängende Sätze herausbrachte. Sie redete ohne Unterbrechung, als ergebe ihre Rede einen Sinn, sie stockte nicht, sie hielt auch nicht inne, sie reihte einen wirren Satz an den nächsten.
Schließlich konnten wir ihren Äußerungen doch entnehmen, dass in diesem Haus ihr Vater, ihr Bruder, ihre Tante und zwei Cousins ums Leben gekommen waren. Ihr Onkel und zwei andere Brüder waren von serbischen Einheiten festgenommen worden, und man hatte sie vermutlich am Tag vor dem Einmarsch der NATO-Truppen verschleppt.
Sie erzählte uns, stockend, sich verhaspelnd, ihr Vater habe sich das Bein gebrochen, als sie die lang herbeigesehnte NATO-Intervention feierten. Er war im Jubel über die eintreffenden Kampfflugzeuge auf dem Dach herumgesprungen und vom Dach gestürzt. Er konnte sich kaum bewegen, als die serbischen Soldaten kamen. Sie sagten dem Mädchen und seiner Mutter, sie sollten das Haus verlassen. Anschließend brachten sie die verbliebenen Männer in ihren eigenen Räumen um und zündeten das Haus im alten Stadtkern von Gjakova an.
Ich kann nicht vergessen, wie sie da stand in ihrem rosafarbenen Hemdchen, vor den Trümmern ihrer ehemaligen Wohnzimmerwand, auf ein paar Mauersteinen, leicht schief, weil es keinen ebenen Boden mehr gab; ich kann nicht vergessen, dass sie nicht richtig sprechen konnte, dass sie zeitweise uns nur wortlos anstarrte, dann weiter sprach und dass sie so gar nicht wütend wirkte.
Sie war still und ruhig, nur hin und wieder schien sie irritiert, wenn sie bemerkte, dass sie das Kunststück nicht mehr beherrschte – jenes Kunststück, das man ihr vor vielen Jahren, in einer anderen Zeit, beigebracht hatte: Wie man Sätze bildet und anderen etwas Sinnvolles mitteilt. Dann hielt sie inne und beobachtete sich wie eine Fremde und schien von außen sich selbst sagen zu wollen, dass diese Worte, die da aus ihrem Mund kamen, unverständlich seien.
Wir waren in gewisser Weise benachteiligt gegenüber anderen Journalisten, die Zeugen solcher Bilder von Tod und Zerstörung wurden. Wir waren schon eingebunden in das grausige Geschehen. Viele Reporter waren erst nach Albanien oder Mazedonien geflogen, als das Friedensabkommen unterzeichnet war und die NATO-Truppen ins Kosovo einrücken sollten. Wir dagegen hatten seit April über die Vertriebenen und ihr Schicksal berichtet, wir hatten in den behelfsmäßigen Unterständen oder im Freien auf der Erde gesessen und ihnen zugehört: Wie ihre Ehemänner und Söhne ums Leben gekommen waren, was sie vor Beginn der Krise getan hatten, wo sie gewohnt hatten, wie sie geflohen waren, wie viele Stunden sie bis zur Grenze gewandert waren, wann sie zum letzten Mal den Bruder gesehen hatten, wo sie gestanden hatten, als ein serbischer Offizier eine Frau aus dem Flüchtlingstreck geholt hatte, wie sie sich in Scheunen versteckt hatten.
Als wir schließlich nach Kriegsende im Kosovo waren, wussten wir genau, wohin wir fahren mussten und was uns dort erwartete. Wir hatten eine Landkarte des Tötens im Kopf, bevor wir an die Orte selbst kamen.
Doch das bedeutete auch, dass wir nicht einfach beziehungslos vor den Leichen anonymer Menschen standen. Nachdem wir in den albanischen Lagern so viele Flüchtlinge befragt hatten, kannten Sebastian Bolesch und ich bei manchen Toten die zugehörige Geschichte, ihren Namen und ihr Alter, wir wussten, ob Ehefrau oder Tochter in einem Lager jenseits der Grenze überlebt hatten oder verschollen waren.
Ich konnte mir die Leichen vor meinen Augen als Väter und Brüder vorstellen, als Bauern auf dem Feld, als Schriftsteller. Ich konnte mir ihr früheres Leben ausmalen, und manchmal kannte ich sogar ihre Angehörigen oder Nachbarn in Albanien.
Abstand ließ sich so nicht gewinnen.
Aber es war gleichwohl auch versöhnlich: sich an den wirklichen Menschen zu erinnern, den lebenden Vater oder Bruder oder Cousin oder Nachbarn; ihre Geschichte zu erfragen und dann zu erzählen; an eine Welt zu denken, die zerstört und ausgerottet werden sollte, jedem dieser stinkenden, gesichtslosen Knochen wieder einen Namen zu geben; sich nicht angewidert abzuwenden.
Spuren 1
Die serbischen Truppen sind in der Nacht zuvor abgezogen, die NATO-Truppen passieren mit ihren Panzerfahrzeugen den verlassenen serbischen Posten. Die knirschenden Kettenräder wirbeln Staub auf und tauchen alles in eine grau-gelbe Wolke.
Die ungeduldigen albanischen Sieger, die gar nicht an sich halten können vor Freude und Sehnsucht, wollen schneller vorankommen, als es der langsame Konvoi der Armeefahrzeuge vor ihnen zulässt. Zu Tausenden stehen sie wartend in ihren Wagen und Traktoren am Rand und sehen, wie sich die Karawane der westlichen Helfer an ihnen vorbeiwindet auf der Passstraße hoch nach Molina und dann durch das Nadelöhr des ehemaligen Checkpoints.
Hunderte stehen an der Schranke, hinter dem Stacheldraht, und die Unruhe treibt sie mehr und mehr herunter von der sicheren asphaltierten Straße. Rechts und links der Grenzanlagen haben die serbischen Verlierer kleine Willkommensgeschenke für die albanischen Rückkehrer ins verdorrte Gras und Gebüsch platziert: Glücklicherweise ist der Sommer ein freundlicher Helfer, und so ist der versteckte Tod doch erkennbar, weil sich das Grün oder Grau der Minen etwas dunkler abhebt vom ausgebleichten, vertrockneten Boden.
Am Grenzübergang tanzen die Kosovo-Albaner in den winzigen Büroräumen der ehemaligen serbischen Feinde. Bald bersten Scheiben. Die vormals unterdrückte Furcht der Opfer bahnt sich ihren Weg: Die tumbe, stumme Hilflosigkeit der Männer, die verdammt zum Nichtstun in den Lagern in Albanien auf der Erde hockend, gierig an den Stummeln ihrer Zigaretten gesogen hatten, sie entlädt sich nun in der Freude an der Macht der Zerstörung. Stühle werden umgestürzt, Tische zerstört. Eine jaulende Menge, jubelnd über den Sieg und weinend über den Preis zugleich. Wütend über die Demütigung erst jetzt, da sie vorbei ist.
Zorn ist ein Luxus, den man sich erst in Freiheit leisten kann.
In einer Ecke, neben dem Grenzhäuschen an einer Mauer, liegt ein Blechhaufen, unbeachtet von der johlenden Menschenmenge, die sich durch den Checkpoint presst. Zwischen den Splittern aus Glas, überdeckt mit Staub, liegen Hunderte Auto-Nummernschilder. Die Ecken verkantet, abgerissen von der Plastikverankerung der Autos.
Nicht genug, dass die Kosovo-albanischen Frauen und Kinder von den Höfen und aus den Dörfern gezerrt und vertrieben wurden, nicht genug, dass ihnen auf der Strecke marodierende Banden der serbischen Miliz ihre Wertgegenstände, Schmuck, Ringe und das spärliche Bargeld geraubt hatten. Auf dem letzten Posten, bevor sie in ein fremdes Land verjagt wurden, vollendeten die serbischen Grenzpolizisten die Arbeit und nahmen den Flüchtlingen auch noch den letzten Nachweis dafür ab, dass sie jemals in der jugoslawischen Provinz Kosovo zu Hause gewesen waren. Sämtliche Personalausweise, Grundbucheintragungen und Besitzzertifikate, die die Vertriebenen in weiser Voraussicht mitgenommen hatten auf ihrer Flucht, wurden einkassiert – und die Nummernschilder, die die Wagen oder Traktoren im Kosovo registriert hatten, abmontiert.
Diese perfide Strategie war mehr als nur symbolische Gewalt, es ging nicht allein um eine Demonstration der Macht oder um die Demütigung der ohnehin Schutzlosen in dieser sich ewig wiederholenden Szene am Grenzposten.
Ob die Beamten an der Grenze auf Befehl der nächsthöheren Instanz agierten oder ob es sich um eine Maßnahme allein an diesem Übergang handelte, vermag ich nicht zu sagen. Aber die Aktion war systematisch genug, um die Absicht durchscheinen zu lassen: Nie sollten die Flüchtlinge ein Recht auf Rückkehr behaupten können. Keinen Beweis ihrer Heimat im Kosovo sollten sie retten können.
Die Berechtigung der Rede vom Genozid im Kosovo lässt sich anzweifeln, doch die koordinierte Aussonderung einer Bevölkerung, die Apartheids-Maßnahmen, durch die den albanischen Kosovaren der Zugang zu Universitäten, Schulen, Arbeitsmarkt mehr und mehr verschlossen wurde, die kollektiven Vertreibungen, die internationale Menschenrechtsgruppen schon lange vor dem NATO-Bombardement dokumentiert hatten – und schließlich der massenhafte Exodus und die Zerstörungen und Morde seit März, dies alles hatte einen systematischen Charakter, weil es der Auslöschung der Spuren einer ethnischen Identität diente.
Spuren 2
»Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt.« (2. Moses, 12/13) Das blutige Zeichen an den Häusern der christlich-orthodoxen Serben war meistens aus schwarzer Farbe, gepinselt oder gesprayt, sechs Mal mussten sie ansetzen, um die Schrift an der Wand zu vollenden, zwei sich kreuzende Linien und vier Halbkreise (der Buchstabe »c«, in Kyrillisch »s«) in den Ecken. Das serbische Kreuz mit seinen vier »S«, »Samo Sloga Spasi Srbiju«, übersetzt: »Nur die Einheit rettet Serbien«, sollte das Verderben von ihren Häusern abwenden.
Das ist eine archetypische Symbolik, die Einschluss und Ausschluss, den Schutz der eigenen Leute und die Auslieferung der anderen anzeigt. Ob es das Blut am Türpfosten, die Schrift an der Wand oder das Wörtchen »Shibboleth« ist, das die Einheimischen aussprechen können, aber die Fremden nicht – zahlreich sind die biblischen Geschichten und die historischen Beispiele sowohl für die Rettung derer, die sich als zugehörig erklären können, als auch für die Verbannung der anderen, die die Zeichen nicht kennen. Die Religionen oder Kulturen unterscheiden sich nicht darin.
In dem Grauen dieses Krieges waren es schließlich jene kleinen feigen Zeichen an den Wänden serbischer Häuser, die mich am nachhaltigsten angewidert haben.
Während ihre albanischen Nachbarn zu Tausenden in die Berge flohen, während die serbischen Milizen Kinder und Frauen wie Vieh aus ihren Häusern zerrten, während albanische Männer vertrieben, verschleppt oder erschossen wurden – hatten einige serbische Zivilisten nichts Besseres zu tun, als ihr Haus mit dem serbischen Kreuz zu markieren?
Das Wort »Barbarei« soll im heutigen Sprachgebrauch meist eine besonders verabscheuungswürdige archaische Art von Mord und Totschlag kennzeichnen – eine fragwürdige Verwendung, als wären nicht alle Morde »barbarisch«. Als seien die technischen Feinheiten des zeitgenössischen Mordens eine moralische Errungenschaft, als seien die Massenvernichtungswaffen der Ersten Welt gesitteter als die Macheten der Hutu in Ruanda.
Dabei sind Barbaren all jene, die die moralischen Grundlagen gemeinsamer Zugehörigkeit verleugnen. Also nicht erst das Brandstiften ganzer Straßenzüge, nicht erst der Nackenschuss des gefesselten Albaners indiziert das Barbarische, sondern schon all die kleinen Handlungen, die den Nachbarn aussondern.
Kleine und große Gesten des Widerstands
Anlässlich meines 18. Geburtstags schrieb mir eine Freundin und Mentorin einen Rat auf eine kleine weiße Visitenkarte, die sie mir, beinahe heimlich, über den Tisch des Restaurants, in dem wir feierten, schob. Darauf stand: »Worauf es ankommt im Leben? Menschenwürdige Verhaltensweisen unter Umständen zu zeigen, die das Gegenteil nahe legen.«
Es sind nicht immer die großen Taten, wie es uns Bücher und Filme suggerieren, die in Zeiten des Krieges einen Unterschied machen können. Manchmal sind es nur kleine Gesten.
W. E. Sebald schreibt in seinem umstrittenen Buch »Luftkrieg und Literatur« von einer Frau, die inmitten einer Trümmerwüste nach den Luftbombardements vor ihrem intakten Haus stand und Fenster putzte. Primo Levi berichtet von einem ungarischen Mitgefangenen in Auschwitz, der Levi dazu drängt, sich aller Aussichtslosigkeit zum Trotz zu waschen.
Was wie ein Mangel an moralischem Empfinden, wie eine zynische Abstumpfung gegen das Leid ringsherum wirken könnte, ist oftmals ein Ringen um einen letzten Rest von ethischen oder auch nur ästhetischen Standards aus dem früheren Leben.
Manchmal retten sich Individuen durch die Zuneigung zu jemandem, um den sie sich kümmern müssen, manchmal durch den Zorn auf die ungerechten Umstände, manchmal ist es eine Fähigkeit, ein »Habitus«, der hilft, der unmenschlichen Wirklichkeit zu begegnen, manchmal ist es eine Metaphysik, der Glaube an eine andere Ordnung, der der Realität ihre Wirkmacht nimmt.
Drei Personen, die »menschenwürdiges Verhalten unter Umständen gezeigt haben, die das Gegenteil nahe gelegt hätten«:
Kujtim:
Kujtim war mein Fahrer und wurde ein Freund. Wir lernten ihn unter abenteuerlichen Umständen im April auf der ersten Albanienreise kennen.
Mein Kollege Klaus Brinkbäumer und ich waren von Skopje in Mazedonien zur albanischen Grenze gefahren. Nach dem Grenzübertritt hatten wir auf der albanischen Seite einen Taxifahrer angeheuert und ihn gebeten, uns in den Norden nach Kukes zu bringen. Nachdem wir stundenlang auf holprigen, kurvenreichen, staubigen Straßen durch das Gebirge gefahren waren, hielt der Fahrer plötzlich an und stieg ohne ein einziges Wort der Erklärung aus dem Auto. Ungläubig und etwas paralysiert sahen wir zu, wie er sich an die Schotterstraße stellte und winkte, um irgendein Auto anzuhalten. Als nach einiger Zeit ein grauer, voll beladener Mercedes stehen blieb, sprach er mit dem Fahrer und wandte sich dann zu uns: Er könne nicht weiterfahren, aber dieser Wagen werde uns in den Norden bringen. Bevor wir Nein sagen konnten, hatte er unser Gepäck in den Kofferraum verfrachtet, und wir befanden uns in einem überladenen Auto unter wildfremden Menschen. Keiner der Insassen, ein älterer Mann und zwei Mädchen, sprach irgendeine Sprache, die wir hätten verstehen können. Wir wussten weder, wo exakt wir uns befanden, noch ob der grauhaarige, schweigsame Fahrer überhaupt vorhatte, den Ort Kukes im Norden Albaniens anzusteuern.
Es war Nacht geworden, wir saßen eingequetscht auf der Rückbank, in der Dunkelheit ließ sich nicht einmal bestimmen, in welche Richtung wir fuhren. Alle halbe Stunde hielt der Wagen an und eines der jungen Mädchen musste aussteigen und erbrechen. Die Serpentinen schienen sich unendlich um ein Bergmassiv nach dem Nächsten zu winden, selten flackerten spärliche Lichter, vereinzelt, aus den Schluchten und Tälern: isolierte Gehöfte, keine Dörfer, die wir passierten.
Wortlos verging eine Pause an einem hölzernen, zweistöckigen Verschlag in einer der zahllosen Kurven. Unser Fahrer schob uns in die Hütte, in der Zigaretten und Hefegebäck angeboten wurden. Über eine Leiter führte mich eine Frau in ein türloses Obergeschoss. Etwas orientierungslos in der finsteren Umgebung fand ich, was als Klo herhalten musste.
Nach sechsstündiger Fahrt erreichten wir im Stockdunkeln eine Kleinstadt. Der Fahrer hielt vor einer Bar, bedeutete uns, wir sollten hineingehen, und kam zehn Minuten später mit einem Jungen wieder, der fließend Englisch sprach. Es war Noni, sein Neffe. Durch ihn stellte sich der Mann, der uns nun schon durch halb Albanien gefahren hatte, als »Kujtim« vor und ließ Folgendes übersetzen: »Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr kommt aus dem Ausland. Euer Fahrer war ein Schuft, da er euch mitten in einem Land ausgesetzt hat, das ihr nicht kennt. Aber ihr beiden wart in meinem Auto, und ihr habt euch die ganze Zeit unterhalten und gelacht. Jeder andere wäre völlig verängstigt gewesen. Ihr habt junge, reine Seelen! Ich mag euch!« Dann organisierte er eine Übernachtungsmöglichkeit für uns in einer Wohnung, lud uns zum Abendessen ein und fragte, wie er behilflich sein könnte.
Dieses erste Mal war Kujtim zwei Wochen lang unser Fahrer.
Er hatte graue, leicht krause Haare, trockene Hände und eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen, in die er bei guter Laune seine Zigarette klemmte. Es blieb ein bisschen unklar, womit Kujtim vor dem Krieg sein Geld verdient hatte. »Handel« war die vielsagende Antwort. Er war ein begeisterter Anhänger der UÇK und schien in der Region alle zu kennen, die legal oder illegal etwas zu sagen hatten. Er lebte von Kaffee und Zigaretten, und ab und an, unabhängig von der Tageszeit, verlangte das Gemüt nach einem Glas Raki. Kujim konnte wunderbar tanzen, mit einem Taschentuch in der rechten Hand, die ganze Reihe der im Halbkreis ihm nachtanzenden Männer dirigierend. Er sang nicht nur die traditionellen albanischen Lieder, die aus seinem Kassettenrekorder knatterten, mit, sondern auch die traurigen Widerstandslieder aus dem Kosovo. Seit Beginn der Krise hatte er in seiner Wohnung elf fremde Flüchtlinge aufgenommen. Von seinem Tageslohn für das Chauffieren kaufte er Wasser und Brot und Kaffee und Seife für die Obdachlosen, die bei ihm Zuflucht gefunden hatten.
An dem Tag, als wir ihm zum ersten Mal begegnet waren, hatte er die drei Leute in seinem Auto von Kukes nach Tirana gebracht (eine Fahrt von mindestens zehn Stunden), damit sie in den anderen Lagern nach ihren Angehörigen suchen konnten.
Als ich nun im Juni wieder nach Albanien kam, wollte ich außer Kujtim niemanden bei mir haben. Ich suchte ihn. In einem Ort ohne Telefonverbindungen oder Internet wie Kukes brauchte ich eine halbe Stunde, bis ich jemanden gefunden hatte, der mein stotterndes Albanisch verstehen konnte und der ihn kannte. Zehn Minuten später stand er mit Tränen in den Augen vor mir. Nach einer weiteren halben Stunde hatte er seinen Job bei einer Hilfsorganisation gekündigt und fragte, was wir vorhätten. Er war sofort bereit, mit uns in das Kosovo zu fahren. Noni sollte als Übersetzer mitkommen.
Wie sich Kujtim am besten beschreiben lässt?
Am zweiten Tag im Kosovo stellte Joanne Mariner fest, dass etwa hundert serbische Familien die Gelegenheit verpasst hatten, im Schutz des Militärkonvois der abrückenden serbischen Truppen zu fliehen. Eingeschüchtert von den triumphierend zurückkehrenden Kosovo-Albanern und voller Furcht vor der vorhersehbaren Rache, hatten sie in der serbisch-orthodoxen Kirche mitten im Zentrum von Prizren Zuflucht gesucht. Joanne hatte beim Spazierengehen durch die wunderschönen, verwinkelten Strassen von Prizren den Fluss überquert und war dabei auf die hölzerne Pforte gestoßen, die zum Gemeindezentrum der serbisch-orthoxen Kirche führte. Sie sagte, es seien zig Familien mit kleinen Kindern dort im Innenhof, voller Angst, die Kosovo-Albaner könnten sie alle umbringen. Die NATO-Truppen waren zwar in die Stadt eingerückt, und sie hatten die Busse und Wagen von niedergeschlagenen serbischen Familien aus Prizren geleitet, damit der Zorn der aufgebrachten Meute der siegreichen Opfer sie nicht treffe. Aber diese Familien hatten zu spät reagiert. Sie hatten sich sicher gewähnt, vielleicht weil sie sich keiner Verbrechen schuldig gemacht hatten, vielleicht weil sie sich mehr vor der Flucht in die serbische Ungewissheit fürchteten als davor, in einem albanischen Kosovo zu bleiben, vielleicht hatten sie auf Milde gehofft, auf Versöhnung, vielleicht hatten sie auch nur ihrem gutgläubigen Patriarchen vertraut, der auf die göttliche Fügung hoffte. Jedenfalls saßen sie nun zitternd und frierend auf ein paar lumpigen Wolldecken im Freien und im Dunkel der leeren, steinernen Räume der orthodoxen Gemeinde, hinter verbarrikadierten Toren, und lauschten mit eingezogenen Schultern den Freudenschüssen der UÇK-Kämpfer in der wieder eingenommenen Stadt Prizren.
Kujtim hörte der Erzählung in einer fremden Sprache zu, sah die wilden Gesten, aber er verstand nicht, warum Joanne aufgebracht war. Ich erklärte es Noni, und der übersetzte für Kujtim.
Es war der zweite Tag nach der Befreiung.
Den ganzen Tag über waren wir an den Orten der Verwüstung gewesen, in Krusa e Male, in Velika Krusha, Überlebende hatten uns erzählt, wie albanische Familien niedergemetzelt worden waren, wir hatten fassungslos auf tote Kühe mit aufgedunsenen Bäuchen in albanischen Wohnzimmern gestarrt, ein Abschiedsgeschenk der abrückenden Serben, wir waren durch verkohlte Häuser gegangen, durch Straßenzüge und Viertel in Schutt und Asche in Gjakova.
Den ganzen Tag lang hatte uns Kujtim schweigend durch die leeren Szenerien der Gewalt gefahren und begleitet. Den ganzen Tag und all die Wochen zuvor war dieser Mann Zeuge der Verbrechen der serbischen Einheiten geworden.
Und nun hörte er von den serbischen Familien in der orthodoxen Kirche in Prizren und sagte schlicht: »Na gut. Was machen wir mit diesen Serben? Wir müssen helfen. Sie sind genauso Flüchtlinge wie diejenigen, die sich in meinem Haus in Kukes verstecken …«
Emine:
Emine lernte ich acht Tage vor Kriegsende an einem heißen Sommernachmittag im »Frauenzelt« des Lagers »Piscina« in der albanischen Hauptstadt Tirana kennen.
Der Norden Albaniens konnte die täglich über die gebirgige Grenze aus dem Kosovo strömenden Vertriebenen nicht mehr aufnehmen. Dass die Kosovo-Albaner ausgerechnet in das rückständige und verarmte Albanien flohen, war eine historische Ironie.
Infrastruktur und Versorgung waren beim großzügigen südlichen Nachbarstaat weitaus schlechter als in der jugoslawischen Provinz Kosovo. Die winzige Stadt Kukes im Norden Albaniens lebte schon zu normalen Zeiten mit ca. 100000 Einwohnern am Rande ihres eigenen Abgrunds: Die Lehm- und Kieselwege zwischen den hässlichen Zementbauten waren überfüllt mit Müll. Räudige Hunde suchten darin nach Abfall oder zumindest ein paar Ratten. Der karge Boden der Gegend taugte allenfalls für den Anbau von Zwiebeln, Zuckerrüben und Kohl.
Die Flüchtlinge kampierten nicht in Lagern, sondern einfach auf den freien Flächen am Stadtrand, vor der Moschee, auf dem im April vom dauernden Regen aufgeweichten Boden. Jeden Tag kamen neue hungrige, verzweifelte Familien über die Grenze, eingepfercht in vollbepackten Wagen, oder zumeist auf dem Anhänger hinter ihrem Traktor.
Emine war wie Tausende andere im Juni mit Bussen weiter südwärts verbracht worden, in die drei Lager in der albanischen Hauptstadt Tirana. Rund um das trockengelegte Freibad von Tirana hausten nun Hunderte in selbstgebastelten Unterkünften, einige hatten Planen und Zelte von der Hilfsorganisation MedAir über herabhängende Äste gezogen, ein paar Pappkartons deckten die wenigen Habseligkeiten zu, die die Serben ihnen gelassen hatten. Der Regen der vergangenen Wochen hatte nachgelassen, und die Sonne geißelte nun mittags die Schutzlosen im Lager. Es gab selbstgewählte Sprecher, eine kleine Verwaltung, eine Malschule für die verstörten Kinder, in dem elenden Provisorium wurde Normalität geprobt, als könne man den Krieg vergessen machen: Ein Karussell, ein Clown, eine Fußballmanschaft – alles spielte, rannte, alberte gegen den Kummer an.
Emine war eine sechsundvierzigjährige Rechtsanwältin. Sieben Jahre zuvor hatte die serbische Regierung der muslimischen Kosovo-Albanerin Berufsverbot erteilt, und seither war sie arbeitslos. Zwei Monate war sie nun schon auf der Flucht, seit sie ihre Heimatstadt Mitrovića verlassen musste. Freunde in Tirana hatten ihr eine Unterkunft angeboten. Doch Emine wollte keinen Luxus in Anspruch nehmen, der den anderen Flüchtlingen verwehrt war. Also blieb sie bei den Vertriebenen in den schmutzigen, stickigen Zelten, ertrug die Hitze, die Alpträume aus der Vergangenheit, die Ängste vor der Zukunft und die Schlangen im Lager. Sie hatte sich als freiwillige Helferin für »Medica Kosova« gemeldet, ein Projekt der nichtstaatlichen deutschen Organisation »Medica Mondiale«, das vergewaltigte Frauen betreute.
Die Hälfte von Emines Angehörigen war vor zwei Monaten verschwunden und wurde seitdem vermisst; sie hatte ihr Haus verloren, ihre Besitztümer, ihren Pass – und doch war sie zuversichtlich: »Wir haben gesiegt«, sagte sie zu einem Zeitpunkt, da der Krieg noch nicht zu Ende war. »Wir haben gesiegt. Schon jetzt. Wir haben gewonnen – denn wir haben überlebt.«
Etwas verwirrt fragte ich, warum sie dieses Elend als Triumph beschreiben könne. Sie erwiderte, Miloševićs einziges Ziel sei es gewesen, die gesamte albanische Bevölkerung auszurotten. Dass einer, hundert, vielleicht ein paar Tausend überlebt hatten, reiche aus, um zum stolzen Sieger über eine rassistische Ideologie zu werden. »Seine Politik wollte mich tot sehen – aber ich lebe noch. Es war nicht vorgesehen, dass ich überlebe.«
Und dann malte sie mir ihr zukünftiges Leben nach dem Krieg aus, wie sie in das zerstörte Haus in Mitrovića im Kosovo zurückkehren und ein neues Leben anfangen würde: »Wir beginnen von vorn, aber wir werden nicht mehr die gleichen Menschen sein. Wir werden nicht mehr die Gleichen sein, aber wir werden wieder mit den Serben reden. Wir müssen. Wir haben überlebt, damit es anders wird.«
Sefer:
In einer Ecke von Sefer Seferais Zelt Nummer 3 H 17 im nordalbanischen Lager Kukes saß ein alter Mann im Schneidersitz auf dem Boden. Er war stumm. Seine Großnichte hüpfte auf seinen Knien herum, trampelte barfuß auf die Waden des Alten. Doch der zuckte nicht einmal. Immer wieder schob sie den Stoff der Hosenbeine hoch, so dass die blasse, zerfurchte Haut sichtbar wurde. Den alten Mann schien es nicht zu kümmern. Er war gelähmt.
Ihre Heimatstadt Gjakova hatten Sefer und seine Familie im März verlassen müssen, als sie von den Serben aus ihrem Haus vertrieben worden waren. Seinen gelähmten Großonkel hatte Sefer auf den Rücken geschultert und ihn acht Kilometer weiter nach Koronica geschleppt, einer kleinen Stadt westlich von Gjakova, wo die Familie sich sicher geglaubt hatte. Nach dem Mord an einem serbischen Offizier aus Koronica verließ Sefer mit seiner Familie auch diesen Ort. Allzuoft schon hatte Sefer erlebt, wie serbische Soldaten die albanischen Zivilisten kollektiv bestraften aus Rache für einen durch die UÇK getöteten Serben. Den gelähmten alten Onkel hatte Sefer die ganze Strecke von Koronica bis nach Orise auf dem Rücken getragen. Zwischen Orise und Meja hatten serbische Milizen die Flüchtenden angehalten und Sefer gezwungen, den Onkel abzusetzen und allein zu lassen.
Zusammen mit rund fünfhundert anderen Männern war Sefer abgeführt und in einen zwei Meter tiefen Graben gesteckt worden. »Sie wollten uns lebendig begraben in dem Erdloch«, sagte Sefer. Als 16 ältere Männer von den Serben freigelassen wurden, gelang es Sefer, sich unter die Alten zu schmuggeln und zu entkommen.
Er war an die Stelle zurückgekehrt, wo er seinen Onkel zurückgelassen hatte, und war mit dem alten Mann auf dem Rücken weiter in Richtung Meja gegangen. Langsam, gebeugt unter dem Gewicht des unbeweglichen Alten, war Sefer über die Felder geschwankt, ohne den Serben in die Hände zu fallen. Als sie in Meja angekommen waren, hatte er die Toten gesehen: Zwei Reihen von Leichen auf der Hauptstraße, alle mit den Händen hinter dem Kopf, Gesicht nach unten, erschossen.
Sefer sah die Opfer des Massakers von Meja, wo am 27. April nach Angaben von Human Rights Watch ungefähr zweihundert Flüchtlinge getötet wurden. In den Morgenstunden des 27. hatten serbische Einheiten die Menschen zwischen Junik und Gjakova zusammengetrieben und sie dann auf der Hauptstraße sowie auf einem Feld neben der Straße nach Meja ermordet.
»Wenn ich ihn nicht hätte tragen müssen, wäre ich ein paar Stunden früher in Meja gewesen«, sagt Sefer.
Zeugen und Zeugenaussagen
»Niemand zeugt für den Zeugen«, schreibt Paul Celan.
Das Schreiben über den Krieg im Kosovo, die Berichterstattung direkt aus den albanischen Flüchtlingslagern jenseits der Grenze waren problematisch.
Wir waren nicht Augenzeugen, sondern mussten uns selbst auf Berichte anderer verlassen. Die Erzählungen ließen sich nicht durch Bilder oder Materialien überprüfen, nur durch andere unabhängige Zeugenaussagen verifizieren.
Es war ein moralisch wie politisch heikles Arbeiten, denn die Geschichten über die Verbrechen blieben ja nicht lokal, sondern wir transportierten sie in die Öffentlichkeit der internationalen Gemeinschaft. Wir arbeiteten nicht in einem Vakuum, sondern in einem politisch-militärischen Konflikt, und wir berichteten, notgedrungen, einseitig. Zwar gab es parallel eine Korrespondentin, die aus Belgrad schrieb und von dort aus unsere Artikel konterkarieren konnte, aber die Situation im Kosovo rekonstruierten wir unsererseits ausschließlich aus den Aussagen einer Partei: der kosovo-albanischen.
Bei dem ersten europäischen Krieg, der – ohne UNO-Mandat – allein durch den Diskurs der »humanitären Intervention« gerechtfertigt wurde, blieben unsere Artikel über die Menschenrechtsverletzungen an den Kosovo-Albanern nicht neutral, sondern wurden dankbar aufgenommen von den Krieg führenden Parteien der NATO-Allianz. Gerade in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, die traditionell gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr gestimmt war, mussten Geschichten vom Leid der ethnisch verfolgten Kosovo-Albaner als moralische Trumpfkarte im rhetorischen Feldzug für den Krieg instrumentalisiert werden können.
Die PR-Maschine in Brüssel produzierte schon früh polarisierende Berichte: einerseits die mörderischen Akte der Serben und andererseits die virtuellen, sauberen Kriegshandlungen einer aus humanitären Gründen intervenierenden Luftstreitmacht.
Und dennoch, bei all der gebotenen Vorsicht gegenüber den eigenen Bedingungen und Auswirkungen des Schreibens, bei aller Kritik an der Propaganda der NATO – die Ereignisse im Kosovo ließen sich so ganz isoliert und ahistorisch wiederum auch nicht betrachten. Die ethnischen Feldzüge von Slobodan Milošević hatten bereits Bosnien aufgesplittert, die UN-Schutztruppen hatten in Srebrenica bereits versagt und zulassen müssen, dass 6000 Männer massakriert worden waren, Sarajewo war eingekesselt gewesen, die systematischen Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen gegenüber Kosovo-Albanern waren schon lange vor März 1999 dokumentiert.
Sollten wir nun nicht schreiben über die verwundeten Flüchtlinge, die malträtierten Männer, die jeden Tag zu Tausenden über die Grenze nach Albanien strömten? Waren die Kriegsverbrechen, die wir über Opferaussagen rekonstruieren konnten, unglaubwürdig, weil sie den NATO-Obersten dienten?
Rudolf Scharpings im besten Fall fahrlässige Behauptung von »den serbischen Konzentrationslagern« im Kosovo, für die es Beweise gebe (die allerdings nicht einmal seine unbemannten Drohnen sichten konnten), änderte leider nichts an der Tatsache der zahllosen Opfer vor unseren Augen, änderte nichts an dem Massenexodus, den Morden an Kosovo-Albanern.
Wir berichteten über Menschenrechtsverletzungen, die von Serben an Kosovo-Albanern begangen wurden, auch wenn dies der NATO diente, so wie wir zwei Wochen später von Menschenrechtsverletzungen, die von Kosovo-Albanern an Serben begangen wurden, berichteten, auch wenn dies der NATO nicht diente.
Als wir schließlich in das Kosovo einreisen konnten, waren wir nervös.
Die erste Stadt, in die wir fuhren, Prizren, war kaum beschädigt.
Hatten wir etwas Falsches berichtet? Hatten wir Horrormärchen für bare Münze genommen? Waren wir mit unseren Artikeln, wenn schon nicht zu Auslösern, so doch zu Unterstützern eines Krieges geworden, der aufgrund der Leidensgeschichten der Flüchtlinge geführt wurde – und erwiesen sich ihre Berichte jetzt als falsch?
Nun, Prizren sollte eine Ausnahme gewesen sein.
Andere Ortschaften waren fast völlig zerstört. Wie sich nachträglich herausstellte, waren die Erzählungen der Flüchtlinge, wie traumatisiert und verstört auch immer sie klangen, nicht nur hinsichtlich der Zahlen erstaunlich zutreffend gewesen, sondern so präzise in ihren Angaben, dass wir daraus die Schauplätze einer ganzen Reihe von Kriegsverbrechen rekonstruieren konnten: Da war die Bahnlinie, von der sie erzählt hatten, der Fluss, den die Bahn überquert, hundert Meter weiter ein Maisfeld, und dann …
Absurde Normalität
Nichts verläuft auf diesen Reisen so wie geplant, Recherchen verlaufen im Nichts, Termine platzen, Gesprächspartner tauchen nicht auf, Orte lassen sich nicht finden, der Eingang zum Flüchtlingslager ist versperrt, man irrt sich, verwechselt etwas, rennt einem Phantom hinterher, es dauert immer länger als beabsichtigt. Niemals ist es wirklich das eigene Verdienst, wenn etwas Sinnvolles, Gutes, Konstruktives geschieht.
Es sind Details und Zufälle, die über Erfolg oder Misserfolg, manchmal über Verwundung oder Unversehrtheit entscheiden, eine Autopanne kann Leben retten, weil man zu spät eintrifft, wo es zuvor gefährlich gewesen wäre, es sind Fremde, deren Wissen oder Gastfreundschaft unabdingbar ist. Warum sie uns willkommen heißen oder wir ihnen auch nur begegnen, ist kontingent. Ob jemand in uns eine Ähnlichkeit mit seinen verschollenen Kindern zu erkennen glaubt, ob er einfach nur eine Zigarette braucht oder ob wir im Gespräch, unbemerkt und unbewusst, etwas herstellen, eine Stimmung, in der sich eine Gemeinsamkeit herausbildet, zufällig ein Sesam-Öffne-Dich gesprochen wird, ob eine Geste etwas ermöglicht, die das Gegenüber milde stimmt, sich unserer anzunehmen, zu helfen, zu begleiten, zu erzählen – es ist nicht in unserer Hand.
Zielgerichtet kann die vorbereitende Lektüre, das Packen für alle Notfälle vor Reiseantritt sein. Ich gebe gerne zu, dass ich ein besonders paranoider Organisationsmaniac bin und von japanischem Heilpflanzenöl, alten und neuen Landkarten, dem Koran, einem Kompass bis zum Ersatzpaar extralanger Schnürsenkel immer alles mitschleppe.
Aber danach? Einmal unterwegs, ist es schierer Zufall, ob etwas gelingt, wem man begegnet, ob man schneller oder langsamer vorankommt. Es sind unbewusste Handlungen, Verwicklungen, die gerade in Kriegsgebieten unerwartet Bedeutung bekommen können.
Wenn unser unverschämter Taxifahrer uns nicht mitten in Albanien rausgeworfen hätte, wären wir Kujtim Bilali nie begegnet. Und ohne Kujtim hätten wir niemals die Geschichte des Kosovo verstanden, wir wären ohne das Vertrauen in ihn niemals so viele Risiken eingegangen und wären vermutlich nicht so unbeschadet hervorgegangen aus den Wirren.
Oder der junge Mitarbeiter der UNHCR