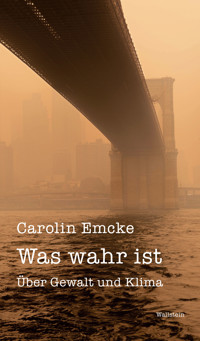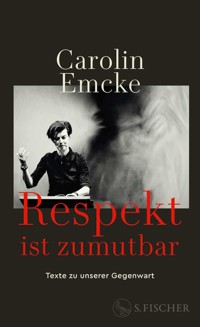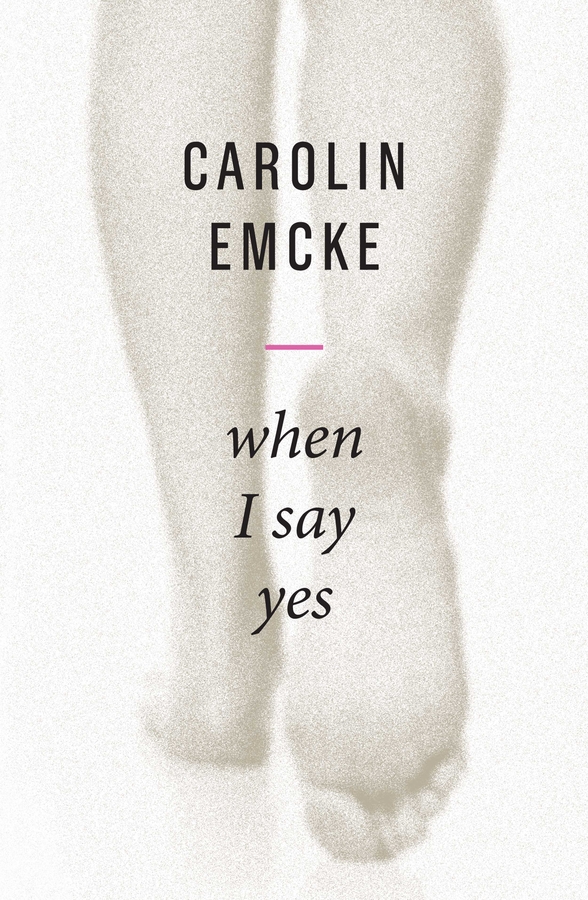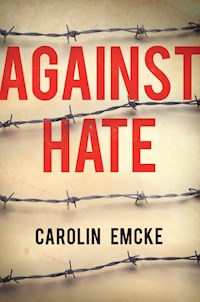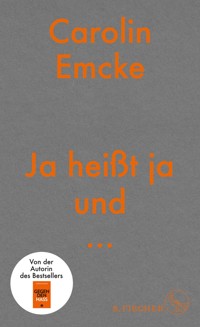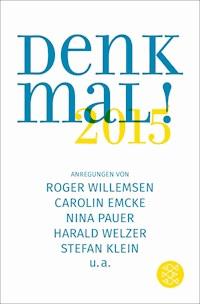8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 30. November 1989 wurde der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen in Bad Homburg mit einer Sprengladung getötet – einer der letzten Morde der Rote Armee Fraktion. Achtzehn Jahre lang hat die Journalistin und Autorin Carolin Emcke geschwiegen zu dem Terror der RAF und damit auch über das Attentat an ihrem Patenonkel Alfred Herrhausen. In diesem berührenden, so persönlichen wie politischen Text plädiert die Autorin dafür, endlich das eisige Schweigen zwischen Tätern und Opfern des RAF-Terrors zu brechen. Sie plädiert jenseits von juristischer Sühne (oder Gnade) für einen gesellschaftlichen Dialog, für eine Aufklärung im emphatischen Sinne. Freiheit gegen Aufklärung – nur das könnte, Carolin Emcke zufolge, dabei helfen, die Epoche des deutschen Terrors wirklich zu begreifen. Der Text ist ein moralisches Plädoyer gegen Gewalt, aber auch gegen Rache und Verachtung als gesellschaftliche Antworten darauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Carolin Emcke
Stumme Gewalt
Nachdenken über die RAF
Sachbuch
Über dieses Buch
»Es schafft einen ganz eigenen Raum um sich herum, dieses Schweigen, in den werden wir eingeschlossen: Täter und Opfer zugleich.
Die Stille verfestigt sich wie eine Eisschicht.
Darin eingefroren, vergeht die Zeit ohne uns.«
In ihrem berührenden, so persönlichen wie politischen Text argumentiert Carolin Emcke dafür, endlich das eisige Schweigen zwischen Tätern und Opfern des RAF-Terrors zu brechen. Sie sucht nach einer anderen Form des Schreibens über die RAF und argumentiert für einen gesellschaftlichen Dialog jenseits der Konfrontation.
Carolin Emckes Buch ist ein moralisches Plädoyer gegen Gewalt und für ein historisch differenziertes Nachdenken über die RAF und die politischen und sozialen Fragen unserer Zeit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Es gibt keine Geschichte [...]
Ich denke immer noch [...]
Winfried Hassemer
1. Wünsche, Vorschläge, Forderungen
2. Hintergründe, Linien
3. Chancen, Risiken, Fragen
Wolfgang Kraushaar
Es gibt keine Geschichte des Wortes, aber unabwandelbar eine Geschichte des Schweigens. Das Wort ruft sie uns in Erinnerung.
Edmond Jabès (aus: »Ein Fremder«)
Und Kraft und Schmerz und was mich stieß und trieb und hielt (...) die wildernde Überzeugung, dass dies anders zu sagen sei als so!
Paul Celan (aus: »Schneepart«)
Ich denke immer noch an den Taxifahrer.
Es war bereits Mittag, als die Maschine aus London in Frankfurt landete.
Ich stieg in das erstbeste Taxi auf dem Standstreifen im unteren Stockwerk des Flughafens und nannte dem Fahrer erklärungslos die Adresse in Bad Homburg.
Er verzog keine Miene.
Dabei musste er wissen, wessen Haus das war.
Den ganzen Tag über war die Nachricht gemeldet worden.
Den ganzen Tag über hatte er aufgeregt diskutierende Gäste durch die veränderte Stadt chauffiert.
Wortlos nahm er mir meine alte, zerknautschte Ledertasche ab und verstaute sie im Kofferraum.
Damals schien mir das nicht erstaunlich.
Ich kann mich nicht erinnern, ob er auf der Fahrt mein Gesicht im Rückspiegel beobachtet, nach Spuren der Verzagtheit gesucht hat.
Ich erinnere mich nur, dass ich regungslos dasaß und aus dem Fenster starrte.
Unfähig, mich auf die vorbeihuschenden Landschaften, innen oder außen, zu konzentrieren.
Erst Richtung Kassel. Dann runter von der Autobahn und die vertraute Pappelallee entlang, von dort nach rechts auf den Kreisel zu.
Wie naiv muss ich gewesen sein zu glauben, wir könnten die Strecke an diesem Tag fahren.
Als sei nichts geschehen.
Wie wohlwollend muss der Taxifahrer gewesen sein, dass er mir trotzdem diesen Gefallen tun wollte.
Wir bogen zum Seedammweg ein – und alles stockte hinter den Absperrungen.
Wir saßen fest.
Von hier an ist die Erinnerung bruchstückhaft.
Eine Metapher – und doch wahr. Es sind nur Fetzen geblieben.
Ich bin ausgestiegen.
Habe ich dem Fahrer irgendeine Erklärung gegeben?
Habe ich ihm gesagt: Ich will nur einmal sehen, was da los ist?
Ich kann mich nicht erinnern.
Überall waren Kontrollen, Polizisten, Schaulustige, BKA-Beamte.
Geschäftigkeit und Hilflosigkeit prägten das Getummel vor und auf der Kreuzung. Ein langer Stau hatte sich gebildet, aber niemand hupte, niemand beschwerte sich.
Ich bin ungehindert in den Seedammweg spaziert.
Hat mich jemand nach meinem Ausweis gefragt?
Hat jemand wissen wollen, was ich an diesem Ort zu suchen hatte?
Vermutlich. Aber auch dafür habe ich keine Belege mehr in meinem inneren Bildarchiv.
Auf einmal hatte ich einen freien Blick auf die ganze Szene, die Straße hinunter und wieder herauf, den Hügel hoch, an der die Schule liegt.
Warum habe ich mir das angetan?
Warum musste ich es sehen?
Was ich erwartet hatte, kann ich nicht sagen.
Ich stand am Anfang der Straße und schaute auf den Wagen. Den Wagen.
Den gesprengten, verkohlten Mercedes, in dem wenige Stunden zuvor mein Patenonkel auf dem Rücksitz gestorben war. An der Arteria femoralis getroffen und verblutet durch eine als Hohlladungsmine konstruierte Bombe.
Der Wagen stand quer auf der Straße.
Unnatürlich wie ein verrenktes Gelenk, das vom Leib absteht. Ich erinnere noch, wie mir kurz einfiel: »Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen.«
Dann huschten auch diese Worte davon und alles wich aus mir.
Als ob unwillkürlich Platz geschaffen werden musste, damit die Wirklichkeit dieses Ereignisses einziehen konnte.
Wie lange braucht es, um zu begreifen, dass ein Freund ermordet worden ist?
Wie lange braucht es, um zu verstehen, dass es keinen Abschied gab?
Dass du versäumt hast zu sagen, was er hätte wissen sollen? Dass sie, die Mörder, dir, der Angehörigen des Opfers, Schuld aufgeladen haben?
Als ich wieder zu mir kam, saß ich in einem Feuerwehrfahrzeug.
Ich hielt, glaube ich, eine Tasse in der Hand.
Oder einen Becher.
Jemand sprach auf mich ein. Beruhigend.
Ich glaube nicht, dass ich die Worte verstand.
Wie ich von der Straße in den Wagen gekommen bin, weiß ich nicht.
Was vorher geschah, kann ich nicht sagen.
War ich gestürzt? Gefallen? Hatte mich jemand aufgehoben? Getragen?
Es gab einen Riss.
Exakt in dem Augenblick, dort auf der Straße im Seedammweg, zwischen dem hässlichen Parkhaus und der absurden Taunus-Therme, in dem das Bewusstsein begriff, dass wahr war, was wahr war.
Unbekannte Attentäter hatten Alfred Herrhausen ermordet.
Dieser Moment des Verstehens ist verschollen.
Wie sollte das auch jemand verstehen und intakt bleiben?
So blendete das Bewusstsein sich aus.
Koppelte die Erfahrung vor dem Begreifen des Unbegreiflichen ab von der Erfahrung danach.
In der Mitte nur eine Bruchstelle der Bewusstlosigkeit.
Seitdem gibt es nur noch ein Vorher und ein Nachher.
Nachher versuchte ich, irgendetwas zu sagen. Über den Becher in meiner Hand hinweg zu den freundlichen Pflegern oder Feuerwehrmännern.
Irgendetwas.
Viel konnte es nicht sein.
Ich wolle in den Ellerhöhweg. Dort warte man auf mich.
Ob mich jemand dorthin bringen könne.
Vorbei an den Sperren und Behinderungen.
Ich glaube, ich habe ihnen meinen Pass gegeben, damit sie per Funk in einem Computer nachforschen konnten, wer ich war.
An meinen Taxifahrer habe ich gar nicht mehr gedacht.
Er musste die ganze Zeit dort vor der Kreuzung gestanden haben, auf dem Bürgersteig.
Wie lange mochte das her sein?
Wie lange hatte ich auf diesen Wagen gestarrt?
Wie lange war ich abgetaucht?
Aber als mich der Polizist schließlich mit einem Einsatzfahrzeug den Berg hoch fuhr, war die alte Ledertasche im Kofferraum.
Der Taxifahrer musste sie den Beamten gegeben haben. Wortlos vermutlich. Als ob selbstverständlich.
Ich habe ihn nie bezahlt.
Dabei war es eine lange Strecke gewesen.
Vom Flughafen Frankfurt bis zum Tatort in Bad Homburg. Was mag er gedacht haben, als ich einfach ausstieg?
Und verschwand.
Wie lange mag er gewartet haben?
Immer, wenn ich an diesen Tag denke, fällt er mir wieder ein, und dass ich ihn ausfindig machen muss.
Einmal habe ich es versucht.
Jahre später.
Ich habe die Taxizentrale angerufen, um festzustellen, dass es das gar nicht mehr gibt: Taxizentralen. Es ist alles dezentral, und jemanden suchen kann man immer nur innerhalb einer Firma, aber nicht darüber hinaus. In dieser Taxi-Gemeinschaft jedenfalls war kein Fahrer zu finden, der an jenem Tag um die Fahrkosten geprellt worden war.
Achtzehn Jahre ist das nun her.
Erzählt habe ich es nie.
Auch nicht geschrieben.
Dabei bin ich Journalistin geworden.
Immer wieder gab es Gelegenheiten und Anfragen, diese Geschichte zu erzählen.
Manchmal freundlich neugierige. Meistens manipulative. Ein idealer Fall eigentlich. Eine Betroffene selbst. Mit Zugang zu allen Beteiligten.
Nur sonderbarerweise war da kein Zugang.
Nicht zu der Geschichte als Erfahrung in meinem eigenen Leben.
Nicht so, dass ich sie anderen hätte mitteilen wollen.
Wie soll es gelingen, nach achtzehn Jahren, sich einer solchen Erfahrung anzunähern? Wie kann eine solche Geschichte erzählt werden? Eine Erfahrung, die lange zurückliegt und die sich nicht schon festgeschrieben, die noch keine Kontur bekommen hat im wiederholten Sprechen über die Jahre, sondern die wirklich erst entstehen muss aus den alten Bildern und Assoziationen, den Versatzstücken an Sätzen und Gesten, die ich meine schon damals abgespeichert zu haben, die sich aber vielleicht erst im Lauf der Jahre abgelagert haben wie Sediment.
Wie trügerisch ist die erinnernde Erzählweise, in der ich versuchen könnte, mir die damalige Zeit und meine Eindrücke noch einmal hervorzuholen?
Wie sehr ist die eigene Wahrnehmung, damals schon und auch jetzt noch, überlagert und überschrieben von nachträglichem Wissen, von einer politischen Sozialisation, einem bestimmten philosophischen Diskurs?
Wie verzerrt und gebrochen ist das Gedächtnis durch spätere Assoziationen und Positionen zur RAF? Wie viele Rückprojektionen überdecken die früheren Bilder und Geräusche, die damaligen Emotionen und Überlegungen? Wie soll es gelingen, sich durch die übereinander geschichteten Eindrücke, Gefühle und Reflexionen zu tasten? Wie kann ich mir selbst noch trauen im erinnernden Schreiben einer vergangenen, aber immer noch so gegenwärtigen Geschichte?
Das sind Fragen, die für jedes vergangene Erlebnis, besonders jede schmerzliche Erfahrung, die gerne zu vergessen wäre, gelten. Allzu oft erweist sich die Erinnerung als trügerischer Zeuge des Erlebens dramatischer oder traumatischer Ereignisse. Um wieviel mehr muss Zweifel geboten sein bei einer Erfahrung, die keine bloß individuelle sein kann oder darf, sondern die Teil der historischen Erzählung der Bundesrepublik geworden ist, die verwoben ist mit all den Erzählfäden der Geschichte der RAF, die so viele andere ebenfalls als Teil ihrer individuellen Erinnerung verstehen? Die Geschichte dieser Morde ist niemals nur die Geschichte der Täter und Opfer, sondern immer auch eine Geschichte, in der sich zahllose Unbeteiligte gespiegelt haben. In den Mitgliedern der RAF oder gegen sie haben sich verschiedene Generationen in der Bundesrepublik politisch oder moralisch verortet, haben sich ausgerichtet an diesen flüchtigen oder inhaftierten RAFlern, haben ihren eigenen Lebensentwurf im Verhältnis zu diesen Biographien verstanden.
Wer über die RAF schreibt, über die eigene individuelle Geschichte mit der RAF, schreibt deshalb unwillkürlich und unumkehrbar auch immer über und gegen die individuellen wie kollektiven Erfahrungen anderer mit der RAF.
Seit ich begonnen habe, mir meine eigene Erfahrung mit dem Mord eines geliebten Menschen anzueignen und über die politischen Echos der Gewalt auf die Opfer, aber auch die Täter nachzudenken, seit ich versucht habe, mich an dem brüchigen Faden meiner Erinnerung an den Grund meiner Erfahrung zu begeben, entwirren sich auf einmal die Erzählungen und Erfahrungen meiner Gegenüber mit, initialisiert meine eigene Geschichte auf einmal die anderer Menschen, die sie bestreiten oder kritisieren, die sie begreifen und mit ihrer eigenen ins Verhältnis setzen wollen.
Was wie mein Eigenes wirkte, erweist sich in zahllosen Gesprächen als etwas allen Gemeinsames.
Seit ich zu sprechen begonnen habe über diese Zeit vor achtzehn Jahren und die Spuren, die die Gewalt in uns hinterlassen hat, sprechen andere, Freunde und Fremde, mit.
Das Nachdenken über eine solche Erfahrung, wie besonders und individuell sie immer sein mag, muss sich deswegen irritieren lassen von den Erfahrungen und Erinnerungen anderer. Eine solche Erzählung darf sich abbringen oder anstiften lassen von den Geschichten anderer, sie stellt sich immer wieder in Frage, auch und gerade, wenn die Konstrukte kollektiver Überzeugungen gegen die individuelle Perspektive veranschlagt werden. Sie muss das Besondere mit und gegen das Allgemeine verrechnen.
Es kann also niemals eine rein persönliche Erzählung sein. Eine solche Perspektive wäre automatisch gefangen in individualistischer Intimität, liefe Gefahr, nurmehr apolitisch und ahistorisch zu klingen. Weil die Geschichte des Terrors eben keine rein private Angelegenheit ist. Weil die Wurzeln der Gewalt nicht allein in den Familiengeschichten der Täter oder ihrer Opfer liegen (auch wenn die gegenwärtige Debatten-kultur dazu neigt, alles in Personalisierungen zu banalisieren), sondern auch eingelassen sind in die zeitgeschichtlichen Zerwürfnisse und Versehrungen der deutschen Gesellschaft und ihrer Verortung in der Welt.
Wie könnte das gelingen: eine Erinnerung an die eigene Erfahrung und zugleich ein Nachdenken über die politischen und historischen Bezüge, in die sie eingebettet ist und in denen sie in Frage gestellt wird durch Andere?
Wie aussichtslos ist ein solches Unterfangen: neben der subjektiven Erzählform auch noch eine politische Perspektive einzuziehen, die das Schweigen und die Spirale der Gewalt zu diskutieren versucht?
Kann das gelingen: einen gewaltsamen Tod zu betrauern und die Ursprünge der Gewalt zu reflektieren? Wie kann ich in der »Ich«-Form schreiben und diese individuelle Perspektive verteidigen und trotzdem die politischen Bezüge betrachten? Wie kann diese Individualität sich gegen die Vereinnahmungen und Zuschreibungen wehren?
Wie sehr schließt ein solches Schreiben von vornherein bestimmte Leser aus, weil das Persönliche aus ihrer Perspektive das Politische zu negieren scheint?
Ist eine persönliche Erinnerung also in mehrfacher Hinsicht fragwürdig: weil sie eine Unmittelbarkeit des Erlebens vortäuscht, die das Gedächtnis als unfehlbar behauptet? Und weil sie Gefahr läuft, in der privatisierten Sicht auf eine historische Epoche das soziale Moment unwillkürlich zu verunmöglichen?
Warum also überhaupt »Ich« sagen? Warum überhaupt sich dieser politischen Geschichte mit einer subjektiven Erzählung nähern? Warum die eigene Verwicklung überhaupt preisgeben?
Wieder und wieder habe ich mich das gefragt: ob es nicht angemessener wäre, die eigene Rolle zu verschweigen. Wieviel leichter wäre das? Ich habe mir gewünscht, ich könnte befreit nachdenken über die Geschichte der RAF und die Reaktionen auf sie, unbefangen schreiben über die stumme Gewalt – ohne mich preiszugeben, ohne mich den abstrusen Vorstellungen davon aussetzen zu müssen, was es bedeutet, jemanden durch die RAF verloren zu haben.
Von vornherein erweist eine Lesart einer »betroffenen« Autorin besonderen Kredit, eine andere entzieht ihn umgehend.
In Kreisen, in denen der Mythos der Authentizität durch die mediale Inszenierung der Wirklichkeit geistert, wird einem solchen Text besondere Glaubwürdigkeit zugeschrieben.
In Kreisen hingegen, in denen der Fetisch der Kollektivität durch die Ideologie geistert, wird einem solchen Text jede politische Relevanz abgesprochen.
Warum also »Ich« sagen?
Weil es unlauter wäre, sie zu verschweigen, die eigene Befangenheit, weil sie sich nicht verhindern ließe, die Trauer, die sich im Schreiben ihren Weg bahnt, weil diese Subjektivität zu verteidigen auch eine politische Perspektive sein könnte, weil hierin eine abweichende, eine ambivalente Stimme erst begriffen und dann behauptet werden könnte gegen die Verkrustungen der jeweiligen Ideologien.
Und letztlich: weil nur ein Ende des Schweigens fordern kann, wer selber zu sprechen bereit ist.
Vielleicht wird diese Erzählung, neben der eigentlichen Erzählung, dem Nachdenken über die Gewalt und über das Schweigen, auch eine Geschichte des möglichen Scheiterns einer Erzählung über die RAF sein. Vielleicht wird sie auch immer bedenken müssen, dass dieses Schreiben, das sich gegen das ungebrochen Kollektive, gegen das unverhohlen Konfrontative wendet, das sich suchend auf den Weg macht nach einem Ort, an dem die Gegner miteinander sprechen könnten, dass dieses Schreiben so unwahrscheinlich wie unerwünscht sein könnte.
Ich habe zu rauchen begonnen an jenem Tag. Von einem Moment auf den anderen.
Camel. Ohne Filter. Eine Schachtel am Tag.
Die ersten Wochen auch mehrere.
Wir haben viel getrunken in jenen Tagen. Aspirin geschluckt. Ich habe Taschentücher vollgeblutet. Eines nach dem anderen. Ich neige nicht zu Nasenbluten. Aber damals lief es einfach heraus. Nicht Tränen, sondern Blut.
Mit Alkohol und Zigaretten setzen wir der Körperlichkeit zu, als könnten wir uns so verwunden.
Gegessen haben wir gut. Sehr gut.
Und gelacht haben wir auch. Hemmungslos. Verzweifelt.
Am Abend des ersten Tages saßen die Personenschützer in der Küche.
Wenn mich nicht alles täuscht, dieselben vom Morgen.
Sie waren nicht abgerufen worden. Sie schoben Dienst.
Als ob es noch jemanden zu bewachen gäbe.
Da saßen sie nun an dem kleinen Holztisch.
Sprachlos. Beschämt. Hilflos in ihrer ganzen muskelbepackten Größe.
Professionelle psychologische Betreuung bekamen sie an diesem Tag nicht.
Vielleicht hatte einfach niemand an sie gedacht. An die Selbstvorwürfe, die sie nun aushöhlen würden. An die Schockwellen der Bilder des Anschlags, denen sie ausgeliefert waren.
Warum hatten sie überlebt? Und nicht der, den sie hatten beschützen sollen?
So kümmerte sich Traudl Herrhausen um sie. Hörte ihnen zu. Schenkte Schnaps und Kaffee aus. Tröstete die, die anstelle ihres Mannes am Leben waren.
Am späten Nachmittag hatte die RAF angerufen.
Das ist nicht richtig. Da war keine Gruppe, die anrief. Da war noch nicht einmal ein Mensch. Es war eine gesichtslose, akzentfreie, männliche Stimme, die mit niemandem sprechen wollte, sondern nur verkünden.
Wir waren zu mehreren in der Küche. Ich erinnere nicht mehr genau, wer zuerst am Apparat war und mich dann zu sich rief, damit ich mithören konnte. Wir hielten den Hörer leicht schräg. Es dauerte eine Minute, schätze ich.
»Kommando Wolfgang Beer«, »Herrhausen, der mächtigste Mann Europas«, es waren die üblichen ideologischen Schablonen.
In der Passage, die ich mithörte, wurde die gerade durch die Deutsche Bank vermittelte Fusion von Daimler-Benz und Messerschmidt-Bölkow-Blohm nicht erwähnt.
Ich weiß noch, wie mich das irritierte.
Innerhalb ihrer eigenen Logik musste die Vereinigung des Autokonzerns mit dem Rüstungsunternehmen das Symbol schlechthin sein für das, was die RAF den »militärischindustriellen Komplex« nannte.
Ich dachte deswegen daran, weil Alfred Herrhausen und ich darüber gestritten hatten, als die Fusion zustande gekommen war.
Warum bezogen sie sich nicht darauf?
Stattdessen sprachen sie nun ausdrücklich von Alfred Herrhausen als demjenigen, der Vorschläge zur Lösung der Schuldenkrise der Dritten Welt gemacht hatte.
Ich kann nicht sagen, dass es mich beruhigt hätte, wenn mein Freund von politisch rationalen Mördern getötet worden wäre, aber diese paradoxe »Begründung« verstörte mich.
Sollten die linksradikalen Täter ausgerechnet einen Bankier ermorden, der bereit gewesen war, auf Kapital und Profit zu verzichten, um die Entwicklungsländer aus dem Zirkel der Abhängigkeit zu entlassen?
Oder war Alfred Herrhausen lediglich zum Feind geworden, weil er das vertraute Feindbild unterwanderte?
War der Vorschlag für eine Lösung der Schuldenkrise der Dritten Welt eine Bedrohung?
Nicht der Dritten Welt, sondern der eigenen Ideologie?
Hatte das die Deutsche Bank mit den Terroristen gemein?
Eine sonderbare Vorstellung ist das: nicht nur jemanden zu ermorden, sondern auch noch am selben Tag bei der Familie des Opfers anzurufen.
Es fehlte nur, dass sie uns »einen schönen Tag noch« gewünscht hätten.
Vermutlich glaubten die Täter in ihrer phantasmagorischen Welt, die Nachricht würde niemals von uns, den Betroffenen, angenommen werden. Vermutlich glaubten sie, ihr Bekenneranruf lande umgehend in den Kopfhörern der abhörenden BKA-Beamten. Vermutlich glaubten sie, Polizisten bedienten die Telefonanlage im Ellerhöhweg.
Ehrlich gesagt, auch ohne die verschwörungstheoretischen Hirngespinste der Täter hatte ich dieselben Vorstellungen.
Als die Botschaft abbrach, schauten wir uns alle an.
Sie brach übrigens tatsächlich ab. Es klang, als ob noch nicht einmal jemand sich die Mühe gemacht hätte, direkt zu sprechen. Es klang nach einer Aufzeichnung, einem Band. Vermutlich mit exakt austarierter Länge. Es gab jedenfalls keine Pause zwischen dem letzten gesprochenen Wort und dem Ende der Verbindung. Keine Verzögerung, in der eine Hand den Hörer wieder auf die Gabel legte. Keinen dieser menschlichen Zwischentöne. Nichts. Mit dem letzten Wort brach auch die Leitung ab.
Wir schauten uns alle an.
Wir mussten die Polizei benachrichtigen. Ich fragte, wo denn die Beamten am Morgen den Zettel mit ihren Telefonnummern hinterlegt hatten. Ihre Visitenkarten. Irgendwas. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass daran niemand gedacht haben sollte. Aber da gab es nichts.
Also rief ich die Polizei an. 1-1-0. Und sagte: »Guten Tag, mein Name ist Carolin Emcke. Ich rufe an aus dem Hause Herrhausen. Hier hat gerade die RAF angerufen. Können Sie mich mit irgendjemandem verbinden?«
Witzig. Wirklich witzig.
Es wurde noch besser. Als ich dann endlich mit jemandem verbunden wurde, erzählte ich, was geschehen war, fragte, ob es eine Fangschaltung gäbe, mit der man den Anrufer ermitteln könne. Nichts. Dabei waren seit dem Anschlag am Morgen und dem Anruf am Nachmittag bestimmt acht Stunden vergangen.
Tags darauf kam dann ein Beamter mit etwas, das, für den Laien, nach einem klassischen, alten Cassettenrekorder aussah und was, für den Profi, ein klassischer, alter Cassettenrekorder war.
Er stellte ihn auf die Arbeitsplatte in der Küche, unterhalb des Wandtelefons, schloss ihn an und sagte: »Wenn jemand anruft, drücken Sie gleichzeitig diese beiden Tasten hier zur Aufnahme: ›Play‹ und ›Rec‹. Er sprach ›Rec‹ mit hartem, rollendem »r« aus: »rrrrrrrrrrrrrrreck« »Drücken sie ›Play‹ und ›Rrrrrrrrrrrreck‹.«
Großartig.
Wir waren eine Gemeinschaft. Wir schliefen auf Matratzen auf dem Fußboden und, verteilt auf verschiedene Betten, unterschiedlichste Generationen und Typen. An einer großen Tafel aßen, diskutierten und organisierten, tranken, weinten und lachten wir zusammen.
Ein offenes Haus. Frei und verwundbar noch jetzt, da die Gewalt uns hätte verschließen können.
Keiner scherte sich um das, was uns im Leben, im früheren, im anderen, irgendwo da draußen, unterschied.
Niemand hat mir einen Vorwurf gemacht. Niemand machte mich, die linke, junge Intellektuelle, verantwortlich. Niemand überschritt diese Grenze, zu der der Zorn auch leicht hätte treiben können. Ungerechtigkeit keimt allzu oft als giftige Blüte des Kummers. Doch niemand ließ das zu in diesen Tagen und Wochen.
Wir sahen mehr nach einer Studenten-Kommune aus als nach dem Umfeld des Sprechers des Vorstands der Deutschen Bank, wie wir da zusammenhielten im Schmerz.
Nachts war ich allein.
Ausgeliefert ein und demselben wiederkehrenden Alptraum. Nicht nur die ersten Tage. Sondern jahrelang.
Darin saß ich auf einem Marktplatz. Auf einer Bank. Es war eine Art Biergarten.
Schlicht. Hölzern. Zwei Bänke vor einem Tisch.
Rings herum war reges Treiben. Ein Dorffest. Ein Rummel. Mittendrin saß ich an diesem hell gebeizten Tisch mit den Mördern meines Freundes.
Nur hatten sie ihn noch nicht ermordet.
Sie hatten es geplant und erzählten mir davon.
Ich war Mitwisserin der Terroristen, die meinen Patenonkel töten wollten.
Die Todesart stand noch nicht fest. Oder zumindest sprachen sie nicht davon.
Sie waren klar, ruhig. Sie hatten nichts zu verheimlichen.
Sie waren Freunde – so schien es. Waren sie keine?
Konnten sie ein solches Verbrechen nicht nur einer Vertrauten gegenüber bekennen?
Sie waren mir auch keineswegs fremd, in meinem Traum.
Ich versuchte mir nicht ihre Gesichter einzuprägen.
Ich versuchte auch nicht, die Polizei zu benachrichtigen.
Ich schien mich auch nicht zu wundern, dass sie mich einbezogen.
Alles, was ich versuchte, war, sie zu überzeugen, es nicht zu tun. Ich brachte Argumente.
Politische.
Immer hitziger versuchte ich ihnen zu erklären, warum es falsch war, was sie vorhatten.
Ich war kein anderer Mensch.
Ich war dasselbe Patenkind von Alfred Herrhausen.
Ich erwähnte das mit keinem Wort.
Kein Hinweis auf die eigene Betroffenheit.
Warum sollte sie das auch überzeugen?
Subjektive Befindlichkeiten würde dieses Kollektiv, das sich selbst jede Subjektivität verweigerte, nicht überzeugen.
Ich redete mich um Kopf und Kragen.
Ich weiß noch, dass ich im Traum das Knie anzog und den Fuß auf der Sitzbank abstellte, wie ich das manchmal in Kneipen tue. Gleichermaßen ungezogen wie konzentriert.
Der Körper winkelt sich dann zusammen, als würde er Kraft sammeln.
So saß ich da und redete auf sie ein.
Sie haben mich nicht einmal abgewehrt im Traum.
Sie haben sogar zugehört.
Als hätte es mir gelingen können, sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Mit politischen Gründen abbringen können von jenem Verbrechen.
Das eigene Scheitern wurde dadurch nur schlimmer.
Nacht um Nacht bin ich aufgewacht als Versagerin.
Schuldig, weil ich es nicht geschafft hatte.
Weil das bessere Argument keinen zwanglosen Zwang entwickelt hatte.
In einem Radiofeature für den WDR äußerte Gottfried Ensslin, der Bruder von Gudrun, einmal: »Also, ich trauer immer noch. Über die nicht-mögliche Kommunikation, die ich in Träumen manchmal nachhole. Wo sie allerdings schwerer erreichbar erscheint auch.«
Das ist das Gewalttätigste an der Gewalt des Terrors: die Sprachlosigkeit.
Ich weiß nicht, ob sich die Täter jemals überlegt haben, was es heißt, »abzutauchen«.
Nicht vor der Staatsgewalt, nicht vor der Strafe, nicht vor dem Gefängnis.
Sondern vor dem Gespräch, vor der Pflicht, Rede und Antwort zu stehen.
Kaum jemand, der nicht Opfer dieser stummen Gewalt geworden ist, kann verstehen, was das heißt: allein zu sein mit dieser Stille, in der Fragen verhallen ohne Echo.
Allein zu sein mit diesem Zorn, der keinen Adressaten kennt. Nicht Einspruch erheben zu können, selbst wenn es zu spät ist, einklagen zu können, eine Rechtfertigung zumindest, die in der Logik des Gegenübers sinnhaft wäre.
Denn anders als manch unbeteiligte Kommentatoren, anders als manch betroffene Angehörige der Opfer terroristischer Gewalt, halte ich die Attentäter nicht einfach für Kriminelle. Nicht, weil der Akt als solcher nicht, juristisch betrachtet, kriminell wäre, nicht, weil die Vorbereitung der Morde nicht eine kriminelle Energie verlangte, sondern weil es aus der Perspektive der Täter ein absichtsvoller Mord ist, der sich nicht gegen eine private Person, sondern gegen einen Repräsentanten richtet.
Gewiss: Das ist politisch eine Chimäre, psychisch eine Projektion, ästhetisch eine Simplifizierung und moralisch – moralisch ist es schlicht und ergreifend falsch.
Aber aus der Perspektive der Opfer kann die Perspektive der Täter eine Rolle spielen.
Für mich hat sie von Anfang an eine Rolle gespielt.
Denn mein Freund ist nicht einfach durch einen Autounfall gestorben.
Nicht einmal durch einen fremdverschuldeten.