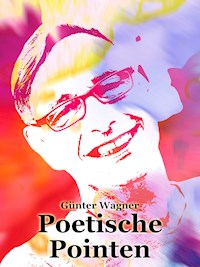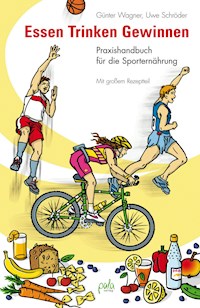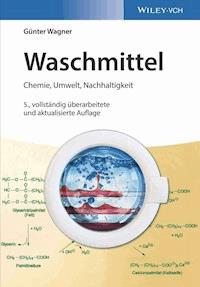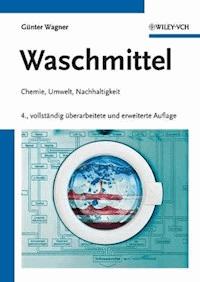
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Umweltbewußtsein in Deutschland und Waschmittel sind in ihrer Geschichte eng verknüpft, denn als sich im heißen Sommer 1958 meterhohe Schaumberge auf vielen deutschen Flüssen und Bächen bildeten, war wie sonst selten für Verbraucher die akute Umweltunverträglichkeit des westeuropäischen Lebensstils weithin sichtbar: die Tenside in den Waschmitteln waren damals biologisch nicht oder bestenfalls kaum abbaubar. Diese Erkenntnis hat maßgeblich die Entstehung von Umweltbewußtsein und ebenso die Verstärkung der Forschung auf dem Gebiet der Waschmittel bewirkt, und der Wandel von "viel hilft viel" zu "supercompact" war nicht nur in der Mentalität der Käufer, sondern auch wissenschaftlich ein enormer Fortschritt, den es im Interesse der Nachhaltigkeit des Waschens auch weiterhin voranzutreiben gilt. Mit diesem Buch gibt der Autor das dem modernen Waschprozeß zugrundeliegende chemische, biologische und physikalische Wissen an alle Interessierten weiter; an Schüler, Studenten und Laboranten; an alle, die dieses Wissen brauchen, nutzen, und vor allem, auch weitergeben: Lehrer, Ausbilder, Hochschuldozenten, Berater, Verbandsfachleute, Verbraucherschützer, Verbände, Behörden und andere private und staatliche Institutionen werden dieses Buch als detaillierte, aber bestens lesbare und von Grund auf verständliche Wissensquelle schätzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Contents
Vorwort
1: Partner beim Waschprozess
1.1 Einführung
1.2 Der Wäscheschmutz
1.3 Wasser und Wasserhärte
1.4 Textilien
1.5 Waschmaschinen
2: Chemie der Tenside
2.1 Überblick und wirtschaftliche Bedeutung
2.2 Anionische Tenside
2.3 Nichtionische Tenside
2.4 Kationische Tenside
2.5 Amphotere Tenside
3: Eigenschaften der Tenside
3.1 Anordnung von Tensiden an Phasengrenzflächen
3.2 Das Verhalten von Tensiden in wässriger Lösung
3.3 Die Waschwirkung von Tensiden
4: Warenkunde der Waschmittel
4.1 Waschmitteltypen im Überblick
4.2 Vollwaschmittel
4.3 Colorwaschmittel
4.4 Portionierte Waschmittel (Tabs und Flüssig-Tabs)
4.5 Feinwaschmittel
4.6 Spezialwaschmittel
4.7 Waschmittel mit Zusatznutzen
5: Inhaltsstoffe von Waschmitteln
5.1 Tenside
5.2 Enthärter (Gerüststoffe)
5.3 Waschalkalien und pH-Wert
5.4 Bleichsysteme
5.5 Enzyme
5.6 Sonstige Inhaltsstoffe
6: Waschhilfsmittel und Nachbehandlungsmittel
6.1 Waschhilfsmittel (Vorbehandlungsmittel und Waschmitteladditive)
6.2 Weichspülmittel und Gewebeconditioner
6.3 Weitere Nachbehandlungsmittel
6.4 Textilerfrischer
7: Technologie der Waschmittelherstellung
7.1 Herstellung von pulverförmigen Waschmitteln nach dem Tennenverfahren
7.2 Herstellung pulverförmiger Waschmittel nach dem Hochdrucksprühverfahren
7.3 Herstellung von Kompakt- und Superkompaktwaschmitteln
7.4 Herstellung von Waschmittel-Tabs
7.5 Herstellung von flüssigen Waschmitteln
7.6 Herstellung von Flüssig-Tabs
8: Waschmittel aus Sicht der Verbraucher
8.1 Geschichte der Waschmittel
8.2 Waschgewohnheiten heute
8.3 Der Waschmittelmarkt im internationalen Vergleich
8.4 Hinweise zum richtigen Waschen
8.5 Verbraucherschutz, Hygiene und Gesundheit
9: Ökologie der Waschmittel
9.1 Allgemeine Problemstellung
9.2 Abwasserbelastung durch Waschmittel
9.3 Vorkommen von Tensiden in der Umwelt
9.4 Biologische Abbaubarkeit von Tensiden
9.5 Wirkung von Tensiden auf Gewässerorganismen (aquatische Toxizität)
9.6 Ökologische Bewertung wichtiger Tenside
9.7 Ökologische Auswirkungen weiterer Inhaltsstoffe von Waschmitteln
10: Ökobilanzen
10.1 Was sind Ökobilanzen?
10.2 Was können Ökobilanzen leisten?
10.3 DIN/EN/ISO-Normen
10.4 Wer führt Ökobilanzen durch?
10.5 Grundlagen zum Erstellen von Ökobilanzen
10.6 Ökobilanz des Waschens
11: Waschmittel und Nachhaltigkeit
11.1 Allgemeine Betrachtungen
11.2 FORUM WASCHEN - eine Initiative zum nachhaltigen Waschen
11.3 Hersteller und Verbraucher tragen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung
11.4 Weitere Initiativen und Ansätze zum „Nachhaltigen Waschen“
11.5 Der Beitrag nachwachsender Rohstoffe fur eine nachhaltige Entwicklung der Waschmittel
11.6 Ausblick - Wie sieht die Zukunft des Waschens aus?
12: Allgemeine Literatur, Übersichtswerke und Internetadressen
A1: Methoden zur Synthese von Tensiden
A1.1 Herstellung von Seife
A1.2 Herstellung von linearen Alkylbenzolsulfonaten (LAS)
A1.3 Herstellung von sekundären Alkansulfonaten (SAS)
A1.4 Herstellung von Fettalkoholen und Fettalkoholsulfaten (FAS)
A1.5 Herstellung von Fettalkoholethersulfaten (FAES)
A1.6 Herstellung von Fettalkoholethoxylaten (FAEO)
A1.7 Herstellung von Alkylpolyglucosiden (APG)
A1.8 Herstellung von Kationtensiden (Esterquats)
A2: Messverfahren zur biologischen Abbaubarkeit
A2.1 Methoden zur Untersuchung des Primärabbaus
A2.2 Methoden zur Untersuchung des Totalabbaus
A3: Gesetzliche Regelungen, Selbstverpflichtungen und freiwillige Vereinbarungen
A4: Rahmenrezepturen verschiedener Vollwaschmitteltypen (Europa 2009)
A4.1 Pulverförmige Waschmittel
A4.2 Flüssige Waschmittel
A4.3 Waschmitteltabs
A5: Abkürzungsverzeichnis
Sachverzeichnis
Vita
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
© 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Cover-Design Grafik-Design Schulz, Fußgönnheim
Satz Hagedorn Kommunikation GmbH, Viernheim
Druck und Bindung betz-druck GmbH, Darmstadt
Printed in the Federal Republic of Germany Gedruckt auf säurefreiem Papier
ISBN: 978-3-527-32678-5
Danksagung
Mein Dank gilt allen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wissenschaftlichen Institutionen, Verbänden und Firmen der Waschmittel-, Waschrohstoff- und Waschgeräteindustrie, die mir bereitwillig aktuelle Daten und viele Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt haben.
Besonders danken für die vielfältige Unterstützung möchte ich Herrn Dr. Bernd Glassl (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel IKW) und Herrn Dr. Horst-Dieter Speckmann (Henkel AG & Co. KGaA)
Mein Dank gebührt auch den folgenden Personen, die an der Überarbeitung und Aktualisierung einzelner Kapitel maßgeblich mitgewirkt haben:
Kapitel 2 und Anhang 1: Dr. Claus-Dierk Hager (Sasol Germany GmbH), Kapitel 9 und Anhang 2: Dr. Josef Steber und Dr. Thorsten Wind (Henkel AG & Co. KGaA),
Kapitel 10: Dr. Claus Gutzschebauch (Henkel AG & Co. KGaA) und Dr. Hans-Jürgen Klüppel.
Kapitel 11.5: Dr. Roland Schröder (Henkel AG & Co. KGaA). Herrn Dr. Thomas Herbrich (fit GmbH), Herrn Armin Pillkahn (Luhns GmbH) und Herrn Dr. Bernd Wolff-Schladitz (Dalli-Werke GmbH & Co. KG) danke ich für die vielen Hintergrundinformationen und wertvollen Hinweise zu den Kapiteln 5 und 6, Herrn Dr. Schmiedel (Henkel AG & Co. KGaA) für die wertvollen Hinweise zu Kapitel 3.
Dem Verlag Wiley-VCH danke ich für die ausgezeichnete Koordination und allzeit gute Zusammenarbeit.
Vorwort
Waschmittel begegnen uns täglich im Haushalt, in der Werbung und im Supermarkt. Sie werden von uns allen mit großer Selbstverständlichkeit genutzt, doch wissen wir eigentlich, wie moderne Waschmittel zusammengesetzt sind und wie die Inhaltsstoffe wirken? Was ist z. B. das Besondere an Colorwaschmitteln? Wie kann ich nachhaltig umweltverträglich waschen? Seit wann gibt es eigentlich moderne Waschmittel?
Diese und viele andere Fragen wird Ihnen das vorliegende Buch „Waschmittel - Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit“ beantworten. Das Werk bietet eine naturwissenschaftlich fundierte Einführung in das umfangreiche Gebiet der Waschmittelchemie, stellt die wichtigen Neuentwicklungen der letzten Jahre vor und beschreibt die Auswirkungen des Waschens auf die Umwelt. Seinen besonderen Reiz erhält der Themenkreis Waschmittel durch die enge Verknüpfung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse mit technologischen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturhistorischen Aspekten. Die Entwicklung der modernen Waschmittel wird dabei am Beispiel der Rezeptur eines Markenwaschmittels von 1907 bis heute genauer nachvollzogen.
Jedes Jahr sind Innovationen und Veränderungen im Bereich der Waschmittelchemie und insbesondere auch beim Waschen insgesamt zu verzeichnen. Nachdem die dritte Auflage aus dem Jahr 2005 schon wenige Jahre nach Erscheinen vergriffen war, haben wir - Autor und Verlag - uns entschlossen, für die vierte Auflage alle Kapitel zu überarbeiten und zu aktualisieren, um den vielen Innovationen der letzten Jahre Rechnung zu tragen. Die Strukturierung des Buches hat sich bewährt und ist deshalb beibehalten worden, zu einigen Themen sind neue Unterkapitel hinzugekommen. Insgesamt sind alle wesentlichen Neuentwicklungen der letzten Jahre in der Neuauflage berücksichtigt worden. Dazu zählen u. a. die Niedrigtemperaturwaschmittel, lösliche Enthärtersysteme bei Pulverwaschmitteln, hochkonzentrierte Flüssigwaschmittel oder die Aktivitäten zum „nachhaltigen Waschen“.
Die einzelnen Kapitel des Buches sind weitgehend eigenständig konzipiert, so dass sie auch sehr gut auszugsweise genutzt und gelesen werden können. In jedem Kapitel finden sich Querverweise zu anderen Kapiteln, so dass Zusammenhänge deutlich werden. Dies macht das Buch zu einem Nachschlagewerk, Lehrbuch und Studienbuch in einem. Alle zentralen Themen werden mit der nötigen fachlichen Tiefe abgehandelt, jedoch soll eine Beschränkung auf das Wesentliche helfen, den Überblick zu bewahren. Im Text häufig benutzte Abkürzungen sind in einem Abkürzungsverzeichnis am Ende des Buches zusammengefasst.
Das Buch wendet sich an alle Leserinnen und Leser, die sich mit dem Thema Waschmittel näher beschäftigen wollen. Die Konzeption des Buches ist so angelegt, dass ein breiter Leser- und Benutzerkreis angesprochen werden kann: Alle, die beruflich mit dem Thema Waschmittel und Waschen zu tun haben; Lehrerinnen und Lehrer der naturwissenschaftlichen Fächer; interessierte Schülerinnen und Schüler; Studierende der Naturwissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen; Arbeitskreise, Initiativen und Verbände, die sich mit dem Thema Waschmittel näher auseinandersetzen wollen; Fachkräfte im Bereich der Beratungstätigkeit für Verbraucher- und Umweltfragen und interessierte Auszubildende und Berufstätige im Bereich der Chemie, der Textilberufe und der Hauswirtschaft.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Günter Wagner
Kassel, im Dezember 2009
1
Partner beim Waschprozess
1.1 Einführung
Das Ziel des Waschens ist die Wäschepflege. Dazu gehören nicht nur die Schmutzentfernung, sondern auch ein einwandfreier hygienischer Zustand der Wäsche und die Erhaltung des Gebrauchswertes. Die Ansprüche an das Waschergebnis sind sehr hoch und nur erfüllbar durch das optimale Zusammenwirken der am Waschprozess beteiligten Partner
Wäscheschmutz,Wasser,Textilien,Waschgeräte,Waschmittel.Waschmittel können also nicht isoliert gesehen werden, sondern sind im Waschprozess eng mit den anderen genannten Faktoren verbunden. Kapitel 1 wird alle Partner im Waschprozess kurz vorstellen, bevor näher auf die Waschmittelchemie eingegangen wird.
Die Abhängigkeiten der Waschfaktoren untereinander lassen sich sehr anschaulich am sogenannten Waschkreis nach Sinner zeigen (Abb. 1.1). In dieser Abbildung wird beispielhaft das Waschen in der Trommelwaschmaschine aus den 1960er Jahren (90°C-Waschgang) einem heute gebräuchlichen Verfahren (40°C-Waschgang) gegenübergestellt. Man sieht, dass sich die Bedeutung der Waschfaktoren deutlich verlagert hat.
Abb. 1.1 Vergleich der Einflussfaktoren beim Waschen unter verschiedenen Waschbedingungen (Waschkreis nach Sinner).
Vor ca. 50 Jahren (in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts) war der Kochwaschgang zumindest bei stärker verschmutzter Wäsche üblich. Der über-wiegende Anteil der Textilien war aus Baumwolle und weiβ. Die Waschmaschinen waren auf starke mechanische Reinigungswirkung ausgelegt. Der Wasserverbrauch war hoch.
Heute ist eine zentrale Forderung ein mölichst geringer Energieeinsatz und Wasserverbrauch beim Waschen. Zusäzlich steht der Wunsch nach wenig Zeitaufwand im Vordergrund. Dabei erwarten die Verbraucher eine unveräert hohe Waschqualitä sowie Schonung und Werterhalt auch von farbigen und empfindlichen Textilien. Als Folge davon ist die Waschtemperatur deutlich gesunken, die Waschgänge sind kürzer und die Mechanik der Waschmaschinen ist schonender geworden. Der Anteil der Chemie am Waschprozess muss notwendigerweise höher sein als früher. Leistungsfähige Waschmittel sind heute der wichtigste Faktor für den Wascherfolg.
1.2 Der Wäscheschmutz
Unter Schmutz versteht man gemeinhin alles, was nicht auf Textilien gehört und von Auge, Nase und Haut als unangenehm empfunden wird bzw. aus hygienischen Gründen entfernt werden muss. Hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung ist der Schmutz nahezu unbegrenzt variabel. Trotzdem lässt sich eine Einteilung in sechs groβe Gruppen von Schmutzarten vornehmen, die grundsätzlich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen (Abb. 1.2).
Abb. 1.2 Wichtige Bestandteile von Wäscheschmutz.
Der durchschnittliche Schmutzanteil bei normal verschmutzter Wäsche beträgt 1,3% des Wäschegewichtes. Bei einer Waschladung von 5 kg entspricht dies etwa 65 g Schmutz. Nur ein geringer Teil des Schmutzes (20-25%) ist wasserlöslich. Der weitaus gröβte Teil lässt sich erst durch Tenside und mit Hilfe von Mechanik vom Waschgut entfernen. Ein Teil des Wascheschmutzes (dazu gehören u. a. Farbstoffe und proteinhaltiger Schmutz) lässt sich erst nach chemischer Veränderung beseitigen.
Über 60% der Wäschestücke kommen beim Tragen mit dem Körper in Berührung (Abb. 1.3) [1].
Abb. 1.3 Textilien in einer durchschnittlichen Waschladung.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass der mengenmäβig gröβte Anteil des Wäscheschmutzes durch den direkten Kontakt zwischen Wäsche und dem menschlichen Körper verursacht wird (Abb. 1.4).
Abb. 1.4 Durchschnittliche Zusammensetzung von Wäscheschmutz.
Für die Schmutzhaftung auf der Faser sind folgende Effekte von Bedeutung: Mechanische Haftung: Feinverteilter Schmutz lagert sich in Faserhohlräume oder zwischen den Fäden ein und wird dort praktisch „eingeklemmt“.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!