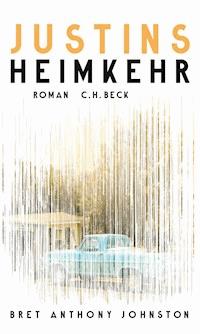23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jaye und ihre Mutter machen sich auf nach Waco, Texas, um sich der Glaubensgemeinde des charismatischen und gefährlichen Anführers Lamb anzuschließen. Dort angekommen lernt Jaye Roy kennen, den Sohn des Sheriffs, und die beiden Teenager spüren eine nie gekannte Verbindung. Roy ahnt nicht, dass Jaye auf der Ranch des religiösen Fanatikers lebt, der sich für den neuen Messias und die Behörden in Atem hält. Was geht innerhalb der zurückgezogen lebenden Sekte vor sich?
"We Burn Daylight" ist eine zeitlose Auseinandersetzung mit Gewalt und Religion, dem Wunsch nach Zugehörigkeit und dem Drang, sich freizukämpfen. Die einfühlsam erzählte, zarte Liebesgeschichte zwischen Jaye und Roy führt zu den drängenden politischen Fragen unserer Gegenwart.
Texas, 1993: Menschen aus dem ganzen Land machen sich auf nach Waco. Sie verkaufen ihre Häuser und beenden ihre Ehen, um zu Füßen eines Landschaftsgärtners zu beten, der sich selbst zu einem Propheten namens Lamb ernannt hat und nun gemeinsam mit seinen Anhängern das Eintreten von Gottes Prophezeiung für die letzten Tage der Menschheit erwartet. Jayes Mutter ist eine der jüngsten und gläubigsten Anhängerinnen von Lamb, Jaye selbst zweifelt an seinen Methoden – und an seinen Beweggründen. Roy ist der jüngste Sohn des örtlichen Sheriffs, ein Vierzehnjähriger mit einem Sinn für Ärger, der sich in Jaye verliebt. Die beiden Teenager fühlen sich sofort zueinander hingezogen, doch die Folgen dieser Liebe sind für die beiden unabsehbar. Denn Lamb hat Pläne für sie alle – auch für Jaye …Basierend auf den wahren Ereignissen, die sich während der Belagerung der Sekte «Branch Davidians» zugetragen haben, gelingt Bret Anthony Johnston eine unvergessliche Liebesgeschichte, ein bewegender literarischer Pageturner und eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Glauben, Familie und dem, was es wirklich bedeutet, gerettet zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
BRET ANTHONY JOHNSTON
WE BURN DAYLIGHT
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Sylvia Spatz
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Motto
ERSTER TEIL: Das weiße Pferd – Januar
1993
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
Jaye
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
Jaye
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
ZWEITER TEIL: Das feuerrote Pferd – Februar
1993
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
ÜBER DAS LAMM
DRITTER TEIL: Das schwarze Pferd –
17
. Februar
1993
Jaye
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
Jaye
VIERTER TEIL: Das fahle Pferd – Februar bis März
1993
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
Jaye
ÜBER DAS LAMM
Roy
ÜBER DAS LAMM
ÜBER DAS LAMM
Epilog –
31
. Juli
2024
Elisabeth
Danksagung
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für Bill –der ein bisschen mehr wert ist als ein vergoldeter Susan B. Anthony-Dollar
Motto
We think the fire eats the wood. We are wrong. The wood reaches out to the flame.
Jack Gilbert, «Harm and Boon in the Meetings»
Wir glauben, Feuer würde Holz verzehren. Wir irren. Das Holz streckt sich dem Feuer entgegen.
We burn daylight …
Romeo and Juliet
Ein Hallo an euch alle. Guten Tag. Oder auch Abend. Tut mir leid, dass ich spät dran bin, aber wir hatten Ärger auf der Ranch. Wie ihr mittlerweile sicher gehört habt, nennt man mich mittlerweile Lamb, Lamm, was auf jeden Fall netter ist als so manches, was man mich schon geheißen hat. Wie auch immer, es waren ein paar Hubschrauber gegen uns im Einsatz. Ich will hier niemanden provozieren. Ich find’s toll, dass ihr mir zuhören wollt, ganz im Ernst. Okay, also, heute ist der 18. Februar 1993 im Jahr des Herrn, und ich will euch übers Radio in euren Wohnzimmern und Autos und Geschäften was über die Offenbarung von Jesus Christus erzählen. Denn darum geht’s hier eigentlich. Ihr alle, die ihr zuhört, wisst, Gottes Standard, was Gerechtigkeit angeht, ist Gesetz. Es handelt sich um ein System aus Ursachen und Folgen, das immer schon existiert hat. Wenn ein Mensch das Gesetz Gottes brach, musste er das Blut eines unschuldigen Lamms opfern. Es gab auch noch andere Opfertiere – Turteltauben, Ziegen, Ochsen, rote Kühe und so weiter. Nicht sehr angenehm, kann ich euch sagen. Aber solche Opfer hielten einen Menschen möglicherweise von der Sünde ab, stimmt’s? Sonst hätte er ziemlich schnell sein ganzes Vieh verloren, und dann? Ende, das wär’s dann gewesen. Na ja, mittlerweile befinden wir uns ziemlich genau an diesem Punkt: Es ist die Zeit des Leidens gekommen, das Warten ist vorbei. Uns ist das klar. Wir haben uns darauf vorbereitet, unsere Uhren im Blick behalten. Wie wird das alles enden?, fragt ihr. Wer wird für uns alle sein wertvolles Blut opfern? Na ja, schauen wir mal. Lasst uns das jetzt endlich ein für alle Mal herausfinden, einverstanden?
ERSTER TEIL
Das weiße Pferd
Januar 1993
Roy
In jenen feuchtkalten ersten Wochen des Jahres 1993, bevor meine Familie zerbrach, und vor dem Brand im März, bevor alle Welt uns ins Rampenlicht setzte, vor ihr und allem, was mich verändert hat, war ich vierzehn und brachte mir bei, wie man Schlösser aufbricht. Ich konnte Autotüren mit Drahtbügeln öffnen, die Schlösser an den Kabinen in der Schule mit einem Taschenmesser aufbrechen, und die meisten anderen schaffte ich mit den Werkzeugen, die mein Bruder mir geschickt hatte. Mason war Kadett bei der Marine gewesen, aber nach dem Krieg im Irak geblieben und arbeitete seitdem unter Zeitverträgen. Er war gerade einundzwanzig geworden. Wir hatten ihn schon lange nicht mehr gesehen, und obwohl man für den Herbst mit seiner Rückkehr rechnete, stellte ich mir die Zukunft eigentlich immer ohne ihn vor. Manchmal, wenn ich an einem kniffligen Schloss zugange war, stellte ich mir vor, Mason säße auf der anderen Seite der Tür fest und sein Leib und Leben hingen davon ab, dass ich sie rechtzeitig aufbekam. Manchmal gelang es mir, ihn zu retten, manchmal nicht.
Meine Eltern wussten nichts von Masons Werkzeug-Set oder dem Kopfkissenbezug mit Schlössern unter meinem Bett und auch nichts davon, dass ich stundenlang an ihnen übte, wenn ich eigentlich hätte schlafen oder lernen sollen. Meine Mutter arbeitete als Krankenschwester in einem Hospiz, und mein Vater war der Sheriff von McLennan County. Die beiden waren mit ernsteren Themen beschäftigt. Beim Abendbrot sprach einer von uns das Tischgebet, und dann erzählte jeder ein bisschen was von seinem Tag, sie von ihrer Pflege der Kranken und Schwachen, er von seinem Tag im Sheriffbüro und ich von der Schule. Wir waren keine Familie, in der geratscht und getratscht wurde. Jeder kümmerte sich um sein eigenes Leben und ließ den anderen große Freiräume. Sie wussten, dass Rosie während der Weihnachtsferien mit mir Schluss gemacht hatte, aber sie wussten nicht, dass ich seither nach der Schule nicht mehr den Bus nahm, weil ich nicht mitansehen wollte, wie sie während der ganzen Fahrt bei Isaac Garza auf dem Schoß saß. Und ich wusste, dass meine Eltern, die von sich behaupteten Nichtraucher zu sein, im Garten hinterm Haus gemeinsam rauchten, wenn sie Sorgen im Job hatten oder sich welche um Mason machten. Aber bei Tisch wurde über so was kein Wort verloren. Wir lauschten nur den Geräuschen von unseren Messern und Gabeln, von Gläsern, die aufgenommen und wieder abgestellt wurden. Wir baten einander um die frittierten Okraschoten oder das Glas mit der Tartarsoße. Wir sprachen davon, wie schön es sein würde, wenn Mason erst wieder zu Hause war, und spekulierten darüber, was er wohl als Erstes zu essen haben und unternehmen wollte. Wir machten Pläne für eine glücklichere Zukunft. Derart unbedarft und naiv waren wir. So war Waco damals.
ÜBER DAS LAMM
Podcast-Folge 12
Gast: Sheriff Elias «Eli» Moreland (im Ruhestand)
Aufgenommen: Juli 2024
Zentralbibliothek von Waco-McLennan County
Waco, Texas
Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Bei diesem Podcast war es mir von Anfang an ein Anliegen, dass meine Hörer Ihre Sicht auf die Ereignisse erfahren. Sie waren bis 1993 Sheriff von McLennan County. Sammy Gregson war Ihr Stellvertreter. Ihr Sohn war …
Sammy hat gerochen, was bevorstand, und zwar noch vor mir. Das muss ich ihm zugestehen. Alles andere, was ich dazu noch sagen könnte, werde ich für mich behalten.
Einverstanden.
Ich bin jetzt seit dreißig Jahren weg von hier. Mittlerweile unten in Camp Verde. An den meisten Tagen ist das immer noch zu nah.
Ich glaube, in der Bibliothek ist das Rauchen nicht erlaubt.
Falls du hören willst, was ich zu sagen habe, musst du dich damit abfinden. Ich kann mich auch gern wieder ins Auto setzen und bleibe dann später nicht im Verkehr stecken. Deine Entscheidung.
Ich schau mal, ob ich einen Aschenbecher auftreiben kann.
Schau mal, ob du nicht gleich ein paar mehr auftreibst.
Roy
Wir wohnten am westlichen Stadtrand, wo die Blackland-Prärie in Sumpf überging. Hektarweise nichts als Gestrüpp und Süßgras zwischen uns und den nächsten Nachbarn. Unser Haus war eine Ranch mit einem baufälligen Zaun und zwei Schlafzimmern. Eine von Wurzeln höckrige Einfahrt, innen holzgetäfelte Wände, ein Küchentresen in Avocadogrün und ein Wandtelefon in der gleichen Farbe. Ich hatte das Eckzimmer nach hinten raus, Richtung Norden, mit einem verfilzten braunen Teppichboden. Mason und ich hatten es uns mal geteilt, aber nachdem er zum Militär gegangen war, benutzte ich sein Bett, um dort meine gewaschenen und gefalteten Klamotten abzulegen, denn an meiner Kommode gingen die Schubladen nicht mehr auf. Ich hatte zwei Fenster und einen Fernseher, den meine Eltern billig beim Olde Towne Motel erstanden hatten, als es dichtmachte. An den Wänden hingen Poster von den Houston Oilers und The Terminator und von einem Monstertruck, der sich nach hinten überschlägt. Die Wand auf Masons Seite war von einem gigantischen Semper-Fi-Banner der US-Marine bedeckt. Eigentlich hatte ich vorgehabt, meinen Teil des Zimmers während der Weihnachtsferien anders zu gestalten und meine Möbel umzustellen, aber nachdem Rosie mit mir Schluss gemacht hatte, verging mir die Lust dazu.
Mason rief an Feiertagen an und, wenn er konnte, jeden dritten Sonntag im Monat; er benutzte ein Satellitentelefon, mit dem er noch weiter entfernt klang, als er es ohnehin war, und seine Worte waren wie ein Echo aus der Vergangenheit. Fotos oder Briefe schickte er nur selten, und dann hängte meine Mutter sie mit einem Obstmagneten an den Kühlschrank. Mehr als einmal traf ich sie in der Küche an, damit beschäftigt, das, was er geschrieben hatte, noch einmal zu lesen, als suchte sie zwischen den Zeilen nach einer Nachricht, einem bislang übersehenen Hinweis. Es hatte ihr wehgetan, dass Mason nach seinem Einsatz vor Ort geblieben war. In ihren Augen forderte er das Schicksal heraus, und sie betrachtete es auch als Affront: Er hatte die Chance gehabt, zu uns zurückzukehren, und er hatte sie abgelehnt. Ich sah das wie sie, und obwohl wir zu Hause einvernehmlich darüber schwiegen, hatte ich doch Sorge, dass einer von uns seiner Verbitterung irgendwann Luft machen würde. Oder dass einem von uns etwas über die Lippen kam, das uns, falls er nicht nach Hause zurückkehrte, leidtat. Wenn sie in der Küche nicht merkte, dass ich hinter ihr stand, stahl ich mich wieder hinaus und schloss mich in mein Zimmer ein. Ich zog irgendein Schloss aus dem Kopfkissenbezug und fummelte so lange daran herum, bis ich es aufgebrochen hatte, und erst dann wagte ich mich zurück in die Küche. Falls sie mich aber registriert hatte, taten wir beide so, als wäre einer ihrer Patienten der Grund für ihre Tränen.
«Mr. Raybourn tritt vielleicht schon bald vor seinen Schöpfer», sagte sie eines Abends Anfang Januar. Ich war in die Küche gekommen, um Milch zu trinken, und sie wischte sich gerade über die Augen. Darauf öffnete sie den Kühlschrank und ging hinter der Tür in die Hocke, um sich wieder zu sammeln.
«Das ist der mit dem Dackel», sagte ich.
«Genau der.»
«Einen Dackel hatten wir bisher noch nicht.»
Unsere Haustiere stammten alle von Patienten meiner Mutter. In manchen Fällen hatten deren Besitzer meine Mutter in ihr Testament aufgenommen, in anderen appellierten die Hinterbliebenen an ihr schlechtes Gewissen, damit sie ein Tier bei sich aufnahm. Einmal hatten wir sage und schreibe vier Hunde und drei Katzen. Wir hatten auch schon einen blauen Papagei und ein paar Sumpfschildkröten. Entweder arbeitete meine Mutter oder sie suchte für hinterbliebene Tiere ein neues Zuhause. Und zwar ein Für-immer-Zuhause, wie sie es nannte. Sie setzte Anzeigen in Zeitungen, kontaktierte Tierärzte und Farmer, überredete Freunde. Sie hatte dem Jugendklub an meiner Schule Ziegen geschenkt, dem städtischen Museum ein Aquarium mit grellbunten Fischen und der Mutter meines Freundes Coop einen alten Hund, der es dann aber nicht mehr lange machte. Falls sie für Tiere kein neues Heim fand, schafften wir sie zu meinen Großeltern. Sie besaßen Land in der Nähe von San Saba und nahmen alles auf, zu dem andere Nein gesagt hatten. In jenem Januar hatten wir lediglich eine schwarz-weiße Katze namens Panda bei uns. Sie blieb tagelang verschwunden, und obwohl wir sie noch nicht lange hatten, fühlte sich das Haus ohne sie leer an.
«Mason mag Dackel», sagte ich, und zwar nicht, weil das unbedingt stimmte, sondern weil sich die Stimmung meiner Mutter manchmal aufhellte, wenn der Name meines Bruders fiel.
«Ach ja?» Sie nahm ein Bier aus dem Kühlschrank und suchte in einer Schublade nach dem Flaschenöffner. Die Uhr an der Wand machte ihr Tick, Tick, Tick. Meine Mutter hatte sie einige Zeit zuvor anlässlich einer Werbekampagne von einem Lebensmittelmarkt geschenkt bekommen, und anstelle von Zahlen hatte sie Singvögel. Sie sagte: «Na, da wird er sich im September freuen. Ja, bestimmt wird er ganz aus dem Häuschen sein.»
ÜBER DAS LAMM
Podcast-Folge 12
Gast: Sheriff Elias «Eli» Moreland (im Ruhestand)
Aufgenommen: Juli 2024
Zentralbibliothek von Waco-McLennan County
Waco, Texas
Hier gibt es keine Aschenbecher.
Ich find schon was.
Falls jemand von der Bibliothek …
Ich war nett zu diesen Leuten, unvoreingenommen. Wenn es irgendwo Ärger gab, habe ich Perry angerufen und ihm gesagt, er soll vorbeikommen, damit wir das in Ordnung bringen. Zivilisiert. Offen und ehrlich. Ich habe auch das Jugendamt hingeschickt. Keine Beanstandungen. Diese Leute hatten ihre Überzeugungen, aber es wurde nicht gegen Recht und Ordnung verstoßen.
Für uns waren sie wie ein fremdes Land, ein Territorium mit eigenen Gebräuchen. Sie sind mehr oder weniger unter sich geblieben. Wenn sie mal in die Stadt kamen, waren sie höflich und unauffällig. Die haben sich nie aufgedrängt oder einem Pamphlete in die Hand gedrückt, haben nie religiöses Zeug gebrabbelt. Sie waren freundlich. Ich habe bis zum letzten Moment versucht, die Razzia zu stoppen.
Roy
Mein Vater war bereits vor Masons Geburt der örtliche Sheriff gewesen. Davor hatte Grandpa Huey das Abzeichen getragen. Der Plan war, dass Mason nach Hause kommen, zum Stellvertreter ernannt und, sobald mein Vater in den Ruhestand ging, für das Amt kandidieren würde. Er war unter anderem deshalb zur Marine gegangen, weil Huey einst in Korea gekämpft hatte. Als Kriegsheld gewann man Wahlen. Auch wenn niemand gegen ihn antreten würde. Für die Wähler in McLennan County war der Name Moreland untrennbar mit dem Sheriffsamt verbunden. Mein Vater hatte bei den letzten beiden Wahlen keinen Gegenkandidaten gehabt. An seinem Gürtel trug er einen Pager und eine Pistole, einen Colt Python. Die Leute mochten ihn, hielten ihn für fair, suchten seine Gunst. Er musste nur selten für sein Essen bezahlen oder fürs Bügeln der Uniform. Sein Büro befand sich im öden Erdgeschoss des alten Gerichtsgebäudes aus Kalkstein, aber an Weihnachten wurde es dort immer hell und froh, und es türmten sich die Geschenkpäckchen von wildfremden Leuten.
Zu manchen Festnahmen nahm er mich mit. In den meisten Fällen ging es ruhig zu, aber ich hatte auch schon mitbekommen, dass man mit Steakmessern auf ihn losging und ihn einen Abhang runterdrängen wollte, der in den Cypress Creek abfiel. Ihm lag daran, dass ich mit eigenen Augen sah, wie Leute, die wir kannten – Supermarktkassierer, Mitglieder der Kirchengemeinde –, nicht mehr sie selbst waren, sobald es in ihrem Leben nicht mehr lief, wie es sollte. Männer, sonst heimtückisch wie Giftschlangen, fielen weinend auf die Knie. Frauen, die im Elternbeirat saßen, fluchten und schlugen mit den Fäusten gegen Wände. «Dass man die Nacht nicht zu Hause, sondern im Gefängnis verbringt, liegt meistens daran, dass der Tag schlecht gelaufen ist», sagte mein Vater jedes Mal, wenn wir zu jemandem nach Hause fuhren. Ich hörte Straftäter flehen, Alibis erfinden, mit Drohungen um sich werfen. Er blieb stets gelassen, mit leiser kontrollierter Stimme. Auch wenn es eng für ihn wurde, blieb er gefasst. «Alles okay», sagte er zu jedem, der auf ihn losging. «Lass nur alles raus. Ist schon in Ordnung.»
Bei jeder Verhaftung versuchte ich mir vorzustellen, wie ich selbst einen Mann vor den Augen seiner Familie verhaftete oder einem Teenager seine Rechte verlas, während die Eltern ohne Hoffnung und machtlos dabeistanden. Nicht mal in meiner Fantasie bekam ich das hin. Der Mann entkam mir, bevor ich die Handschellen angelegt hatte. Der Teenager bettelte, und ich beließ es wie ein Idiot bei einer Verwarnung. Wenn wir dann wieder ins Büro zurückkehrten, hatte ich meinen Vater im Geiste unzählige Male enttäuscht. Ich hatte keine Ahnung, was ich mal werden oder wo ich arbeiten oder leben wollte, aber ich wusste, dass ein Leben wie das von meinem Vater – und Bruder und Großvater – nichts für mich war. Ich betete nicht so oft, wie ich sollte, aber wenn ich es tat, dann betete ich dafür, weniger ängstlich zu sein.
Und so wappnete ich mich auf meinem Heimweg von der Schule innerlich, als der Bronco von meinem Vater am Straßenrand anhielt. Es war am Freitag in der zweiten Januarwoche. Der Himmel an jenem Nachmittag war schiefergrau, und der Nieselregen hatte meine Jacke durchweicht. Er sagte: «Willst du einsteigen, Detektiv?»
Seinen cremefarbenen Stetson hatte er tief ins Gesicht gezogen, das Hutband war dunkel vom Schweiß vieler Jahre. Er trug von jedem von uns – meinem Bruder, meiner Mutter und mir – ein Bild mit sich, das er im Hutfutter befestigt hatte. Seine Thermoskanne rollte auf meiner Seite unten auf dem Boden hin und her. Die Heizung knatterte vor sich hin.
«War der Bus heute voll?»
«Ich hatte Lust zu laufen», sagte ich. Ich rieb mir die Hände zwischen den Knien.
«Bei eiskaltem Regen.»
«Weiß auch nicht», erwiderte ich.
Wir fuhren an der Live Oak Mall vorbei, die mit Brettern verbarrikadiert war. In meiner Kindheit war dort immer richtig was los gewesen – ein zweistöckiger Bau mit einem gläsernen Aufzug und Brunnen aus Mosaiksteinen. Meine Mutter kaufte dort mit Mason und mir Kleidung für die Schule ein, und meinem Vater schmeckte bei Woolworth immer das Salisbury Steak. Aber mit den Outlets draußen an der Bundesstraße war es mit der Mall vorbei. Nach der Schließung war mein Vater mal gerufen worden, weil eine Gruppe von Pennern drinnen ein Lagerfeuer machte. Ein andermal war jemand eingebrochen und hatte die Wände mit Graffiti beschmiert. Mittlerweile war das Grundstück von einem Sicherheitszaun umgeben.
Ganz oben auf einem Telefonmast saß ein Truthahngeier, das schwarze Gefieder dick aufgeplustert, um sich bei dem Wind warmzuhalten, drehte seinen hässlichen roten Kopf hin und her und behielt die Felder im Auge. Wäre meine Mutter bei uns gewesen, hätte sie gesagt: «Er ist auf der Suche nach seinem Abendessen.» Jedes Mal, wenn ich einen Habicht oder Geier sah, hörte ich ihre Stimme diesen Satz sagen, auch wenn sie gar nicht da war. Meinem Vater ging es wahrscheinlich genauso. Die Sonne war vor einer Stunde untergegangen, vielleicht auch etwas früher. Wir fuhren gen Osten, mithin nicht nach Hause.
«An diesem Wochenende findet eine Waffenshow statt», sagte mein Vater. «Heute Abend sind die Early Birds dran. Ich dachte, wir könnten mal vorbeischauen.»
«Wir könnten was für Mason besorgen. Mom packt gerade ein Päckchen für ihn.»
«Die Snack-Bar hat wahrscheinlich auch auf», warf er ein. «Da gibt es diese Frito Pies.»
«Ich habe ziemlich viel zu Mittag gegessen», gab ich zurück. Ich hatte die Mittagspause damit verbracht, durch die Schulgänge zu streifen. Dabei hatte ich ein paar Schließfächer aufgebrochen, in denen ich aber erwartungsgemäß nur haufenweise Süßigkeiten und Zigaretten vorfand.
«Deine Mutter meint, du hast abgenommen, seitdem mit Rosie Schluss ist», begann er. Nach den vielen Regentagen führte der Brazos River reichlich Wasser, das schaumig dahinfloss. Die Eschen am Ufer hatten ihr Laub fast verloren, ihre kahlen Äste sahen aus wie an den Himmel schraffiert. Alles war tropfnass und farblos wie nach zu langem Waschen. «Ein Hungerstreik bringt sie dir nicht zurück.»
«Weiß ich», sagte ich. Zu unserer Linken erstreckte sich ein kleiner Flugplatz mit einer einzigen Rollbahn. Am Hangar standen ein paar Cessnas. Meine Eltern waren mit Mason und mir hin und wieder dorthin gefahren, und wir schauten den Piloten bei ihren Landeübungen zu.
«Sammy hat mich eben angerufen», sagte er. «Klingt, als würde sich da was zusammenbrauen.»
«Mit Lamb?»
«Ich nehm’s mal an.»
Sammy Gregson war gerechtigkeitsliebend und jähzornig. Er war Katholik, ging drei Mal in der Woche zur Messe, bekreuzigte sich oft und arbeitete als stellvertretender Sheriff. Im Winter hatten die Sheriffs alle Hände voll zu tun – die Leute verfügten über mehr Geld oder auch weniger als sonst, waren mit einem Mal mit ihrer Familie zusammengepfercht, der sie für den Rest des Jahres aus dem Weg gingen, und sie tranken zu viel – und so hatte Sammy in der letzten Zeit Extra-Schichten einlegen müssen.
Der Nieselregen hatte mittlerweile dafür gesorgt, dass man durch die Windschutzscheibe so gut wie nichts mehr sah, aber mein Vater schaltete noch immer nicht die Scheibenwischer ein. Er wartete damit immer so lange wie möglich. Vielleicht kam es ihm so vor, als würde er aufgeben. Er schätzte Beharrlichkeit – «Er hat die Ausdauer von einem Bussard, der über einem kranken Kalb kreist», pflegte meine Mutter zu sagen – und oft schien es, als wollte er sich auf die Probe stellen und seine Entschlossenheit trainieren.
«Hast du mich gehört, Detektiv?», sagte mein Vater.
Ich wandte ihm mein Gesicht zu. Über die Windschutzscheibe rann Regenwasser, und man sah alles verschwommen. «Was?»
«Ich habe gesagt, es wird nicht für immer wehtun. Du kommst darüber hinweg.»
«Okay», sagte ich.
«Glaub mir», sagte er und schaltete die Scheibenwischer ein. «Bald ist das alles tiefe Vergangenheit.»
ÜBER DAS LAMM
Podcast-Folge 7
Gast: Sammy Gregson
Aufgenommen: Januar 2024
Immobilienmakler Keller-Williams
San Antonio, Texas
Sie waren Sheriff Morelands Stellvertreter.
Eli ist ein guter Typ. Selbst wenn wir uns nicht einig waren, war mir das immer klar. In meinem Fall könnte man behaupten, dass ich das bekommen habe, was ich verdient habe, aber für ihn gilt das nicht.
Sie arbeiten nicht länger in der Strafverfolgung.
Dieses Kapitel meines Lebens endete im Mai 1993.
Überrascht es Sie, dass einige der Überlebenden weiterhin an ihren Überzeugungen festhalten?
Die haben eine Gehirnwäsche hinter sich, mein Lieber. Die werden ihn immer als Heiligen hinstellen. Perry konnte bei Leuten das Unterste zuoberst kehren, ihre Höhen und Tiefen für sich hindrehen, wie er’s brauchte.
Roy
Ich will mal gleich etwas richtigstellen, und zwar als Erster und Einziger: Perry Cullen war nicht charismatisch. Er war nicht eloquent oder intelligent. Er prahlte damit, dass er die Schule noch vor Abschluss der achten Klasse verlassen hatte. In seiner Jugend nannten ihn die anderen irgendwann schwuler Perry und verprügelten ihn dermaßen oft, dass seine Mutter ihn zu Hause behielt. Sie war eine Prostituierte, womit er sich ebenfalls brüstete. «Ich bin der Sohn einer Hure und dem Samen ihres Gauners von Ehemann entsprungen», pflegte er zu sagen. Er sah auch nicht gut aus. Er trug eine Brille mit Gläsern, dick wie Glasbausteine, und musste trotzdem die Augen zusammenkneifen, wenn er in der Bibel lesen wollte.
Aber die Leute vertrauten ihm. Sie nahmen sich seine Behauptungen bei der Auslegung der Bibel zu Herzen und hatten dabei ein glasiges, entrücktes Leuchten in den Augen. Sie überschrieben ihm ihre Ersparnisse und Renten. Verkauften Häuser und Besitz, gaben ihren Beruf auf und siedelten ihre Familien um, um in elenden Verhältnissen gut fünfunddreißig Kilometer außerhalb der Stadt zu hausen. Ihre Tage kreisten um das Bibelstudium, was jeweils bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang stattfand. Wenn Perry eine klare Botschaft empfing, konnte er stundenlang daherreden. Er aß am Rednerpult Spinat aus der Dose. Trank den Gemüsesaft. Etwa ein Jahr vor dem Brand nannten sie ihn irgendwann The Lamb, «Das Lamm».
Wenn sie nicht gerade mit Gott beschäftigt waren, trugen sie Holz und Werkzeuge zusammen, um etwas auf dem Stück Land – ein paar hundert Hektar, das meiste davon Gestrüpp und niederes Buschwerk – zu errichten. Perry hatte das Land von einer älteren Frau geschenkt bekommen, die viele für seine Mätresse hielten. Seine Anhänger errichteten zuerst das Gebetshaus, dann die Wohnbaracken mit der Küche, eine Sporthalle und eine Mensa. Der Bau ging nur schleppend, in einem chaotischen Stop-and-go voran, und alles hing davon ab, welche Materialien gerade am erschwinglichsten waren. Es gab Strom und eine Telefonleitung, aber nur in der Küche fließendes Wasser. Oben auf dem Hügel wurden für Vieh eine Weide eingezäunt und Pferdeställe errichtet. Es gab einen kleinen Teich, in dem die Leute schwammen und sich badeten und die Frauen die Kleidung der Glaubensgemeinde wuschen.
Und es gab einen Schießstand, der für Perry eine gute Einnahmequelle war. In den Wochen vor der Jagdsaison kam er kaum hinterher mit der Beschaffung von Papier-Targets. Ihm gefiel es, sich an den Schießübungen seiner Kunden zu beteiligen, mit seinen Waffen zu prahlen und sich über das Recht auf freien Waffenbesitz, das Second Amendment, auszulassen. Mein Vater hatte mich ein, zwei Mal dorthin mitgenommen. Auf einem handgeschriebenen Schild stand: Kinder unter zwölf schießen umsonst.
Außerdem mietete die Gemeinde bei an Wochenenden stattfindenden Waffenshows Stände. Dort wurden dann Waffen, Munition und Gadgets – T-Shirts und Baseball-Mützen – verkauft. Am besten gingen sogenannte Bullet Bibles. Auf den ersten Blick sahen sie aus wie ganz gewöhnliche Bibeln, aber innen in dem Hohlraum lagen Revolver und halbautomatische Pistolen. Einmal erstand mein Vater zum Scherz eine für meinen Großvater. Alle lachten, als Grandpa Huey sie zu Weihnachten auspackte. Ein Jahr später schickten wir Mason eine in den Irak.
An einem Abend für Early Birds im Januar war Sammy Gregson auf der Suche nach illegaler Ware – nach Stahlstiften, mit denen man halbautomatische Gewehre zu vollautomatischen umfrisieren konnte, sowie nach funktionstüchtigen Handgranaten oder Munition, die sogar kugelsichere Westen durchschlug und deshalb Cop Killer genannt wurde – in einen solchen Verkaufsstand hereingeplatzt. Er förderte Schachteln mit T-Shirts und Mützen zutage und warf eine zu Verkaufszwecken aufgestapelte Pyramide mit Bullet Bibles um. Sauer und enttäuscht sagte er Lamb und seiner Truppe die ewige Hölle voraus.
Lamb wollte meinem Vater auf dem Kinoparkplatz über den Vorfall berichten. Er erwartete uns im nassen Abendlicht, an einen alten Pickup gelehnt, Zigarette in der Hand. Mein Vater hatte eigentlich zuerst mit Sammy reden wollen, aber Lamb war schneller gewesen.
Ich schaute auf meine Boots und versuchte, mein Gesicht aus dem Wind zu halten. Auf dem Asphalt bildeten sich immer mehr Pfützen.
Aus Lambs Nasenlöchern driftete Zigarettenrauch. «Ihr Mann legt sich ganz gern mit uns an, müssen Sie wissen», fing er an.
«Gibt’s denn einen Grund dafür, warum er den Stand auf den Kopf gestellt hat?», fragte mein Vater.
Mein Vater schob mit dem Daumen seinen Stetson hoch und schaute sich um. Lambs Zigarette war bis zum Filter heruntergebrannt. Nach einem letzten Zug schnippte er den Stummel in eine Pfütze, wo er zischend verglomm. Mein Vater sagte: «Ich besprech das mal mit Sammy, mal sehen, wie seine Version der Geschichte zu deiner passt.»
«Jeder einzelne Händler auf unserem Gang legt seine Hand für uns ins Feuer», sagte Lamb. «Er war von Anfang an auf Krawall gebürstet.»
Wenn ich die Augen zusammenkniff, konnte ich Sammy drüben bei den Kinotüren stehen sehen. Er sollte dafür sorgen, dass in die Vorstellung mitgeführte Feuerwaffen ungeladen waren. Ihm brannte es unter den Nägeln, seine Version der Geschichte loszuwerden, das wusste ich, und es schmeckte ihm gar nicht, dass Lamb ihm zuvorgekommen war, auch das wusste ich. Mir war das egal. Mich interessierte mehr, ob Rosie gerade mit Isaac zusammen war. Vielleicht saßen sie in einer Versammlung von Young Life im Kreis, Bibel und Textmarker in der Hand, vereint in Jesus’ Liebe. Sie hatte mich gefragt, ob ich auch mitmachen wolle, aber jedes Mal, wenn ich mitging, fühlte ich mich fehl am Platz und zu schlicht angezogen. Die Teenager von Young Life waren Cheerleader und Football-Spieler, Leute, die Monate ihres Lebens im Behandlungsstuhl von Kieferorthopäden verbrachten. Als Rosie mit mir Schluss machte, sagte sie, sie wolle mit jemandem zusammen sein, der ihre Sicht aufs Leben und die Welt teilte. Isaacs Vater war Pastor. Die Familie hatte einen Swimmingpool und einen Jagdschein.
«Rodeo?», sagte Lamb. Er nannte mich schon seit Jahren so. Nachdem einer der Patienten von meiner Mutter zwei Pferde hinterlassen hatte, hatten mein Vater und ich die beiden Tiere auf Lambs Weide gebracht. Eigentlich wollten wir sie irgendwann zu meinen Großeltern nach San Saba weitertransportieren, aber Lambs Nachwuchs hatte sich mit ihnen angefreundet. Je nachdem, wen man fragte, hatte er angeblich bis zu zehn Kinder gezeugt. Ein Junge hieß Kanaan.
«Rodeo?», wiederholte er. «Dein Vater redet mit dir.»
Mein Vater fischte sein Portemonnaie aus der Hosentasche und fingerte einen Zehn-Dollar-Schein heraus.
«Schau doch mal, ob du was für Mason findest», sagte er.
«Wie geht’s ihm denn da so?», fragte Lamb. «Ich werde ihn in unsere Gebete einschließen.»
«Ein paar Gebete mehr schaden sicher nicht», sagte mein Vater.
Eine scharfe Windböe aus der Prärie peitschte über den Parkplatz. Nieselregen fegte über unsere Gesichter, und wir drehten uns alle gleichzeitig weg. Sobald es vorbei war, schaute ich meinen Vater an und sagte: «Willst du mit reinkommen?»
«Geh du schon mal. Ich red noch mit Sammy und komm dann nach.»
«Bald schüttet es», sagte ich.
«Träufelt, ihr Wolken, von oben und die Himmel regnen Gerechtigkeit», sagte Lamb. «Jesaja Vers 45, Zeile 8.»
«Wir kommen schon klar», sagte mein Vater.
«Ich bin ganz schnell», sagte ich.
«Mach dir um uns keine Sorgen, Rodeo», sagte Lamb. «Hier ist niemand aus Zucker, okay? Und schmelzen tut auch keiner.»
Jaye
Meine Mutter war nicht religiös. Sie war keine Suchende oder spirituell veranlagt und auch nicht unbedingt auf was Neues aus. Sie war eine Reinigungsfrau und mit einem Mann verheiratet, der sein Geld damit verdiente, dass er in aller Frühe Zeitungen austrug. Wenn sie spätnachts nach Hause kam, stand er gerade auf. Im Sommer 1992, ich stand kurz vor dem Eintritt in die Highschool, zahlte ihr Boss ihr einhundert Dollar dafür, dass sie ein Wohnobjekt für einen Nachmieter aus Texas an einem Wochenende auf Hochglanz brachte. Das Haus lag kurz vor Highland, Kalifornien, in den Ausläufern der San Bernardino Mountains. Eine Wand bestand aus einem riesigen Spiegel, der mit Gold marmoriert war. Die Dusche war aus Glasbausteinen. Das Haus hatte ein tiefergelegtes Wohnzimmer, zu viel Teppichboden und zu wenig Licht. In den Abflüssen lagen Nester aus verseiften Haarknäueln. Der Ventilator im Wohnzimmer baumelte an zwei Kabeln dreißig Zentimeter unterhalb von seinem Gehäuse. Meine Mutter bot mir zwanzig Dollar dafür, dass ich Kacheln schrubbte und Fenster putzte.
Der Mieter traf an einem Sonntag kurz vor dem Mittagessen ein, einen ganzen Tag früher als geplant. Perry Cullen war sehnig und näselte beim Reden. Er trug ein schweißgetränktes ärmelloses Shirt und eine Brille mit braungetönten Gläsern. Er hatte zwei fettbefleckte Tüten mit Burgern dabei, als wäre es völlig selbstverständlich, uns was zum Essen mitzubringen. Er fragte, ob wir was dagegen hätten, vor der Mahlzeit zu beten, was zwar eigenartig war, aber auch höflich, und dann setzten wir uns alle drei ins kühle Gras und aßen, plauderten und hörten uns Perrys Geschichten über seine Reisen an. Auf Vorbeifahrende wirkten wir wie eine Familie, die im Garten ihres neuen Hauses Picknick machte. Nach dem Essen half Perry uns beim Aufräumen, und wir luden allen Abfall auf die Ladefläche von seinem alten Truck. Dann spielte er ein paar Songs auf seiner Akustikgitarre. In der ersten Zeit war er ein Typ, der früher kam als geplant und beim Singen die richtigen Töne traf. Ein Typ, der Essen mitbrachte und sein Zeug aufräumte und Mitmenschen gegenüber aufmerksam war. Da hatte meine Mutter von Anfang an keine Chance.
Roy
Sogar an dem Abend für die Early Birds war die Waffenshow dermaßen überlaufen, dass ich mich an Sammy unbemerkt vorbeistehlen konnte. Kurz vor dem Eingang standen Shawn und Shane Buford in ihren Pfadfinderuniformen und verkauften gebrannte Pekannüsse. Männer räumten ihre Stände ein und beäugten die Konkurrenz. Sie trugen Tarnanzüge und Overalls, Stirnkappen und Stetsons. Sie hatten Bärte und Bäuche und auf den Armen unscharfe, verblasste Tätowierungen. Ein paar von den Frauen sahen aus, als wären sie gerade von der Jagd zurückgekehrt, während andere auf hohen Hacken und mit Haarsprayfrisuren daherkamen. Sie verkauften Ziegenmilch, Türkis-Schmuck und mit Kreuzstich bestickte Stoffläppchen, auf denen Sprüche standen wie: Wer nie vom Weg abkommt, der bleibt auf der Strecke.
Alle paar Minuten krachte irgendwo in der Halle ein Elektroschocker. Ein paar Männer spazierten mit Gewehren auf dem Rücken herum, und aus dem Lauf ragte eine Flagge mit der Aufschrift Zu verkaufen. Die Flaggen waren in den Gängen von weitem sichtbar und erinnerten mich an Bojen auf einem See. An der rückseitigen Wand befand sich Kriegszubehör – Helme, Bajonette und Abzeichen. An einem Stand wurden ausschließlich alte Bibeln angeboten, und in einer beleuchteten Auslage lag eine, die ein Soldat im Bürgerkrieg dabeigehabt hatte. Sie kostete eintausend Dollar.
Bei Lambs Stand herrschte immer noch Chaos. Bullet Bibles lagen verstreut herum, als hätte jemand sie von oben fallen lassen. Ein Mann und eine Frau bestückten eilig die Auslagen. Sie trugen Hemden und Kappen mit der Aufschrift God, Guts, Guns – Gott, Wagemut, Waffen.
«Entschuldigung für das Durcheinander», sagte der Mann. Er war um die dreißig, sprach mit einem hörbaren französischen Akzent und hatte dichtes dunkles Haar, das noch mehr auffiel als sein Akzent.
«Virgil», flüsterte die Frau. «Das ist der Sohn vom Sheriff.»
Virgil starrte mich an. Er hatte ein Grübchen am Kinn und blassblaue Augen.
«Wie viel kostet so eine Kappe?», fragte ich, weil ich nett sein wollte.
Virgil nahm eine vom Fußboden auf und schlug sie gegen seinen Schenkel, um den Staub abzuklopfen. Dann setzte er sie mir mit großzügiger Geste auf.
«Wie viel?»
«Geschenk des Hauses.»
«Ich hab Geld dabei», sagte ich. «Ich kann dafür zahlen.»
«Gute Idee, am Wochenende mit ein paar Notgroschen rumzulaufen.»
Ich bedankte mich bei ihm. Dann schüttelte ich ihm die Hand, weil mein Vater das wahrscheinlich ebenfalls getan hätte.
«Sammy ist Katholik», sagte ich.
«Dann sollte er’s eigentlich besser wissen.»
«Mein Vater redet ein Wörtchen mit ihm und bringt ihn wieder zur Vernunft.»
«Wenn’s deiner nicht macht, dann eben unserer», sagte Virgil und zwinkerte mir zu.
ÜBER DAS LAMM
Podcast-Folge 10
Gast: Virgil Bernthal
Aufgenommen: April 2024
The Chapel of Light
Waco, Texas
Für mich war das eine komplette Fehlentscheidung. Und ausgerechnet auf amerikanischem Grund und Boden. Männer, Frauen, Kinder. Wenn du mich fragst, war das eine Fehlentscheidung der Justiz. Ein Debakel. Das ist für mich das richtige Wort. Es war ein Justizirrtum oder Debakel oder …
Und wie alt sind Sie, Virgil?
Siebenundsechzig.
Und woher stammen Sie?
Lafayette. Ich dachte, hier ginge es um Lamb.
Ist auch so.
Wir waren seine Schüler. Jünger könnte man auch sagen.
Und wie lange waren Sie ein Jünger?
Neununddreißig Jahre, und ich zähle die Jahre weiter.
Sie glauben also trotz allem immer noch an Lambs Lehren?
Nein.
Sie haben gerade gesagt, «ich zähle die Jahre weiter».
Du hast mich gefragt, ob ich immer noch dran glaube, trotz allem, was passiert ist. Ich glaube nicht trotz allem dran. Ich glaube genau deswegen dran.
Natürlich. Tut mir leid.
Das sollte es dir auch.
Jaye
Als wir am nächsten Tag in das Haus in Highland zurückkehrten, stand die Haustür offen. Perry balancierte barfuß und ohne Hemd auf einem Holzstuhl inmitten des leeren Wohnzimmers. Der Stuhl wackelte gefährlich. Meine Mutter dachte wohl, er wolle sich erhängen, denn sie schleuderte mir ihre Handtasche entgegen und raste quer durch den Raum, während er ganz gelassen sagte: «Hallo, meine Freunde.»
Er hatte gerade den Deckenventilator neu befestigt. Seine Brust war eingesunken und bleich und von dunklen Löckchen überwachsen. Er trug einen Gürtel mit einer Schnalle in Form eines Fisches, aber seine Hose hing trotzdem so weit herunter, dass der ausgeleierte Bund seiner Boxershorts zu sehen war.
«Wir sind gekommen, um letzte Kleinigkeiten zu erledigen», sagte sie. Sie wirkte beschämt und verlegen, weil sie überreagiert hatte, oder vielleicht auch, weil er halbnackt war. Außerdem log sie, und zwar nicht zum ersten Mal an jenem Morgen. Als mein Vater von seiner morgendlichen Zeitungsrunde nach Hause kam, hatte sie verkündet, wir seien gerade im Aufbruch, um ihren Lohnscheck abzuholen und unterwegs Lebensmittel einzukaufen. Jetzt behauptete sie: «Wir wischen noch rasch Staub und saugen. Wir wollten dafür sorgen, dass Sie sich gut einleben.»
«Ich bin gerade prima dabei», sagte er. Während er vom Stuhl stieg, stützte er sich mit einer Hand an der Schulter meiner Mutter ab. In seinen hinteren Hosentaschen steckten Zangen und Schraubenzieher. Er hatte Mühe, wieder in sein abgetragenes Hemd zu kommen, ein Ärmel war nach innen gekehrt, und meine Mutter war ihm behilflich. Er sagte: «Ich reparier gerne mal was, aber ebenso gerne hab ich Leute um mich.»
Die meiste Zeit verbrachten sie an jenem Morgen mit Waschen. Perry hatte anscheinend eine ganze Schrankladung an schmutziger Wäsche dabei. Als ich helfen wollte, scheuchte er mich fort. Mädchen in meinem Alter, sagte er, sollten ihre Wochenenden damit verbringen, Rock ’n’ Roll zu hören und damit bei den Eltern die schlimmsten Befürchtungen für ihr weiteres Leben zu wecken. Dann schnippte er mit den Fingern – ich hab’s! – und lief hinaus zu seinem Truck. Er war immer noch barfuß. Er brachte einen Ghettoblaster und drei lederne Dokumentenkoffer mit Audiokassetten rein, die er wie einen Stapel Pizzakartons vor sich hertrug. Er stellte den Rekorder auf den wackeligen Stuhl und überlegte dann eine ganze Weile, was er einlegen sollte. Er schaute sich auf den Kassetten die Abspiellisten und Begleittexte an, aber es sagte ihm nichts zu. Als er sich am Ende für ZZ Top entschied, schob er die Kassette mit einem verschmitzten jungenhaften Vergnügen ein. Er drehte die Lautstärke hoch. Spielte unter vollem Einsatz auf einer Luftgitarre mit. Kniff die Augen zusammen, während die Finger im Geiste Läufe meisterten, legte grimassierend ein Solo hin und lehnte sich so weit nach hinten, bis sich die Schultern von ihm und meiner Mutter trafen. Sie legte kichernd die Hände übers Gesicht. Seine getönte Brille flog auf den Boden, als er den Kopf zum Rhythmus der Musik schwenkte.
Als er darauf bestand, uns zum Lunch einzuladen, rechneten wir mit weiteren Burgern. Aber diesmal kam Perry mit drei in Wachspapier eingeschlagenen Rippensteaks zurück. Er übergoss das Fleisch mit Dr Pepper und grillte es im Garten über Holzkohle. Dieses Mal fragte er vorher nicht nach, ob es in Ordnung sei zu beten. Er schlug vor, jeden Bissen vorher in gelben Senf zu tauchen, was wir taten, und es schmeckte einfach köstlich. Er habe mit ein paar kalifornischen Hippies ein Unternehmen für Landschaftsbau gegründet, erzählte er, denn in Texas hätten die Leute für Rasen wenig übrig. Er brüstete sich mit den Freunden überall auf der Welt – Geistlichen, Kriminellen, Mathematikern, Maurern und Mystikern. Er habe Fehler im Leben gemacht – «nichts völlig Illegales, aber nah dran» –, aber er glaube an Erlösung und habe das Glück gehabt, anderen zu begegnen, die ebenfalls daran glaubten. Sein Vater sei brutal gewesen und seine Mutter verstorben. In Texas habe er ein Stück Land geerbt und dort seit Jahren mit Gleichgesinnten eine Gemeinschaft für Leute in Not aufgebaut. Auch dort war er angeblich gewerblich aktiv – mit einer kleinen Maschinenwerkstatt, einem Schießstand, dem Verkauf von einschlägigen Waren an Wochenend-Haudegen. «Diese Bürohengste, die alle Rambo-Filme in- und auswendig kennen, wisst ihr», sagte er. Er arbeitete gerne mit den Händen, mochte schlichte ländliche Kirchen und Dr Pepper, der in seiner Heimatstadt Waco, Texas, erfunden worden war. Er hatte noch niemals Sushi probiert, war noch nie betrunken gewesen und hatte noch nie Golf gespielt.
Nach dem Essen spülte er die Teller ab, dann holte er seine Akustikgitarre hervor und spielte uns einen lustigen Song über einen Schneemann in Texas vor. Im nächsten ging es um einen Engel, der versuchte seinen eingedellten Heiligenschein zu versetzen. Als niemand ihn haben wollte, riss der Engel ihn herunter und hängte ihn sich als Halskette um. Meine Mutter und ich klatschten Beifall. Perry wurde ganz verlegen und meinte, er habe mittlerweile einen Riesenhunger auf Eiscreme. Darauf machte er sich so schnell zu seinem Truck auf, dass er seine Schlüssel vergaß und nochmal zurückkommen musste. Er hatte auch vergessen zu fragen, welche Geschmacksrichtungen wir wollten, und als er dann zurückkam, hatte er zehn verschiedene eingekauft und balancierte in jeder Hand fünf Liter Eiscreme. Er schaffte es noch fast bis in die Küche, bevor ihm alles entgegenkam.
Ein Clown, dachte ich bei mir. Ein Clown auf der Suche nach einem Zirkus.
ÜBER DAS LAMM
Podcast-Folge 2
Gast: Constance Cullen
Aufgenommen: August 2023
Telefoninterview
Ich habe ihn sehr jung bekommen. Sein Vater hat uns ganz gern mal verprügelt. Ohne mich wäre das alles nicht passiert.
Weil Sie seine Mutter sind.
Weil ich nicht fürs Muttersein gemacht war. Ich vertraue Männern einfach zu sehr. War immer schon so. Sein Vater hat Perry gezwungen, die Bibel auswendig zu lernen. Er durfte erst essen, wenn er ganze Seiten daraus auswendig vortragen konnte. Wenn der Junge auch nur ein Wort vergessen hat, nur ein einziges Wort, gab es nichts. Ich glaube, er ist deshalb auch nicht so groß geworden, wie er eigentlich sollte. Am nächsten Abend musste er es nochmal versuchen, und dann waren es noch einige Seiten mehr. Wenn er’s nicht schaffte, hat er Schläge mit dem Gürtel bekommen. Clarence meinte, so lernt er Disziplin. Er meinte, er erzieht ihn so zu einem guten Christen. Wenn er mich dabei erwischt hat, wie ich Perry Essen zusteckte, hat er mich geprügelt. Ein paar Mal hat Clarence einen von seinen Freunden zu uns nach Hause mitgebracht und hat zugeschaut, wie der sich an mich ranmachte. Falls er dafür gesorgt hat, dass Perry dabei auch zugeschaut hat, hab ich’s verdrängt.
Sie wollen sagen, er hat …
Perry hatte einfach von Anfang an keine Chance. Nach Clarence haben sich die Männer dann bei uns zu Hause die Klinke in die Hand gegeben. War ich gerade arbeitslos, waren das Kunden für mich. Hatte ich einen Job, hab ich auf Heirat gehofft.
Und Sie glauben, Lamb …
Für mich ist und bleibt er Perry. Mein kleiner Junge. In der Schule haben sie ihn gepiesackt und ihm ganz schreckliche Schimpfnamen gegeben. Warum sollte er sich da nicht Gott zuwenden? Als er dann von zu Hause weggelaufen ist – da war er im dritten Jahr der Highschool, stellen Sie sich das mal vor! –, habe ich gehofft, dass er beim Militär oder bei der Kirche unterkommt. Gott möge mir vergeben, aber ich hab gedacht, vielleicht wär in seinem Fall auch ein frühes Ende gar nicht so schlecht. Vielleicht bei einem Autounfall, aber ganz schnell und schmerzlos. Damit er von allem erlöst ist. Mein Gott, hören Sie sich nur an, was ich da rede.
Hatten Sie noch Kontakt zu ihm, nachdem er weggelaufen war?
Nicht viel. Als er achtzehn war, ist er kreuz und quer durch die Welt gereist und hat seine Lehren verbreitet. Damit hatte ich nichts zu tun. Offenbar hat er rumerzählt, dass ich gestorben war. Das hat er sich wohl gewünscht, da bin ich sicher.
Jaye
Meine Mutter fing eine Diät an, ließ sich die Haare wachsen und besuchte das Haus bei Highland, sobald der Job als Reinigungskraft ihr Zeit ließ. Wenn sie im Flur oder in der Küche an mir vorbeiging, hing eine Wolke von einem neuen süßlichen Parfum in der Luft. Sie tat mir auf die gleiche Art leid wie ich mir selbst in der Schule, aber manchmal empfand ich auch Schadenfreude, wenn ich mitbekam, dass sie ihren Wunsch, attraktiv zu wirken, nur mühsam verbergen konnte. In jenen ersten Monaten, in denen er um sie warb, wirkte sie verjüngt, und ich rechnete damit, dass sie mich um Rat fragen würde, was sie anziehen oder sagen oder tun sollte. Als hätte ausgerechnet ich da was beizusteuern. Als hätte ich nicht das gleiche aussichtslose Aufwallen in den Venen gespürt. Als hätte ich nicht jederzeit mit jedem beliebigen Jungen was auch immer getan, hätte mich doch nur mal einer gefragt. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.
Manchmal nahm sie mich mit. Bei jedem Besuch wurde es in dem Highland-Haus enger. Das tiefergelegte Wohnzimmer füllte sich nach und nach mit Instrumenten aus dem Leihhaus – elektrischen Gitarren, Verstärkern, einem zusammengestoppelten Schlagzeug-Set, das immer mehr Raum einnahm –, an denen Männer mit wirren Mähnen sich an Melodien herantasteten. Manche hatten ihren festen Wohnsitz in dem Haus, andere waren auf der Durchreise. Sie kamen aus Kalifornien und Texas, aus England und Brasilien. Ich merkte, dass die meisten einander gar nicht kannten, sie waren aufgekratzt, nervös und respektvoll, als wäre das Haus eine Bushaltestelle und sie Reisende, die dort Unterschlupf suchten. Während die Männer sich Songs ausdachten, waren die Frauen mit Backen und Putzen beschäftigt, saßen auf quastengesäumten Kissen im Wohnzimmer und bürsteten einander das Haar.
Perry begrüßte uns jedes Mal überschwänglich. Klatschte johlend in die Hände. Tanzte. Die Leute sahen zu, wie er uns begrüßte, verfolgten mit, wie er uns Teller mit Essen anbot oder ein Ohr, selbst wenn die Musik nicht laut war, ganz nah an den Mund meiner Mutter brachte, wenn sie was sagte. Als er einmal hinten im Garten neben ihr saß, nahm er seine Brille ab und rieb sich mit dem Handgelenk Tränen aus den Augen. Vielleicht hatte sie ihm gerade irgendeine mutwillige Eifersucht oder Schuld gestanden oder ihm von meinem Vater erzählt. Er war ein orientierungsloser Dummkopf mit Manieren und über jeden irritiert, der sich mehr anstrengte als unbedingt nötig. Bei unseren ersten Besuchen in dem Highland-Haus nahm ich an, dass ich für sie mit von der Partie sein sollte, um bei ihm jeden Verdacht zu zerstreuen. Nicht gerade die feine Art, aber im Ganzen doch harmlos. Doch dann begriff ich irgendwann, dass ich sie mit meiner Anwesenheit vor sich selbst schützen sollte. Ihr dabei helfen sollte, sich, wenn schon nicht auf dem rechten Weg, aber doch wenigstens unter Kontrolle zu halten. Ohne mich würde sie vielleicht meinen Vater verlassen oder, in ihrer Vorstellung vielleicht noch schlimmer, Perry ein Liebesgeständnis machen und erfahren, dass sie bezüglich ihrer Beziehung zueinander einem Trugschluss aufgesessen war. Am Ende von unseren Besuchen verabreichte er ihr jeweils eine kräftige Schultermassage – wie ein Boxtrainer, bevor er seinen Zögling zurück in den Ring schickt. Er wechselte das Öl von ihrem Auto und ersetzte die Bremsbeläge. Zu ihrem Geburtstag schenkte er ihr einen gebrauchten Kassettenrekorder und gab damit an, dass er den Preis auf dem Second-Hand-Markt kräftig runtergehandelt hatte.
Er konnte keine Minute lang stillsitzen. War ständig in mehreren Räumen unterwegs und mit mehreren Unterhaltungen gleichzeitig beschäftigt. Immerfort klopfte jemand an die Haustür – ein neuer Bekannter von einem Schrottplatz, die Schwester von jemandem, die man vor die Tür gesetzt hatte, weil sie mit ihrer Miete einen Tag im Verzug war, ein Geiger, ein Schlagzeuger, ein Investor, der Interesse an Perrys Geschäftsvorhaben zeigte. Einmal stand ein Lieferant mit einem Rollwagen vor der Tür, auf dem sich Kisten mit Bibeln befanden. Perry bestätigte die Lieferung mit seiner Unterschrift, worauf die Leute im Haus sich auf die Kisten stürzten wie hungernde Flüchtlinge. Eine Frau ging in dem Gerangel zu Boden und weinte. Perry half ihr auf und legte seine Stirn gegen ihre. Auf der Stelle versiegten ihre Tränen, und sie grinste anzüglich, als hätte er ihr einen dreckigen Witz in den Kopf gepflanzt. Die Bibeln hatten das Orange von Warnkegeln.
«Ich habe sie extra so bestellt! Bei der Farbe sollt ihr aufhorchen», sagte Perry. «Die Farbe sagt, jetzt wird’s ernst.»
Ich nahm an, dass er sie verkaufen wollte, um das Geld in Sitars, Trommeln oder vielleicht eine Harfe zu investieren. Perry betete zwar vor den Mahlzeiten, aber von den Hausbewohnern erschien mir niemand besonders gläubig, er selbst am allerwenigsten, und bei den Bibeln hätte es sich genauso gut um Avon-Kosmetik handeln können.
Und dann blieb er auf einmal wochenlang verschwunden. Er fuhr zurück nach Texas und kam zumindest einmal mit einem langen Trailer zurück, der mit kleinen Motoren vollgepackt war. Oder er reiste nach Mexiko. Hawaii. Israel.
Wenn er unterwegs war, verdüsterte sich die Stimmung meiner Mutter. Sie schwebte nicht länger in einer Parfumwolke. Sie aß wieder Pommes und trank Weinschorlen wie früher. Perry schickte ihr nie was – er kannte ja nicht einmal unsere Adresse –, aber ich merkte, dass der Blick in den Briefkasten für sie der Höhepunkt des Tages war. Vielleicht hatte er ihr ja eine Postkarte versprochen. Vielleicht hatte er unsere Adresse in das Notizbuch geschrieben, in das er auch seine Jesus-Gedichte krakelte. Wahrscheinlich war es nur die verhängnisvolle Hoffnung einer einsamen Frau. Als ich eines Abends einen Blick in die Handtasche meiner Mutter warf – aus reiner Langeweile ließ ich hin und wieder ein paar Dollarscheine mitgehen –, sah ich darin eine von den orangefarbenen Bibeln. Ein anderes Mal war Perry schon seit fast einem Monat in Israel, und ich hörte, als ich an der geschlossenen Tür vom Elternschlafzimmer vorbeiging, so etwas wie ein Weinen. Ich legte mein Ohr an die Tür und begriff meinen Fehler. Sie war nicht traurig. Sie sang für ihn, nahm alles mit dem Rekorder auf und spulte die Kassette dann zurück, um ihre Tonlage zu korrigieren, noch ein paar Extra-Sequenzen einzubauen und alles zu dafür zu tun, damit ihre Stimme für ihn schön klang.
Roy
An einem Stand für antike Waffen entdeckte ich Duellpistolen. Der Kasten, in dem sie lagen, war aus Kirschholz, hatte einen Glasdeckel und war innen mit einem weinfarbenen, plüschigen Stoff ausgekleidet, und auf einem Schild stand, dass die Pistolen aus dem Jahr 1860 stammten. Die Pistolen waren mir nicht wichtig, aber das Schloss an dem Kasten war ein Bramah-Sicherheitsschloss aus Bronze. Ich hatte es bislang nur an Büchern in der Bibliothek gesehen, erkannte es aber auf den ersten Blick wieder. Masons Werkzeuge waren dafür zu groß. Hier waren ganz besonders feine Nadeln nötig, und selbst dann würde ich damit möglicherweise nicht eindringen können, ohne die Stifte zu berühren. Der Händler fragte, ob ich Hilfe benötigte, und hielt sich misstrauisch in der Nähe, als ich verneinte.
Mit einem Mal sagte eine Stimme: «Netter Hut.»
Neben mir stand, so dicht, dass ihr Arm mich berührte, ein Mädchen mit einer Gasmaske. Ihr kastanienrotes Haar war zu einem dicken Zopf gebändigt, der nach vorne schwang, als sie sich vorbeugte, um die Pistolen in Augenschein zu nehmen. Als sie sich mir erneut zuwandte, erschien mein Spiegelbild im Sichtfenster der Gasmaske. Ich sah klein und ängstlich aus, mit einer billigen Kappe, die mir zu klein war.
«Ich habe gerade gesagt, ich mag deinen Hut», sagte sie. Die Maske sorgte dafür, dass ihre Stimme dünn und leicht verzerrt klang. «Es wäre höflich, mir jetzt ebenfalls ein Kompliment zu machen.»
«Ich mag deine Maske», sagte ich.
«Da ist kein Filter drin. Wenn jemand hier eine biochemische Waffe einsetzt, fallen wir beide gleichzeitig um.»
«Diese Gefahr besteht vermutlich nicht.»
«Du bist also Optimist. Wenn du dir da so sicher bist, warum guckst du dir dann Pistolen an?»
«Tu ich nicht. Ich breche Schlösser auf. Ich wollte schauen, ob man diesen Kasten aufbekommt. Der Erfinder dieses Schlosses hier hat es so sicher gemacht, dass siebzig Jahre lang keiner rausfand, wie man’s aufbricht. Ich hab darüber mal ein Buch gelesen, zu dem ich eine Rezension geschrieben hab.»
«Wir könnten uns die Kiste auch einfach schnappen und wegrennen und sie später mit Gewalt aufbrechen.»
«Das ginge auch», sagte ich. «Die Pistolen interessieren mich nur nicht …»
«Gehst du auf die Highschool?», unterbrach sie mich. «Hast du eine Freundin?»
«Du fragst ganz schön viel.»
«Ich versuche noch möglichst viel zu erledigen, falls doch noch ein Angriff kommt.»
«Weißt du da mehr als ich?»
«Ich weiß vieles, was du nicht weißt.»