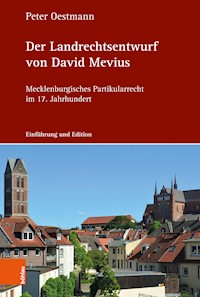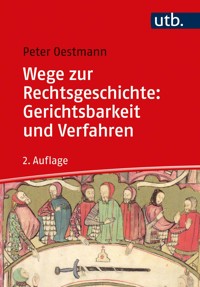
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Wege zur Rechtsgeschichte
- Sprache: Deutsch
In der Prozessrechtsgeschichte gab es zwei große Epochen: die ohne staatliches Gewaltmonopol und diejenige mit staatlichem Gewaltmonopol seit 1495. Das Studienbuch zeigt, wo und in welchem Umfeld diese entstanden sind und welche anderen Möglichkeiten es bis heute gibt, Gericht und Prozess zu organisieren, von der Völkerwanderungszeit bis zur Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau Verlag · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Wege zur Rechtsgeschichte
Ulrike Babusiaux
Hans-Peter Haferkamp
Sibylle Hofer
Peter Oestmann
Johannes Platschek
Tilman Repgen
Adrian Schmidt-Recla
Andreas Thier
Jan Thiessen
Peter Oestmann
Wege zurRechtsgeschichte:Gerichtsbarkeitund Verfahren
2., aktualisierte Auflage
BÖHLAU VERLAG KÖLN WIEN
Peter Oestmann ist Professor für Bürgerliches Recht und
Deutsche Rechtsgeschichte an der Universität Münster.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de.
Umschlagabbildung:
Gerichtsszene aus dem Herforder Rechtsbuch um 1370/75.
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Kommunalarchivs Herford.
© 2021, 2015 Böhlau, Lindenstraße 14, D-50674 Köln, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA;
Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Satz: büro mn, BielefeldEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
UTB-Band-Nr. 4295 | ISBN 978-3-8252-5709-5 | eISBN 978-3-8463-5709-5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
1.2 Leitfragen
1.2.1 Staatsgewalt
1.2.2 Gerichtsverfassung
1.2.3 Prozessrecht
1.2.4 Auswirkungen der Leitfragen
1.3 Forschungsstand
1.3.1 Lehrbücher
1.3.2 Forschungsliteratur
1.4 Gang der Darstellung
1.5 Ein Wort zur Benutzung des Lehrbuchs
2 Die Zeit vor dem staatlichen Gewaltmonopol
2.1 Hinführung zum Thema
2.1.1 Rückprojektion
2.1.2 Rechtsethnologie
2.1.3 Rechtsarchäologie
2.1.4 Der Rechtsbegriff als Problem der Rechtsgeschichte
2.2 Selbsthilfe und Streitschlichtung bei den germanischen Stämmen
2.3 Gerichtsbarkeit bei germanischen Stämmen?
2.4 Fehde und Sühneleistungen seit der Völkerwanderungszeit
2.4.1 Ein Blick auf Blutrache und Sühne im 6. Jahrhundert
2.4.2 Zum Verhältnis von Blutrache, Ehre und Sühne
2.4.3 Die Bußenkataloge der Stammesrechte
2.4.4 Gerichtsverfassung und Verfahrensrecht in der fränkischen Zeit
2.5 Die Zeit der Gottes- und Landfrieden
2.5.1 Friesisches Recht
2.5.2 Gottesfrieden
2.5.3 Landfrieden
2.5.4 Verrechtlichung der Fehde
2.5.5 Schritte auf dem Weg zum Fehdeverbot
2.6 Gericht und Verfahrensrecht im Sachsenspiegel
2.6.1 Gerichtsverfassung
2.6.2 Prozessrecht
2.6.3 Das Anefangverfahren
2.7 Königsgerichtsbarkeit und Reichshofgericht
2.7.1 Organisation und Verfahren des Reichshofgerichts
2.7.2 Exemtionen, Gerichtsstands- und Evokationsprivilegien
2.8 Rechtskreise und Oberhofzüge im Spätmittelalter
2.8.1 Einstufiges Gerichtsverfahren
2.8.2 Maßgebliche Rechtsgewohnheiten
2.8.3 Ende der Oberhöfe
2.8.4 Formstrenge im spätmittelalterlichen Recht
2.8.5 Zum Aufbau mittelalterlicher Gerichtsprotokolle
2.8.6 Der Lübecker Rat als Oberhof
2.8.7 Die Femegerichtsbarkeit
2.8.8 Spätmittelalterliche Gerichtspraxis in Frankfurt am Main (nach 1411)
2.9 Gelehrtes Prozessrecht im kirchlichen und weltlichen Recht
2.9.1 Beweisführung im gelehrten Prozess
2.9.2 Advokaten und Prokuratoren
2.9.3 Der Richter im kanonischen Prozess
2.9.4 Entstehung von Instanzenzügen
2.9.5 Zivilprozess und Inquisitionsprozess
2.9.6 Entstehung der Folter
2.9.7 Gelehrte Richter im weltlichen Recht
2.9.8 Gelehrtes Recht in der weltlichen Gerichtspraxis des deutschen Spätmittelalters
2.10 Das Königliche Kammergericht
2.10.1 Verpachtung des Kammergerichts
2.10.2 Reichsgerichtsbarkeit und Reichsreform
2.10.3 Eine Verhandlung vor dem Königlichen Kammergericht
3 Die Zeit des staatlichen Gewaltmonopols
3.1 Der Ewige Landfrieden
3.1.1 Verbot der Fehde
3.1.2 Reform der Reichsgerichtsbarkeit
3.2 Die Reichsgerichtsbarkeit im Alten Reich
3.2.1 Reichskammergericht
3.2.2 Reichshofrat
3.2.3 Der Kameralprozess
3.2.4 Die Entscheidungsliteratur
3.3 Die Gerichtsbarkeit in den Territorien
3.3.1 Die Appellationsprivilegien
3.3.2 Das Wismarer Tribunal
3.3.3 Das Oberappellationsgericht Celle
3.3.4 Preußen und der Müller-Arnold-Prozess
3.3.5 Aktenversendung
3.4 Die geistliche Gerichtsbarkeit in der frühen Neuzeit
3.4.1 Geistliche Gerichtsbarkeit und Reichsverfassung
3.4.2 Katholische Territorien
3.4.3 Protestantische Territorien
3.5 Besondere Formen der Gerichtsbarkeit
3.5.1 Patrimonialgerichtsbarkeit
3.5.2 Bäuerliche Niedergerichte
3.6 Der frühneuzeitliche Strafprozess
3.6.1 Die Constitutio Criminalis Carolina
3.6.2 Inquisitionsprozess
3.6.3 Akkusationsprozess
3.6.4 Crimen exceptum-Lehre und Hexenprozesse
3.6.5 Endlicher Rechtstag
3.7 Gerichtsverfassung und Prozessrecht des 19. Jahrhunderts als rechtshistorisches Problem
3.8 Die französischen Reformen der Gerichtsverfassung und des Prozessrechts
3.8.1 Die Reformbewegung in der Revolutionszeit und unter Napoleon
3.8.2 Ausstrahlungen der französischen Reformen auf Deutschland
3.9 Das Oberappellationsgericht der vier freien Städte Deutschlands
3.9.1 Begründungstechnik und Argumentation
3.9.2 Das Ende des Oberappellationsgerichts
3.10 Der lange Weg zu den Reichsjustizgesetzen
3.10.1 Gerichtsverfassung und Prozessmaximen in der Paulskirchenverfassung
3.10.2 Die hannoverschen Zivilprozessordnungen von 1847 und 1850
3.10.3 Die Zivilprozessordnung von 1877/79
3.10.4 Die Strafprozessordnung von 1877/79
3.10.5 Das Gerichtsverfassungsgesetz von 1877/79
3.11 Gerichtsbarkeit und Prozessrecht in der Weimarer Republik
3.12 Justiz im Nationalsozialismus
3.12.1 Der Primat der Politik
3.12.2 Lenkung der ordentlichen Gerichtsbarkeit
3.12.3 Normenstaat und Maßnahmenstaat
3.12.4 Volksgerichtshof, Sondergerichte
3.12.5 Kriegsverbrecherprozesse
3.13 Gerichtsbarkeit und Prozessrecht in der Deutschen Demokratischen Republik
3.13.1 Die Waldheimer Prozesse
3.13.2 Gerichtsverfassung in der DDR
3.13.3 Primat der Politik in der Gerichtspraxis der DDR
3.14 Gerichtsbarkeit und Prozessrecht unter dem Grundgesetz
3.14.1 Das Bundesverfassungsgericht
3.14.2 Ausdifferenzierung der Gerichtsverfassung
3.14.3 Reformen des Zivilprozessrechts
3.14.4 Reformen des Strafprozessrechts
4 Die Zeit nach dem staatlichen Gewaltmonopol?
5 Ergebnisse
Literatur
1. Einleitung
2. Die Zeit vor dem staatlichen Gewaltmonopol
3. Die Zeit des staatliche Gewaltmonopols
4. Die Zeit nach dem staatlichen Gewaltmonopol?
Register
Personenregister
Ortsregister
Sachregister/Glossar
Vorwort zur 2. Auflage
Nach einigen Jahren erlebt der rechtshistorische Grundriss „Gerichtsbarkeit und Verfahren“ eine zweite Auflage. Die Rückmeldungen zur ersten Auflage von 2015 waren überwiegend sehr wohlwollend, und über den Kreis von Rechtshistorikern hinaus erreichte das Buch zunehmend auch interessierte Studierende. Das freut mich, denn Vorlesungen zur Prozessrechtsgeschichte bilden im rechtswissenschaftlichen Studium weiterhin die große Ausnahme.
Neuauflagen laufen Gefahr, den Text von Lehrbüchern überall dort zu ergänzen, wo der jeweilige Verfasser eigenes Wissen hinzugewonnen hat. Das ursprünglich bewusst knapp gehaltene Werk droht damit auszufransen, wird ständig umfangreicher und erreicht seinen ursprünglichen Zweck, die Unterrichtung studentischer Leser über die wesentlichen Grundlinien, immer schlechter. Wenn das Studienbuch von Heinrich Mitteis von der ersten Auflage 1949 von 159 Seiten auf 570 Seiten in der letzten Bearbeitung von 1992 anschwoll, zeigt dies genau das Problem. Ich habe mich bemüht, Ausweitungen zu begrenzen, kam um bestimmte Ergänzungen aber dennoch nicht umhin.
Hilfreich waren einige kritische Hinweise zu Ungenauigkeiten und Fehlern in der Vorauflage. Für ihre aufmerksame Lektüre danke ich Folker Siegert, Clara Günzl und vor allem meiner Kollegin Marju Luts-Sootak, die zeitgleich in Tartu eine estnische Übersetzung organisierte. Die Manuskriptarbeit erfolgte im Corona-Jahr 2020/21, das mit seinen bisher für unvorstellbar gehaltenen Freiheitseinschränkungen sicherlich in die Rechtsgeschichte eingehen wird. Für die bewährte Zusammenarbeit mit dem Verlag konnte ich mich wiederum auf den unkomplizierten Austausch mit Dorothee Rheker-Wunsch verlassen. Meine Familie ermöglichte mir im Lockdown-Winter die erforderlichen Nebenstunden am heimischen Schreibtisch.
Münster, März 2021
Peter Oestmann
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Das Buch beschreitet „Wege zur Rechtsgeschichte“. Ein zentraler Ausschnitt aus der deutschen und europäischen Vergangenheit wird hier als eigenes Kurzlehrbuch angeboten. Damit ist zugleich Raum eröffnet, um die Grundzüge der Gerichts- und Prozessgeschichte für studentische Leser eingehend zu erklären. Oftmals überschütten rechtshistorische Lehrbücher die Studenten mit Fakten, Fakten und abermals Fakten. Je knapper bemessen der Platz, desto weniger Möglichkeiten verbleiben, die großen Linien zu zeichnen oder Einzelheiten zu entfalten. Wie Hagelschauer prasseln auf den Leser Namen, Jahreszahlen, Orte und Fachbegriffe nieder. Warum man dies alles wissen muss, was wirklich wichtig ist und was nur schmückendes Beiwerk darstellt, bleibt ungesagt. Bildung soll gern Selbstzweck sein, fürwahr, aber der Lehrer braucht nicht alle Kleinigkeiten zu vermitteln, nur weil er sie selbst gerade kennt. Wer sich klarmacht, welche Geschichte er erzählen will, kann sich auf wesentliche Punkte beschränken.
Der 27-jährige Privatdozent Otto Mejer schrieb 1845 im Vorwort seines Kirchenrechtskompendiums, im Kurzlehrbuch gehe es bloß darum, eine Übersicht über das Feststehende zu bieten. Auf dem Katheder dürfe der Hochschullehrer dagegen „die Wissenschaft geben, wie er sie zu besitzen meint, so subjectiv er will und kann“1. Gemessen am Ideal des Göttinger Kirchen- und Staatsrechtlers liegt mein Grundriss näher an der aufgeheizten Vorlesung als am abgeklärten Lehrbuch. Der Text bekennt Farbe und ist um deutliche Wertungen nicht verlegen. Wenn Widerspruch den Leser zum Nachdenken bringt und ihm die Quellen- und Literaturhinweise den Weg zur eigenen Meinung öffnen, ist viel erreicht. Das Buch will keineswegs das Selbststudium abwürgen, sondern auf Schritt und Tritt dazu einladen, immer tiefer in die aufregende Welt der Rechtsgeschichte einzutauchen. Über die Quellenauswahl, die Gliederung und Wertungsmaßstäbe lässt sich trefflich streiten. Vor allem fehlt Vieles. Wichtige Gerichte, ganze Prozessarten, Berufsbilder, sozialgeschichtliche Bezüge, Diskussionen in der Rechtswissenschaft der Zeit – an allen Ecken und Enden bleiben Fragen und Lücken. In einigen Jahren kann hoffentlich ein Handbuch zur Geschichte der Rechtsdurchsetzung den Stoff viel feinmaschiger aufnehmen. Für den Augenblick handelt es sich um eine Handreichung an interessierte Leser. Sie soll dem modernen aufmerksamen Juristen anhand einiger Einblicke die Bedeutung der rechtshistorischen Tradition für Gegenwart vor Augen führen. Ob sich die Sehschlitze nach und nach zu einem größeren Sichtfeld weiten und mit der Zeit ein Gesamtbild entsteht, bleibt jedem selbst überlassen. Mir jedenfalls hat der Zwang, den roten Faden festzuzurren und sich nie ins Auswabernde zu verlieren, jederzeit Freude und Schwung bereitet. Hoffentlich merkt man das dem Buch an.
Münster, April 2015
Peter Oestmann
1Otto Mejer, Institutionen des gemeinen deutschen Kirchenrechtes, Göttingen 1845, S. VI.
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
Die Gerichtsbarkeit zählt zu den tragenden Pfeilern des modernen Staates. Neben der Gesetzgebung und der Regierung bildet die Rechtsprechung die dritte Säule der Staatsgewalt. Mögen die Menschen sich in rechtlichen Angelegenheiten streiten, mag es Verbrechen und Kriminalität geben – heute ist es der Staat, der solche Fragen verbindlich löst. Wer seine vermeintlichen rechtlichen Interessen eigenmächtig durchsetzen möchte und auf eigene Faust zur Selbsthilfe schreitet, verlässt damit den Boden des Rechts. An etwas versteckter Stelle, mit doppelter Verneinung und in juristischer Kunstsprache, spricht § 229 BGB die heutige Selbstverständlichkeit aus:
Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder wer zum Zwecke der Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand des Verpflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert werde.
Faustrecht ist damit grundsätzlich verboten. Nur dann, wenn staatliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und die Gefahr besteht, dass eigene Rechtspositionen unwiederbringlich verloren gehen, ist Selbsthilfe in engen Grenzen noch erlaubt. Auch die Rechtfertigungsgründe im Strafrecht errichten strenge Schranken und dämmen auf diese Weise private Gewalt ein. Aussicht auf Erfolg kann der Gesetzgeber aber nur haben, wenn eine Gerichtsbarkeit bereitsteht, die dem Einzelnen tatsächlich sein Recht verschafft. Nur wenn in überschaubarer Zeit und mit vertretbarem Kostenaufwand richterliche, also staatliche Entscheidungen die streitigen Ansprüche klären und ggf. auch vollstrecken, strafbare Handlungen bestrafen und auf diese Weise die Rechtsordnung verteidigen, gibt es keinen Grund mehr zur Selbsthilfe. Sie ist dann überflüssig.
Im Blick zurück sind das alles keine Selbstverständlichkeiten. Die Rechtsgeschichte bietet Beispiele dafür, wie verschiedene Zeiten unterschiedliche Antworten auf sehr ähnliche Fragen gegeben haben. Das staatliche Gewaltmonopol, die feinmaschige Gerichtsverfassung und das umfassend kodifizierte Verfahrensrecht mit seinen wesentlichen Prozessmaximen gehören zu den wichtigsten Ausprägungen des heutigen Rechtsstaates. Vergegenwärtigt man sich die entscheidenden Bausteine der modernen Gerichtsbarkeit, ergeben sich unschwer einige Leitfragen. Sie ermöglichen es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den ausgewählten historischen Beispielen und dem Recht unserer Zeit deutlicher zu erkennen. Die Leitfragen dienen zugleich dazu, die Stofffülle zu begrenzen und die Darstellung von überflüssigem Ballast freizuhalten. Es geht beim Studium der Rechtsgeschichte nicht darum, möglichst viele Einzelheiten zu wissen. Entscheidend sind die Einblicke in die jeweiligen Eigenarten verschiedener Epochen und die Fähigkeit, über die langen Zeiträume hinweg Regelungsprobleme und Lösungsmöglichkeiten miteinander zu vergleichen.
1.2 Leitfragen
Die Aufgabe des Historikers und damit auch des Rechtshistorikers besteht vor allem darin, den überkommenen Stoff zu sichten und zu ordnen. Die Leitfragen schlagen einige Breschen in die Quellenmassen. Sie tragen auf diese Weise dazu bei, das Kurzlehrbuch schlank zu halten. Im Wesentlichen geht es um drei große Fragen: 1. Welche Rolle spielte die Staatsgewalt für die Rechtsdurchsetzung in verschiedenen Zeiten? 2. Wie sah die jeweilige Gerichtsverfassung aus, welche Gerichte gab es, und welche Personen waren dort tätig? 3. Was waren die Prozessmaximen des jeweiligen Verfahrensrechts, und welche Möglichkeiten bestanden, gerichtliche Entscheidungen anzugreifen?
1.2.1 Staatsgewalt
An erster Stelle steht die Frage nach der Staatsgewalt. In welcher Weise sind und waren die Gerichtsverfassung und das Verfahrensrecht an den Staat oder einen Herrscher gebunden? Im modernen Recht fällt die Antwort leicht. Gerade in der älteren Zeit, der sog. Vormoderne, ist aber Vorsicht geboten. Rechtshistoriker und Juristen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu Eduard Kern und Heinrich Mitteis haben nach Vorformen von Rechtsstaatlichkeit, ja sogar von Demokratie bei den Germanen und im frühen Mittelalter gesucht. Das kann heute nicht mehr überzeugen, weil es damals noch gar keinen Staat gab. Die Leitfrage im Blick ermöglicht es vielmehr, auch Zeiten ohne Staatsgewalt zu erkennen und einzuordnen. Bis weit ins Mittelalter hinein kann von einem Staat im modernen Sinne keine Rede sein. Inwieweit Gerichte und ihr Verfahren an einen Herrscher angebunden waren, erweist sich als schwieriges Problem, das nach unterschiedlichen Antworten verlangt. Überhaupt geraten erst dann, wenn man die Abwesenheit von Staatsgewalt ernst nimmt, andere zeittypische Formen rechtlicher Konfliktbewältigung vor das Auge des Betrachters. Gewalt und Konsens als Urformen der Streitlösung stehen am Anfang der Geschichte. Blutrache und Fehde bestimmten über lange Zeiträume die Rechtsdurchsetzung. Ob man sie als rechtliche Verfahren oder eher als tatsächliche Maßnahmen ansieht, ist vor allem eine sprachliche Frage.
Erst im hohen Mittelalter wurde die Fehde nach und nach bestimmten Spielregeln unterworfen. Die Gottes- und Landfrieden beschränkten sie zeitlich, örtlich und personell. Die entstehende Staatsgewalt versuchte, Frieden zu gewährleisten, und ging daher gegen die eigenmächtige Selbsthilfe vor, ohne sie zunächst aber zu verbieten. Der enge Zusammenhang von Fehdebeschränkung und hoheitlicher Gerichtsbarkeit stand den Zeitgenossen klar vor Augen. Besonders deutlich sieht man dies im Mainzer Reichslandfrieden von 1235. Er unterwarf nicht nur die Fehde mehreren strengen Voraussetzungen, sondern stellte mit dem erneuerten Reichshofgericht zugleich auch ein oberstes Reichsgericht bereit, das die königliche Gerichtsgewalt für jedermann sichtbar verkörperte. Erst mit dem Ewigen Landfrieden von 1495 gab es ein endgültiges Fehdeverbot. Erneut trat mit dem Reichskammergericht ein Gericht auf den Plan, das Landfriedensbrüche ahnden sollte. Im Hinblick auf die erste Leitfrage ist die Zäsur von 1495 gar nicht scharf genug zu ziehen. Auf dem Papier gab es nun das obrigkeitliche Gewaltmonopol, das Verbot jedweder Selbsthilfe, unterstützt durch ein neu organisiertes Gericht. Das hat Konsequenzen für den Aufbau dieses Lehrbuchs. In der Prozessrechtsgeschichte gibt es zwei wesentliche Zeittypen: Die Zeit vor dem staatlichen Gewaltmonopol und die Zeit unter dem staatlichen Gewaltmonopol. Dies erklärt die Zweiteilung des Buches.
Die hier gezogene Epochengrenze beruht auf einer deutschen Sichtweise. Eine deutsche Rechtsgeschichte erscheint manchen Rechtshistorikern inzwischen als verdächtig, teilweise gar als „unerträgliche Fiktion“. Doch wenn sich die Darstellung weithin auf die Rechtsgeschichte des deutschsprachigen Raumes beschränkt, behauptet sie damit nicht, die einheimische Rechtsgeschichte habe sich unbeeinflusst von anderen Traditionen aus ihren urgermanischen Wurzeln zur Blüte des 19. Jahrhunderts hin entwickelt. Zahlreiche Weichenstellungen verdankt das moderne Prozessrecht dem kanonischen Recht der mittelalterlichen Kirche und dann vor allem den französischen Reformen der napoleonischen Zeit. Auf dem Weg zum staatlichen Gewaltmonopol bildet 1495 aber eine Epochengrenze, die vorliegend einen älteren von einem neueren Sachtyp trennt. Auch Graustufen und Übergänge lassen sich mit der Leitfrage erfassen. Letzte Reste der Patrimonialgerichtsbarkeit und der Aktenversendung an Universitäten verschwanden erst mit den Reichsjustizgesetzen von 1877/79. Und die staatliche Gerichtsbarkeit begann im 20. Jahrhundert zu zerbröckeln. In den Diktaturen war die Justiz nicht nur Werkzeug politischer Interessen, sondern zugleich beschränkt durch Sonderrechte von Polizei und Parteiorganisationen. Schließlich hat mit dem Verblassen der Staatsgewalt seit etwa 1960 auch die Gerichtsbarkeit weiter Federn gelassen. Europäische und internationale Gerichtshöfe überlagern die staatliche Justiz, Schiedsgerichte umgehen sie, Mediationen und Vergleichsschlüsse schaffen Rechtsfrieden ohne staatlichen Befehl. Das Lehrbuch stellt im Schlusskapitel das klassische rechtsstaatliche Ideal der tatsächlichen modernen Buntheit gegenüber. Daraus folgen mehrfach sehr subjektive Wertungen. Aber Geschichtsschreibung kommt nicht umhin, die Vergangenheit zu deuten. Die Maßstäbe werden freilich nur selten offengelegt, tauchen hier aber an verschiedenen Stellen auf.
1.2.2 Gerichtsverfassung
Die zweite Leitfrage umkreist die Gerichtsverfassung. Untechnisch gesprochen geht es darum, wer Rechtsstreitigkeiten entscheidet. Im modernen Recht hat man es mit unabhängigen Berufsrichtern zu tun, die ein Jurastudium und zwei Staatsprüfungen absolviert haben. Die Gerichtsbarkeit ist horizontal in verschiedene Gerichtskreise bzw. Gerichtssprengel und vertikal auf mehrere Instanzen aufgeteilt. Dazu treten feste Zuständigkeitsregeln. Neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit gibt es andere Zweige, nämlich die Verwaltungs-, Arbeits-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit. Verfassungsgerichte des Bundes und der Länder vervollständigen das Bild. Doch auch innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind die jeweiligen Funktionen fest zugewiesen. Der Blick in die Geschichte zeigt erneut Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Über- und Unterordnung von Gerichten mit festen Instanzen begegnet zuerst im kirchlichen Bereich und wird im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation seit dem 15. Jahrhundert auch im weltlichen Recht greifbar. Der studierte Berufsrichter taucht ebenfalls seit dem Mittelalter in der Kirche, aber auch in italienischen Kommunen auf. Ganz anders sah die einheimische Tradition aus. Der Richter war hier Leiter des Verfahrens, nicht aber an der Urteilsfindung selbst beteiligt. Laienschöffen, ein sog. Umstand oder in der Frühzeit sogar die gesamte Gerichtsgemeinde fanden dagegen die Antwort auf die zu entscheidende Frage. An eine Gewaltentrennung ist hierbei nicht zu denken. Der Rat vieler mittelalterlicher Städte war zugleich Regierungsorgan und Gericht. In der Neuzeit waren die Universitäten in die Gerichtsverfassung eingebunden. Das Spruchkollegium der Juristenfakultäten entschied Anfragen in Zivil- und Strafsachen und beförderte damit zugleich die Professionalisierung der Rechtspflege. Ein besonderes Augenmerk gilt den jeweils obersten Gerichten. Wie waren sie organisiert und worüber entschieden sie?
1.2.3 Prozessrecht
Die dritte Leitfrage umkreist das zeitgenössische Prozessrecht. Hierbei geht es insbesondere um die Prozessmaximen und Rechtsmittel. Das moderne deutsche Gerichtsverfahren ist geprägt durch öffentliche, mündliche Prozessführung, die freilich umfassend schriftlich vorbereitet wird. Im Zivilprozess beherrscht die Dispositionsmaxime das Verfahren. Danach entscheiden die Parteien über die Angriffs- und Verteidigungsmittel und geben dem Gericht den Streitgegenstand vor. Der Verhandlungsgrundsatz besagt, dass die Parteien auch für die Beibringung der Tatsachen verantwortlich sind. Das Gericht ist im Grundsatz auf die Entscheidung der Sache beschränkt. „Da mihi facta, dabo tibi ius“ (Gib mir die Tatsachen, ich werde dir das Recht geben), lautet der lateinische Sinnspruch dazu.
Im Strafverfahren dagegen gilt die Offizialmaxime. Von Amts wegen geht der Staat gegen Straftäter vor und setzt seinen eigenen Strafanspruch durch. Dazu passt die Instruktions- bzw. Inquisitionsmaxime. Denn auch die Ermittlung des Sachverhalts ist hier eine hoheitliche Aufgabe und richterliche Pflicht. Die Entscheidungen aller Gerichte erwachsen in Rechtskraft, wenn sie nicht rechtzeitig angegriffen werden. Doch Rechtsmittel stehen bereit. Berufung und Revision führen den Streit in eine höhere Instanz (Devolutiveffekt) und halten das bereits ergangene Urteil in der Schwebe (Suspensiveffekt). Das Rechtsmittelgericht prüft sodann je nach Rechtsmittel, ob dem Untergericht Fehler bei der Rechtsanwendung oder bei der Ermittlung des Sachverhalts unterlaufen sind. Liegt eine endgültige Entscheidung vor, kommt es zur Vollstreckung. Der Straftäter empfängt seine Strafe, möglicherweise wandert er ins staatliche Gefängnis. Im Zivilprozess steht der Gerichtsvollzieher bereit, den durch Urteil bestätigten Anspruch mit staatlichem Zwang durchzusetzen.
Der rechtshistorische Blick zeigt abermals die Voraussetzungen für verschiedene Prozessformen auf. Eine weitgehend schriftlose (orale) Gesellschaft ohne studierte Juristen gelangt hierbei zu ganz anderen Lösungen als eine von gelehrten Berufsrichtern geprägte Rechtsordnung. Die mittelalterliche Laiengerichtsbarkeit beruht weitgehend auf Öffentlichkeit und Mündlichkeit. Strafprozess und Zivilverfahren waren lange Zeit nicht getrennt. Ziel des Verfahrens war es auch nicht, abstrakt-generelle Rechtsnormen auf einen Sachverhalt anzuwenden. Die Subsumtion ist vielmehr das methodische Rüstzeug des studierten Juristen. Im ungelehrten Prozess ging es demgegenüber darum, den gestörten Frieden wiederherzustellen. Deswegen erlangten Eide der Parteien eine besondere Bedeutung. Als Leumundseide zählten sie zu den sog. irrationalen Beweismitteln, die für die Entscheidungsfindung oftmals wichtiger wurden als die Sachverhaltsaufklärung. Der gelehrte Prozess bewirkte hier die entscheidenden Veränderungen, bezeichnenderweise zunächst im Strafrecht. Kleriker, denen bestimmte Amtsvergehen angelastet wurden, durften sich nicht mehr durch Reinigungseid selbst entlasten. Das Lehrbuch legt daher besonderen Wert auf den Wandel des Prozessrechts, der sich mit der Rezeption des gelehrten Rechts vollzog. Man meint damit traditionell die Verwissenschaftlichung und Professionalisierung des Rechts, auch die inhaltliche Anlehnung an römische und kanonische Vorbilder. Das Wort Rezeption und die früher teilweise damit verbundenen Vorstellungen sind inzwischen streitig geworden. Aber die Zunahme römisch-kanonischen Rechtsdenkens und das Universitätsstudium haben doch unübersehbar ihre Spuren hinterlassen. Das gilt in besonderer Weise für die Prozessrechtsgeschichte. Die Verschriftlichung des Verfahrens, feste Vorgaben für den Schlagabtausch zwischen den Parteien und ihren Anwälten, der Trend, hinter verschlossenen Türen zu entscheiden, die Möglichkeit, Urteile anzufechten – dies sind die entscheidenden Punkte, auf die es zu achten gilt. Untrennbar verbunden damit ist die Frage, ob und wie Gerichte ihre Entscheidungen gegenüber den Parteien, der Öffentlichkeit oder der Wissenschaft begründeten.
1.2.4 Auswirkungen der Leitfragen
Je stärker die Darstellung den Leitfragen folgt, auch wenn sie weitere Verfeinerungen vornimmt, desto deutlicher treten ganze Bereiche der Rechtsgeschichte in den Hintergrund. Die Rechtswissenschaft mit ihren Lehren spielt eine eher untergeordnete Rolle, ebenso über längere Phasen, vor allem in der älteren Zeit, die normativen Rechtsquellen. Das Lehrbuch wirft Schlaglichter auf die Geschichte der Rechtspraxis und bietet damit nur einen Ausschnitt aus einer allgemeinen Rechtsgeschichte. Vollständigkeit ist insoweit nicht angestrebt, auch nicht in quellenkundlicher Hinsicht. Die Zuspitzung soll es dagegen ermöglichen, die wesentlichen Linien der Prozessrechtsgeschichte zu erkennen, einzelne Stationen der Geschichte miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise ein tieferes Verständnis für die Grundbedingungen der jeweiligen Rechts- und Gerichtsordnung zu schärfen. Damit erhalten Studierende zugleich eine Vorlage, um sich auch in fremde Zeiten und Gebiete der Rechtsgeschichte einzuarbeiten. Das Lehrbuch möchte insofern ausdrücklich zur weiteren Quellenlektüre und zum Selbststudium ermutigen.
1.3 Forschungsstand
Ein Lehrbuch zur Geschichte der einheimischen Gerichtsverfassung und des Prozessrechts gab es bis 2015 nicht, geschweige denn eine umfassende Gesamtdarstellung. Die älteren Werke zur Deutschen Rechtsgeschichte enthalten häufig Kapitel über „Gericht und Rechtsgang“, oftmals aus einer romantischen oder national-rechtsstaatlichen Perspektive. Die Quellenkenntnis von Autoren wie Heinrich Brunner, Richard Schröder oder Eberhard Freiherr von Künßberg beeindruckt noch heute. Das Gesamtbild, das ihre Bücher vermitteln, ist freilich seit Jahrzehnten überholt. Gerade die Sichtweise auf die frühen Phasen der Rechtsgeschichte, auf die sog. germanische und fränkische Zeit bis weit ins Mittelalter hinein, hat sich deutlich gewandelt. Aber selbst jüngere Lehrbücher wie das von Heinrich Mitteis 1949 begründete auflagenstarke Becksche Kurzlehrbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte haben bis zur letzten Neubearbeitung 1992 durch Heinz Lieberich unbeirrt am überkommenen germanistischen Blick auf die Vergangenheit festgehalten.
1.3.1 Lehrbücher
Eine echte Zäsur bedeutete deshalb das ganz eigenständige und neuartige Lehrbuch von Karl Kroeschell, 1972 begründet und nach und nach auf drei Bände erweitert. Den überlieferten Titel „Deutsche Rechtsgeschichte“ behielt dieses Werk bei, verzichtete aber bewusst auf große Linien und ein konstruiertes Gesamtbild. In kleinen Abschnitten kommen einzelne Episoden aus der Rechtsgeschichte, aber auch aus der Forschungsdiskussion daher und führen den Leser detailgenau in ausgewählte Bereiche ein. Zahlreiche abgedruckte Quellen regen zum Selbststudium an, sind freilich mit dem Text des Lehrbuchs kaum verknüpft. Die Prozessrechtsgeschichte nimmt bei Kroeschell einen breiten Raum ein. Gerade für die ältere Zeit hat er damit Maßstäbe gesetzt, hinter die neuere Darstellungen nicht zurückfallen dürfen. Andererseits ermöglichen es die oben angesprochenen Leitfragen, inhaltlich deutlich andere Schwerpunkte als Kroeschell zu setzen, Quellen umfassender einzubinden und stärker ausdrückliche Vergleiche zwischen den Epochen anzustreben. Überdies sind die Schilderungen des Kroeschellschen Lehrbuchs erheblich knapper und oft nur skizzenhaft.
Den ausdrücklichen Anspruch, die Geschichte der Gerichtsbarkeit lehrbuchhaft darzustellen, haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland nur zwei Bücher erhoben. Im Erscheinungsjahr nur hauchdünn voneinander getrennt, erschienen 1954 eine „Geschichte der Gerichtsverfassung“ von Eduard Kern und 1953 die „Geschichte der deutschen Rechtspflege seit 1500“ von Erich Döhring.
Kerns Darstellung ist ihrem Anspruch nach ein klassisches Kurzlehrbuch. Es geht nicht um Forschungsfragen oder Literaturdiskussion, sondern um die gedrängte Vermittlung historischen Sachwissens. Der Bogen ist weit gespannt von der germanischen Frühzeit bis zum Nationalsozialismus. Aber nicht nur der methodisch veraltete rein normengeschichtliche Zugriff auf die einheimische Rechtsgeschichte stört aus heutiger Sicht. Viel gewichtiger ist ein anderer Einwand. Kerns Lehrbuch gibt sich überdeutlich als Einführung in das geltende Recht aus, gewissermaßen als erster Teil seines zweiten Lehrbuchs zum geltenden Gerichtsverfassungsrecht. Deswegen stehen die neuere Zeit und die Moderne ganz im Mittelpunkt. Die ältere Rechtsgeschichte muss sich mit wenigen Seiten begnügen, und genau sie beruhen auch nicht auf eigenen Arbeiten des Verfassers, sondern auf den noch älteren klassischen Großlehrbüchern. Kern war kein Rechtshistoriker, und das merkt man seinem Buch an. Für die neuere Gerichtsverfassung bietet sein Werk freilich viel Stoff, an den sich anknüpfen lässt.
Ein zweiter Gesichtspunkt mag nicht entscheidend sein, zeigt jedoch, wie sich der Zugriff auf die Geschichte in den vergangenen sechs Jahrzehnten geändert hat. Für Kern geht es schwerpunktmäßig um die Schilderung einer normativen Rechtslage. Gerichtsordnungen und Prozessgesetze bilden das Rückgrat des Buches. Die Praxis tritt dahinter zurück. Allgemeinhistoriker werfen genau dies der älteren von Juristen betriebenen Rechtsgeschichte gern vor. Der Blick auf die Normen soll den Zugriff auf die historische Wirklichkeit verstellen. Doch hier ist zu differenzieren. Die Existenz einer Norm, ihr Erlass, ihr Inhalt und auch ihre zeitgenössische Auslegung sind als solches genauso historische Tatsachen wie ein Mordfall, eine Folterung oder ein Gerichtsurteil. Je für sich handelt es sich um Gegenstände, die einer rechtshistorischen Erforschung bedürfen. Es darf nur nicht der Eindruck entstehen, die Kenntnis historischer Gesetze eröffne die Sicht auf die Rechtspraxis. Sein und Sollen bleiben auch in der Prozessrechtsgeschichte getrennt. Auf der anderen Seite sind übermäßige Vorbehalte von Rechtshistorikern gegen eine Beschäftigung mit der Geschichte der Rechtspraxis unbegründet. Es gibt kein methodisches Gebot, zunächst eine wie auch immer verstandene Rechtslage zu erforschen, bevor man sich der zeitgenössischen Praxis zuwenden darf. Hier unterscheiden sich schlichtweg persönliche Interessen und auch die jeweiligen Quellengrundlagen. Aber genau deswegen kann ein Lehrbuch wie das von Kern eine moderne Prozessrechtsgeschichte nicht ersetzen.
Erich Döhring legte 1953 mit seiner „Geschichte der deutschen Rechtspflege seit 1500“ ein ganz ungewöhnliches und eigenständiges Werk vor. Ob es sich um ein studentisches Lehrbuch oder eher um ein Lesebuch für gebildete Juristen handeln soll, bleibt etwas unklar. Im Zugriff jedenfalls brach Döhring mit vielen Eigentümlichkeiten der Lehrbuchliteratur. Das zeigt sich bereits an der Gliederung. Die überkommene Chronologie mit ihren traditionellen Epochenbezeichnungen ist aufgelöst in mehrere Hauptteile, die u. a. verschiedene juristische Berufe wie Richter und Anwälte beleuchten. Und hier geht es Döhring auch nicht nur um die jeweilige Gesetzeslage, sondern zusätzlich um Fragen wie Ausbildung und Einkommen. Mit der weitgehenden Beschränkung auf die Neuzeit schließt sich das Buch anderen seinerzeitigen Darstellungen an, etwa der „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit“ von Franz Wieacker (erstmals 1952) oder der als Fach im Entstehen begriffenen „Verfassungsgeschichte der Neuzeit“. Doch die Ausblendung der älteren Geschichte fordert bei Döhring ihren Preis. Denn wie lehrreich der Vergleich zwischen dem mittelalterlichen und dem neuzeitlichen Prozessrecht sein kann, vermag sein Buch nicht zu zeigen und will dies auch gar nicht. Außerdem haben sich nicht nur zahlreiche Sichtweisen im Laufe eines halben Jahrhunderts geändert. Vor allem hat sich unsere Kenntnis der neuzeitlichen Rechtspflege erheblich verbessert. Dennoch ist Döhrings Werk zu Unrecht in die zweite Reihe getreten. Es handelt sich um einen beherzten und originellen Zugriff, der auch heute noch zahlreiche Einzelheiten vermittelt, die in keinem gängigen Lehrbuch zu finden sind.
Nur der Vollständigkeit halber sei ein weiteres Buch kurz erwähnt, das ein wenig aus dem Rahmen fällt. Es handelt sich um den bekannten und weit verbreiteten Katalog des Kriminalmuseums Rothenburg ob der Tauber mit dem sehr vielversprechenden Titel „Justiz in alter Zeit“. Doch geht es dort gerade nicht um eine Geschichte der Gerichtsbarkeit. Zahlreiche einzelne Beiträge stammen zwar aus der Feder von Rechtshistorikern. Der Schwerpunkt liegt aber auf der älteren Strafrechtsgeschichte mit Ausgriffen auf das frühneuzeitliche Policeyrecht. Die Zeit ab etwa 1800 fehlt vollständig. Im Vordergrund stehen die zahlreichen Abbildungen frühneuzeitlicher Gerichtsszenen, Exekutionen und Schandstrafen. Trotz des sehr günstigen Verkaufspreises wird das Werk wohl kaum als Lehrbuch genutzt.
Rechtshistorische Lehrwerke zur Prozessrechtsgeschichte, zu Gericht und Verfahren sind auch im Ausland eher rar gesät. Wichtige Überblicke stammen von Raoul C. van Caenegem zur Rolle des Richters, aber auch zum Zivil- und Strafprozess. Aus Frankreich gibt es die umfangreiche Übersicht einer Autorengruppe um Jean-Pierre Royer sowie die Bücher von Benoît Garnot und Jean-Marie Carbasse (Lit. zu 1.3.1).
1.3.2 Forschungsliteratur
Im Gegensatz zur Lehrbuchliteratur ist die Spezialforschung zu wichtigen Bereichen der Prozessrechtsgeschichte in den letzten Jahrzehnten geradezu aufgeblüht. Diese Arbeiten betreffen zumeist einzelne Aspekte und sind nur selten epochenübergreifend angelegt. Die Literaturübersichten am Ende des Buches geben darüber Auskunft. Hier genügen wenige Schlaglichter. In den 1950er und 1960er Jahren standen Untersuchungen zur mittelalterlichen Laiengerichtsbarkeit im Vordergrund des Interesses. Begleitet durch wichtige Quelleneditionen haben Wilhelm Ebel und Adalbert Erler mit ihren Schülerkreisen den Lübecker Rat sowie den Ingelheimer Oberhof als mittelalterliche Gerichte erforscht. Sowohl die Gerichtsverfassung innerhalb einzelner Rechtskreise mit ihren Oberhofzügen als auch das jeweilige Prozessrecht sind seitdem gut bekannt. Einen sehr hilfreichen Überblick stellte 1981 Jürgen Weitzel zusammen, doch blieb die Forschung seitdem nicht stehen. Für die frühmittelalterliche Zeit legte Weitzel selbst mit einer umfassenden Arbeit zur dinggenossenschaftlichen Rechtsfindung 1985 ein monumentales Werk vor, das sowohl die Gerichtsverfassung als auch das Prozessrecht beleuchtet. Die seitdem intensiv ausgefochtenen Meinungsverschiedenheiten über das mittelalterliche Verständnis von Recht, Norm und Spielregel haben immer auch den Blick auf die Gerichte gelenkt. Daran lässt sich anknüpfen.
Zeittypisch mit der allgemeineren Verlagerung des rechtshistorischen Forschungsschwerpunkts vom Mittelalter in die Neuzeit nahmen seit den 1960er und vor allem 1970er Jahren die Arbeiten zur frühneuzeitlichen Gerichtsbarkeit sprunghaft zu. Hier waren es vor allem die obersten Gerichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, denen sich viele Rechtshistoriker widmeten. Begleitet von einer umfassenden Erschließung des riesigen Aktenbestandes entstanden zunächst zahlreiche Untersuchungen zum Reichskammergericht. Zeitverzögert schloss sich die noch lange nicht abgeschlossene Inventarisierung der Reichshofratsakten an, die ihrerseits die Reichshofratsforschung bis heute beflügelt. Die einst als Schwäche verpönte Urteilsarmut der beiden Reichsgerichte und die bekannten Schwierigkeiten, Entscheidungen durchzusetzen, haben hier zu neuen Sichtweisen geführt. Möglicherweise ging es den Parteien gar nicht immer darum, ein Urteil zu erlangen. Vielleicht bot die gerichtsförmliche Austragung von Konflikten nur die Möglichkeit, sich leichter friedlich zu einigen. Jedenfalls verlangen solche Ansätze danach, auch in einer Geschichte der Gerichtsbarkeit die außergerichtliche Beilegung von Rechtsstreitigkeiten immer mit im Blick zu behalten. Seit etwa 2010 sind die Untersuchungen zur außer-, vor- oder nebengerichtlichen Streitbeilegung nahezu explosionsartig angestiegen. Beeinflusst von der heutigen Überlagerung der staatlichen Justiz durch Schiedsverfahren, Mediation, Vergleichsschlüsse und andere Formen alternativer Konfliktregulierung haben viele Historiker und Rechtshistoriker hier ein weites Forschungsfeld gefunden. Doch bleibt es daneben weiterhin zulässig und auch notwendig, die spezifisch gerichtliche Form der Entscheidungsfindung gesondert in den Blick zu nehmen. Ausgehend von den obersten Reichsgerichten ist es nur ein kurzer Schritt, auch territoriale Obergerichte näher zu beleuchten. Hier bleibt noch viel zu tun, aber vor allem mit dem schwedisch-deutschen Wismarer Tribunal ist inzwischen ein Anfang gemacht. Seine Akten aus der Mitte des 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein werden erschlossen, die Arbeit des Gerichts nach und nach untersucht. Arbeitskreise auf europäischer und internationaler Ebene bemühen sich darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der höchsten Gerichte verschiedener Staaten und Territorien herauszuarbeiten und auf diese Weise eine Typologie der vormodernen Justiz zu entwickeln.
Stehen bei solchen Unternehmungen die Gerichtsverfassung und die Ziviljustiz stark im Mittelpunkt, so ist der vormoderne Strafprozess seit etwa 1990 nicht nur von Rechtshistorikern, sondern aus sozial- und kulturgeschichtlicher Perspektive auch von den Vertretern der historischen Kriminalitätsforschung beleuchtet worden. Hier ging es vornehmlich um die Rechtspraxis, wenn auch das Interesse für das zeitgenössische Recht unterschiedlich stark ausgeprägt war. Die wichtigsten rechtshistorischen Erkenntnisse zum frühneuzeitlichen Strafprozess bis hin zu den Reformen in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat Alexander Ignor zusammengestellt.
Die kirchliche Rechtsgeschichte kann für die Gerichtsverfassung und das Prozessrecht herausragende Bedeutung beanspruchen. Deswegen ist es besonders erfreulich, wenn mit den quellengesättigten Untersuchungen von Wiesław Litewski und Knut Wolfgang Nörr zwei handbuchartige Zugriffe zum gelehrten mittelalterlichen Prozessrecht vorliegen, an die sich das Lehrbuch anlehnen kann. Zur frühen Neuzeit hin fehlt es an vergleichbaren Zusammenfassungen. Doch sind die Rota Romana und auch einige Archidiakonal- und Offizialatsgerichte im deutschen Raum gut erforscht. Hinzu treten umfassende Quellenerschließungen und Studien zur Tätigkeit der päpstlichen Nuntiatur in Deutschland und damit auch zur Praxis der Nuntiaturgerichtsbarkeit.
Beim Blick in die neuere Zeit fallen zunächst Arbeiten zum Reichsgericht und zur nationalsozialistischen Justiz ins Auge. Neben vielen anderen hat sich hier Werner Schubert durch zahlreiche Quelleneditionen und Studien Verdienste erworben. Erstaunlicherweise kommt in der Forschungsliteratur die Mitte des 19. Jahrhunderts etwas zu kurz. Dagegen ist die Zeit zwischen dem Ende des Alten Reiches und der Gerichtseinheit von 1877/79 in der Privatrechts- und Wissenschaftsgeschichte gut untersucht. Über die großen Rechtsdenker und ihre Lehren gibt es tiefgehende Untersuchungen. Zu den territorialen Gerichten und ihren Prozessen sucht man vergleichbare Studien aber weitgehend vergeblich. Ein Arbeitskreis zur Justizgeschichte widmet sich gezielt dem 19. Jahrhundert, besonders im deutsch-spanischen Vergleich. Doch bleibt hier noch viel zu tun.
Für die Zeitgeschichte nach 1945 ist das Eis ebenfalls brüchig. Zwar liegen zum Bundesgerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht mehrere Arbeiten vor, wenn auch oft aus Jubiläumsanlässen verfasst. Dasselbe gilt für zahlreiche Oberlandesgerichte. Rechtshistorische Studien zur Veränderung des Prozessrechts und der Gerichtspraxis sind aber für die Bundesrepublik nur spärlich vorhanden. Für die Geschichte der Prozessmaximen hat Jürgen Damrau bereits 1975 eine wichtige Einzeluntersuchung vorgelegt. Und für den Bereich der Deutschen Demokratischen Republik steuerte Inga Markovits eine feinmaschige Quellenstudie zur alltäglichen Gerichtspraxis in Wismar bei. In den Einzelheiten zuverlässig, aber zugleich verschleiert und als Sachbuch über „Lüritz“ bemäntelt, eröffnen sich hier zahlreiche Anknüpfungsmöglichkeiten.
1.4 Gang der Darstellung
Der Kirchenrechtler und Verfassungsjurist Otto Mejer schrieb im 19. Jahrhundert im Vorwort zu einem Lehrbuch, auf dem Katheder dürfe der Professor frei von der Leber weg seine eigene Meinung verkünden, im Lehrbuch sei er aber auf strenge und unpersönliche Sachlichkeit beschränkt. Dieser Mahnung folgt das vorliegende Buch nicht. Vielleicht war die Einschätzung bereits damals unrichtig. Stoffauswahl, Gliederung und Darstellungsweise sind höchstpersönliche subjektive Entscheidungen des Verfassers, der seine eigenen Vorlieben zu einer angeblich objektiven Geschichtserzählung erhebt. Deswegen ist es ehrlicher, den eigenen Zugang von vornherein offenzulegen.
Das vorliegende Lehrbuch verzichtet auf die klassische Antike und das römische Recht. Die überkommene Trennung von römischer und deutscher Rechtsgeschichte wird wissenschaftlich oft angegriffen und teilweise belächelt. Sie ermöglicht es aber, die Stoffmassen zu begrenzen. Das römische Prozessrecht mit seiner Gerichtsverfassung, von Max Kaser und Karl Hackl handbuchartig zusammengestellt, umfasst volle 1000 Jahre ganz unterschiedlicher politischer, gesellschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen. Hier kurzerhand die großen Linien herauszumeißeln, sollte lieber den Spezialisten vorbehalten bleiben.
Die zweite Eigenheit besteht darin, Rechtsgeschichte über weite Strecken als Geschichte der Rechtspraxis anzusehen und darzustellen. Nicht nur Lehrbücher, sondern in hohem Maße auch die Werke der älteren Literatur haben gerade hier ihren blinden Fleck. Es geht also nicht um die Gipfelwanderung der großen Rechtsdenker oder um die altbekannte Dogmengeschichte. Der normengeschichtliche Zugriff bildet ebenfalls nur einen Teil der Darstellung. Es geht vielmehr um die Frage, wie die Gerichte in ihrer alltäglichen Arbeit organisiert waren und wie ihre Prozesse abliefen. Selbstverständlich spielen Prozessgesetze dafür eine entscheidende Rolle. Aber wenn die Praxis eigene Wege ging, steht der Gerichtsalltag neben den normativen Vorgaben. Zeigen sich hier Unterschiede, handelt es sich in den meisten Epochen nicht lediglich um Verstöße, Abweichungen oder Missbrauch des Gesetzes. Ob der Blick auf die Rechtspraxis die angemessene Art bildet, Rechtsgeschichte zu betreiben, mag man gern diskutieren. Der Versuch wird hier unternommen und soll zeigen, welche Felder und Sichtweisen sich auf diese Weise eröffnen. Gerade dort, wo die Forschungen zur Praxis noch nicht so weit vorangeschritten sind, bleibt der Rückgriff auf zeitgenössische Gesetze und Literatur freilich unumgänglich. Das betrifft vor allem die neuere Zeit.
Die nächste Grundentscheidung betrifft den Umgang mit Quellen. Das Lehrbuch bietet an zahlreichen Stellen Quellenexegesen. Die Quellen sprechen nicht von selbst zu uns. Sie antworten nur auf die Fragen, die wir ihnen stellen. Deswegen folgen auf den Quellentext regelmäßig Erläuterungen. Auf diese Weise unterscheidet sich das Lehrbuch didaktisch stark von Kroeschells Konzept. Kroeschell stellt zahlreiche Quellen meist unkommentiert aneinander und schließt mit diesen Texten seine einzelnen Kapitel ab. Im Vergleich dazu sind die Quellentexte hier in den Gang der Darstellung eingebunden. Vom Detail her sollen auf diese Weise allgemeine Beobachtungen entwickelt werden. Das verlangt zugleich nach einer deutlich verringerten Zahl an Quellen. Hier gibt es Grenzen, die ein Kurzlehrbuch nicht sprengen darf, wenn es studentische Leser wirklich erreichen will. Parallel zur Neuauflage dieses Lehrwerks erscheint in derselben Reihe „Wege zur Rechtsgeschichte“ ein Buch mit über 20 Exegesen aus der Feder verschiedener Rechtshistoriker. Hier finden interessierte Leser zahlreiche Anregungen zur Quellenbearbeitung.
Die nächste Weichenstellung ist ebenfalls bewusst getroffen. Das Buch richtet sich in erster Linie an Studierende, die in frühen oder mittleren Semestern rechtshistorische Lehrveranstaltungen besuchen oder sich im Selbststudium mit der Rechtsgeschichte befassen wollen. Im Gegensatz zu einer speziellen Forschungsmonographie darf man die Kenntnis des Forschungsstandes daher selbst in Grundzügen nicht voraussetzen. Deswegen ist es angezeigt, an einzelnen Stellen rechtshistorische Zusammenhänge, Begriffe oder Quellen knapp zu erläutern, auch wenn dies aus einer engeren Prozessrechtsgeschichte in die allgemeine Rechtsgeschichte ausgreift. Weitgehend voraussetzungsfrei geschrieben, knüpft das Buch hoffentlich an geschichtliches Schulwissen an und möchte vor allem Freude und Begeisterung an selbständiger Vertiefung wecken. Die Literaturhinweise verstehen sich daher als Empfehlungen weiterzuarbeiten, nicht als vollständige Übersicht über die Forschungsliteratur. Ob und inwieweit die Rechtsgeschichte in der Lehre auf Kenntnissen des geltenden Rechts aufbauen kann, hängt ganz davon ab, wann sie unterrichtet wird. Für eine Geschichte der Gerichtsbarkeit ist Grundwissen über die moderne Gerichtsverfassung und das Zivil- und Strafprozessrecht zweifellos hilfreich. Doch versucht das Lehrbuch auch hier, diejenigen Grundlagen des modernen Rechts, die zum historischen Vergleich dienen, selbst zu legen. Einzelne Fachbegriffe sind im Glossar knapp erläutert. Das Glossar eignet sich auf diese Weise zugleich zur Wiederholung des Basiswissens.
Der letzte Punkt betrifft den Gang der Darstellung. Wenn auch die Stoffauswahl und Schwerpunktsetzung den oben genannten Leitfragen folgen, bleibt das Buch im Wesentlichen der Chronologie verpflichtet. Ob die Rechtsgeschichte als Problemgeschichte ihre je einzelnen Fragen herausgreifen und den Stoff an ihnen ausrichten soll oder ob es vielmehr darum geht, Epochenbilder zu zeichnen und in ihnen dieselben Aspekte zu klären, stellt eine seit zwei Jahrhunderten bekannte Gretchenfrage dar. Schon Friedrich Carl von Savigny sah sich gemüßigt, Einwände gegen die chronologischen Abhandlungen seines Vorgängers Gustav Hugo zu erheben und selbst die jeweiligen Einzelprobleme zum Gerüst seiner Bücher zu erheben. Es geht dabei nicht nur um den Geschmack des jeweiligen Verfassers, sondern ebenfalls um historische oder juristische Grundbekenntnisse. Dennoch behält die Chronologie ihren Reiz. Der Gang des Lehrbuchs folgt dem Gang der Zeit. Gerade für die Leitfrage nach dem Verhältnis zwischen Staatsgewalt, Gerichtsverfassung und Prozessrecht erscheint dies sinnvoll. Die Gefahr liegt auf der Hand. Allzu leicht mag man überall „Entwicklung“ sehen, vielleicht „Entwicklungen“ sogar, vom Rohen zum Hohen, von der primitiven Frühzeit zum voll entfalteten Rechtsstaat der Moderne. Doch diese Überheblichkeit steht dem Rechtshistoriker genauso wenig zu wie die Verherrlichung der Germanen als urtümlich oder der staufischen Kaiser als glanzvoll in der älteren rechtsgeschichtlichen Literatur. Andererseits darf die Rechtsgeschichtsschreibung den Mut nicht verlieren, Geschichte auch zu werten. Zum Sammeln und Sichten treten das Ordnen und Prüfen. Abermals geht es um ganz subjektive und eigenwillige Meinungen und Vorlieben. Sie sollen hier nicht hinterm Berg gehalten werden. Wenn sich dagegen Widerstand von studentischer Seite regt, angestachelt durch bohrendes Selbststudium, wäre das ein Glücksfall. Denn ist erst einmal das Gespräch über die Inhalte eröffnet, dann geht es wirklich darum, wie man das sprichwörtliche Reflexionswissen, das die Rechtsgeschichte bereitstellt, am besten nutzen kann.
1.5 Ein Wort zur Benutzung des Lehrbuchs
Ein Universitätsstudium lebt ganz wesentlich vom Selbststudium des Einzelnen. Gerade in einem forschungsnahen Fach wie der Rechtsgeschichte können Lehrveranstaltungen immer nur schmale Ausschnitte aus der Stofffülle bieten. Doch wenn es in die Tiefe geht, kosten breitgestreckte Einleitungen viel Zeit. Dasselbe Problem ergibt sich bei der Arbeit mit dem vorliegenden Buch. Die Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozessrechts stehen im Mittelpunkt, sind doch aber eingebettet in die allgemeine Geschichte und Rechtsgeschichte. Diesen größeren Rahmen kann das Lehrbuch nicht selbst abstecken, sondern oft nur ganz knapp andeuten. Weiterführende Informationen vermitteln einführende Lehrwerke, je nach Interesse und Lesefleiß auch größere Handbücher und Monographien. Die am Ende des Buches zusammengestellten Literaturhinweise ermöglichen einen Einstieg. Und die regelmäßig kommentierten, häufig auch gewichteten Vertiefungshinweise zu den Einzelkapiteln sollen Benutzer neugierig machen, tiefer in den Stoff einzudringen. Dort finden sich vor allem auch Nachweise für die im Text genannten Autoren und Einzelheiten.
Das Lehrbuch selbst ist von seinem ganzen Zugriff, vor allem in der Zuspitzung auf wesentliche Veränderungen über die Zeiten hinweg, darauf ausgerichtet, am Stück durchgelesen zu werden. Tatsächlich sind auch längere Textpassagen als Fließtexte konzipiert und von Anfang an so geschrieben worden. Viele Überschriften geben zwar Auskunft über inhaltliche Einzelheiten und sind an eine abschnittsweise Lektüre angepasst. Es handelt sich aber gerade bei den Unterkapiteln nicht um abgeschlossene kleine Abhandlungen. Es gibt oftmals Vor- und Rückgriffe und überspannende Gedanken, die sich durch längere Abschnitte ziehen. Die Gliederung kommt insofern studentischen Lesegewohnheiten entgegen, lässt den Text aber nicht zerfasern. Aus didaktischen Gründen ist auch im Kleinen teilweise die Chronologie durchbrochen, um durch die Gegenüberstellung zeitlich entfernter Einzelheiten den Blick auf Zusammenhänge offenzuhalten, die sonst verschüttet zu werden drohen.
Die Quellenlektüre bereitet erfahrungsgemäß besonders viel Unbehagen. Die alten Texte, manchmal sogar die neueren Quellen, sind sperrig, sprachlich schwer lesbar und häufig auch inhaltlich nicht leicht zu verstehen. In einem Fach, in dem so viel von Konstruktion und Rekonstruktion die Rede ist, sollen die Quellen aber gleichsam ein stabiles Fundament legen. Denn die Existenz dieser Texte ist eine der wenigen wirklich sicheren historischen Tatsachen, von denen wir ausgehen können. Was daraus folgt, ist schon weniger eindeutig. Der naheliegenden Versuchung, die Quellentexte einfach zu überblättern, sollte der Benutzer des Buches aber widerstehen. Es gibt das sprichwörtliche Vetorecht der Quellen. Die Rückbindung der Geschichte, auch der Rechtsgeschichte, an die Überlieferung ist unaufgebbar und zwingend. Quellenferne Behauptungen lassen sich schnell widerlegen. So lehnte es etwa Joseph Hansen, ein Vorreiter der Hexenforschung, ab, frühneuzeitliche Prozessakten auszuwerten, weil sie ein Schreckensbild „voll grausiger Einförmigkeit“ böten. Aber der Blick in einige wenige Akten belegt unschwer das Gegenteil. Deswegen darf man die Quellen nicht einfach beiseite schieben, auch wenn sie sperrig sein mögen.
Oftmals sind ältere Texte in aufbereiteten und geglätteten Fassungen ediert. Doch tatsächlich ist und bleibt es häufig schwierig, den Wortlaut verlässlich zu ermitteln. Das Lehrbuch umschifft diese Klippe nicht und bietet deswegen gelegentlich auch Auszüge aus historisch-kritischen Editionen. Der Zugang zur vereinfachten Arbeitsfassung ist freilich dann vermerkt, wenn es solche Ausgaben gibt. Außerdem sind ältere einheimische Texte regelmäßig ins Hochdeutsche übertragen, um von der modernen Sprache den Weg zurück zur Quelle zu weisen. Hier sei dringend an die Selbstdisziplin der Benutzer erinnert. Die Zeit, die man opfert, eine auf den ersten Blick unzugängliche Quelle zu entschlüsseln, zahlt sich oft aus. Gerade auf der Faszination der Quellen beruht zum großen Teil der Reiz der Rechtsgeschichte. Ein Gespür hierfür zu wecken, ist sogar eines der wesentlichen didaktischen Ziele des Buches.
Das Verhältnis der Rechtsgeschichte zum geltenden Recht steht seit langem in der Diskussion. Ist es die Aufgabe anspruchsvoller Dogmatiker, ihrerseits die Wurzeln des heutigen Rechts freizulegen, um es besser zu verstehen? Ist es die Aufgabe von Rechtshistorikern, Vorgeschichten zu liefern, um das geltende Recht als Gewordenes geschichtlich einzurahmen? Kann man aus der Geschichte überhaupt etwas lernen, vielleicht sogar, wie ein gerechtes Recht aussehen sollte? Oder steht einer solchen applikativen Verlockung eine kontemplative Rechtsgeschichte gegenüber, die selbstgenügsam in der historischen Erkenntnis ihren alleinigen Daseinszweck findet? Ein Lehrbuch muss nicht auf jeder Seite dazu Stellung nehmen. Doch das Augenmerk auf den Prozessmaximen und dem staatlichen Gewaltmonopol ist nicht völlig losgelöst von Grundfragen auch des modernen Rechts. Einige Regelungsprobleme stellen sich über die Zeiten hinweg in ähnlicher Weise, und die historischen Antworten sind in ihrer Bandbreite begrenzt. Vielleicht gibt es keine Wiederkehr von Rechtsfiguren im dogmatisch-technischen Sinn. Aber die jeweiligen zeitgenössischen Lösungen für gleichartige Fragen können durchaus die scheinbare Selbstverständlichkeit des modernen Rechts erschüttern. Auf diese Weise hilft das historische Reflexionswissen durchaus, den kritischen Blick auf das heutige Recht zu schärfen. So schafft das Studium der Rechtsgeschichte aus der Beobachterperspektive Verständnis für das moderne Recht, zugleich aber auch heilsame Distanz. Dieser Vorrat an Einsichten, den eine Problemgeschichte vermittelt, mag sich sogar als hilfreicher erweisen als die bloße Ansammlung zahlreicher Einzelheiten, deren Bedeutung vor allem für studentische Leser unklar bleibt. Ein wirklich wissenschaftliches Jurastudium kommt um die Beschäftigung mit den Grundlagen des Rechts nicht umhin.
2 Die Zeit vor dem staatlichen Gewaltmonopol
2.1 Hinführung zum Thema
Am Anfang war kein Recht. Und Gerichte waren nicht da. Und es herrschten Gewalt und Aussöhnung, kam es zum Streit. Und es gab keine verbindlichen Verfahren noch Entscheidungen, die jemand hätte durchsetzen können.
In einem scharfsinnigen Aufsatz über die Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft erklärt Wolfgang Ernst gleich zu Beginn: „Alle Gesellschaften haben Recht (…). Beim Recht handelt es sich insofern um eine anthropologische Konstante.“ Ich glaube das nicht. In der Tat geht es hierbei um Glaubenssätze und vor allem um die Definition, was wir überhaupt unter Recht verstehen. Über die ältesten menschlichen Kulturen und ihre Vorstellungswelt wissen wir nämlich nichts. Geschichtsschreibung und damit auch die Rechtsgeschichte beruht auf Quellen. Nach einer eingebürgerten Zweiteilung lassen sich unmittelbare von mittelbaren Rechtsquellen unterscheiden. Unmittelbare Rechtsquellen sind selber Recht, also etwa Gesetze, Verträge oder je nach Sichtweise auch Gerichtsurteile. Mittelbare Rechtsquellen sagen etwas über das Recht aus und geben eher indirekte Hinweise. Unmittelbare Rechtsquellen liegen regelmäßig in schriftlicher Form vor. Für die Zeit vor Beginn der schriftlichen Überlieferung lassen sich also keine gesicherten Aussagen treffen. Es gibt aber das unstillbare Verlangen, die ältesten Vorformen von Recht wenigstens in groben Umrissen zu erfassen. Dafür hat die Rechtsgeschichte drei Möglichkeiten entwickelt: Die Rückprojektion, den Vergleich mit ethnologischen Erkenntnissen über Naturvölker sowie die Auswertung archäologischer Funde.
2.1.1 Rückprojektion
Die Rückprojektion ist eine Methode, die vor allem in der älteren Deutschen Rechtsgeschichte weit verbreitet war. Die Überlegung klingt plausibel. Die ältesten bekannten Rechtsquellen verschiedener germanischer Völkerschaften zeigen nämlich bestimmte Gemeinsamkeiten. Wenn diese ähnlichen Rechtsregeln nicht auf Eigenentwicklungen beruhen und ihrerseits nicht aus einer dritten Quelle stammen, können sie auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen. Dieser Ansatz gleicht der Vorgehensweise der Sprachwissenschaft. Aus der Verwandtschaft verschiedener einzelner Sprachen hat sie eine germanische Sprachfamilie bis hin zu einer indogermanischen Ursprache rekonstruiert. Friedrich Carl von Savigny, der große Rechtsgelehrte des 19. Jahrhunderts, war überzeugt, dass Recht sich genauso entwickele wie Sprache. Trifft dies zu, ist die Rückblende bis in die schriftlose Zeit geradezu geboten. Doch gilt es hier, zahlreiche Fallstricke zu umgehen. Wie will man ausschließen, dass ein Rechtsinstitut nicht doch auf zufälligen, gleichzeitigen Sonderentwicklungen beruht? Und wie soll man sicher sein, ob eine Regel nicht von anderswo übernommen wurde? Die ältere Forschung scherte beherzt mittelalterliche nordische Quellen, Stammesrechte aus der fränkischen Zeit und anderes über einen Kamm. Für die Prozessrechtsgeschichte mag ein Beispiel genügen. Angeblich, so behauptete eine verbreitete Lehrmeinung, gab es eine gemeingermanische Friedensordnung, geprägt von einer Mannheiligkeit jedes einzelnen freien Mannes. Verstöße gegen den rechtlich gebotenen Frieden stellten den Täter unmittelbar und ohne Weiteres außerhalb der Rechtsordnung. Ohne Gerichtsverfahren, ohne Verurteilung verfiel er der gemeingermanischen Friedlosigkeit, wurde gleichsam zu einem Werwolf, der sich auf der Flucht vor Rache in Wäldern versteckte. Die eigenmächtige Tötung des Friedlosen war daher Recht, denn der Täter hatte sein Recht schon zuvor verspielt. Fehde, Selbsthilfe und Blutrache ließen sich auf diese Weise in eine umfassende Friedensordnung einfügen und erschienen als rechtlich anerkannte, feste außergerichtliche Verfahrensformen. Das Ergebnis lag auf der Hand. Nicht blanke, nackte Gewalt beherrschte solche Auseinandersetzungen. Vielmehr hatte man es mit einer vollständigen Rechtsordnung zu tun, die verschiedene Formen der Rechtsdurchsetzung bereitstellte. Der Rächer wuchs auf diese Weise in die Rolle des staatlichen Vollstreckers hinein. Seine Familie, romantisch Sippe genannt, übernahm als Keimzelle des germanischen Staates quasi öffentlich-rechtliche Funktionen, um den Frieden zu wahren und wiederherzustellen. Doch dann entdeckte man seit etwa 1960, wie brüchig derartige Ergebnisse waren. Die nordischen Quellen entpuppten sich als deutlich christlich geprägt und stellten kaum Beispiele für ein reines, von „welschem Tand“ unbeeinflusstes germanisches Rechtsgefühl dar. Und die zentraleuropäischen Rechtsaufzeichnungen seit der Völkerwanderung, allesamt auf Latein überliefert, zeigen durchaus Spuren der Begegnung mit dem Römischen Reich und seinem Recht. Die Lehre eines gemeingermanischen Rechts vermag damit nicht zu überzeugen. Die gemeingermanische Friedlosigkeit hat es nie gegeben. Nicht die theoretische Konzeption ist falsch, sondern die Durchführung steht vor unüberwindbaren Schwierigkeiten. Vermutlich herrscht hier inzwischen indes zu viel Skepsis. Das hohe Ansehen der modernen Rechtsvergleichung und der europäische Blick auf die Rechtsgeschichte scheuen vor diesen ältesten Schichten zurück. Vielleicht hat die neuere Forschung mehr zerstört, als nötig gewesen wäre. Wir wissen es nicht.
2.1.2 Rechtsethnologie
Die zweite Möglichkeit, sich den Frühformen des Rechts zu nähern, besteht darin, an die Erkenntnisse der Ethnologie anzuknüpfen. Europäische und amerikanische Ethnologen besuchten seit dem frühen 20. Jahrhundert Eingeborenenstämme und Naturvölker in Afrika und Asien. In früherer Zeit waren es Entdecker und Abenteurer, die ganz ähnliche Erscheinungen beobachteten. Sie sahen, wie Streitigkeiten, die man im modernen Staat als rechtliche Auseinandersetzungen ansieht, dort bewältigt wurden. So brauste oftmals nach einer Tat, die unter den Stammesangehörigen als Unrecht oder Schande angesehen wurde, Gewalt auf, entlud sich nicht nur gegen den Täter, sondern auch gegen seine Verwandten und Freunde. Nach kurzer Zeit setzten Gespräche und Verhandlungen zwischen der Familie des Täters und des Opfers ein. Häufig gelang eine Aussöhnung. Der Täter, falls er nicht zuvor getötet worden war, konnte in die Gemeinschaft zurückkehren, aus der man ihn zunächst vertrieben hatte. Solche Konfliktlösungen sind aus sog. akephalen Kulturen überliefert, kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern ohne festes Oberhaupt. In segmentären Gesellschaften, zumeist bei Ackerbauern und Viehzüchtern, stießen die Ethnologen regelmäßig auf Älteste und auf Sprecher einzelner Familien. Gab es Streit, trafen sich die Sprecher mit den Ältesten zu Verhandlungen. Häufig gelangten sie zu Kompromissvorschlägen, die für alle Seiten annehmbar waren. Der gestörte Frieden war so wiederhergestellt.
Hat man es hier mit Gerichtsverhandlungen und Urteilen zu tun? Gab es Regeln, welche Sprecher und Älteste an derartigen Verhandlungen teilnehmen mussten und wie solche Sitzungen abliefen? Wie kam man zu dem Entscheidungsvorschlag? Die Befunde der Rechtsethnologie ermöglichen in der Tat faszinierende Einblicke in vorstaatliche menschliche Gesellschaften. Die Tücken liegen anderswo. Gerade die älteren Ethnologen kannten die seinerzeitigen Lehren der Rechtsgeschichte in- und auswendig. Mit ihrem Rüstzeug stießen sie auf genau das, was sie suchten. Hier sind Verzerrungen möglich, wenn auch schwer beweisbar. Die neuere Rechtsethnologie hat sich aus dieser Vorprägung weitgehend gelöst. Doch sie trifft nicht mehr auf die von westlicher Kultur unbeeinflussten angeblichen Wilden. Vielmehr geht es stets um das Nebeneinander einheimischer (indigener) Überlieferung und moderner westlicher Überformung. Dann aber sagen die Ergebnisse solcher Feldforschungen über ein angebliches Urrecht nicht mehr viel aus. Dennoch bieten die ethnologischen Befunde reiches Anschauungsmaterial. Bei unbefangener Sicht zeigen sie Streit und Konfliktlösungen ohne feste Institutionen und ohne schriftlich niedergelegte Regeln. Ob das, was wir Recht nennen, auch in Mitteleuropa in vorschriftlicher Zeit so ablief, kann man nicht wissen. Aber dass es derartige Mechanismen anderswo gab oder noch gibt, erweitert die Sicht, wenn es darum geht, Besonderes und Allgemeines zu erkennen. Doch die Umrisse eines allgemein-menschlichen ursprünglichen Rechts bleiben auf jeden Fall verschwommen. Mehr als wenige, sehr allgemeine Lehren lassen sich wohl kaum formulieren.
2.1.3 Rechtsarchäologie
Der dritte Ansatz, einen Blick in die Zeit vor der Schrift zu werfen, geht ganz handfest vor und baut auf archäologischen Forschungen auf. Die zahlreichen Funde der Ur- und Frühgeschichte passen vielfach sehr stimmig zur spärlichen und oftmals späteren schriftlichen Überlieferung. Im Idealfall lassen sich auf diese Weise Bodendenkmäler und andere Ausgrabungsgegenstände interpretieren und gleichzeitig der Wahrheitsgehalt schriftlicher Überlieferung bestätigen. Schlagendes Beispiel ist etwa der berühmte Suebenknoten. Der römische Historiker Tacitus berichtete von Stämmen im Norden Germaniens, in denen die Männer ihre Haare als geflochtenen Seitenknoten trugen. Findet man in Norddeutschland nun Moorleichen mit genau dieser Frisur, fällt die Einordnung leicht. Doch Vorsicht ist geboten, wie gerade die berühmteste deutsche Moorleiche zeigt. 1952 stieß man im Windebyer Moor bei Eckernförde auf die komplett erhaltene Leiche eines jugendlich verstorbenen Menschen. Das Mädchen von Windeby, wie sie bald darauf hieß, war am Kopf kahlgeschoren, eine Binde lag über ihren Augen. Die Finger der rechten Hand bildeten eine obszöne Geste, der Daumen war zwischen Mittelfinger und Ringfinger hindurchgesteckt – eine Anspielung auf Geschlechtsverkehr? Über der Moorleiche befand sich ein zerbrochener Stab. Die Deutung lag schnell auf der Hand. Vermutlich hatte man es mit einer Ehebrecherin zu tun. Die Handhaltung zeigte ihre Verbrechen noch über die Jahrtausende an. Die germanische Gerichtsgemeinde hatte sie zum Tode verurteilt, der Vollstrecker ihr vor der Versenkung im Moor die Augen verbunden. Ganz symbolisch hatte der Richter oder ein Priester seinen Stab über ihr zerbrochen. Nur wenige Meter neben dem Mädchen war man auf eine männliche Moorleiche gestoßen, offenbar auf den Liebhaber, der ebenfalls die Todesstrafe erlitten hatte. Diese Sichtweise, von Herbert Jankuhn und anderen verbreitet, erwies sich jedoch als unrichtig. Die männliche Moorleiche neben dem Mädchen von Windeby ruhte schon mehrere hundert Jahre im Moor, bevor die angebliche Ehebrecherin dort versenkt wurde. Dann entdeckte man, dass die Menschen in der Eisenzeit mit 15 Jahren zumeist noch gar nicht geschlechtsreif waren. Sexuelle Ausschweifungen als todeswürdiges Verbrechen schieden damit aus. Vielmehr deuteten Wachstumsstörungen in den Kniegelenken auf Mangelernährung und Hunger hin. Vermutlich war das Kind verhungert. Die lederne Augenbinde mag nichts als ein Haarband gewesen sein, das durch Bewegungen des Moores verruscht war. Und die Haare könnten sich schlicht im Moorwasser aufgelöst haben. Schließlich stellte die kanadische Anthropologin Heather Gill-Robinson eine kleine Sensation fest: Die Moorleiche von Windeby war ein Junge. Damit brach die rechtsarchäologische Deutung des Moorfundes sang- und klanglos in sich zusammen. Über Recht, Gericht und Urteilsvollstreckung in diesem Fall wissen wir gar nichts. Vorsicht ist also angebracht, auch wenn es Moorleichen wie den berühmten Mann von Tollund aus dem dänischen Museum Silkeborg gibt, die eindeutige Hinrichtungsspuren zeigen. Aber ob es sich um Opferungen oder Bestrafungen handelt, lässt sich nicht klären. klären. Selbst der oben erwähnte Suebenkopf von Osterby gibt Rätsel auf. Der Unterkiefer wurde offenbar vor Jahrzehnten zu Dekorationszwecken von Museumsmitarbeitern hinzugefügt und gehört in Wirklichkeit zu einer anderen Leiche. Mit der Überinterpretation ur- und frühgeschichtlicher Fundstücke begibt man sich also auf schwieriges Gelände. Im Umkehrschluss unterstreichen solche Beispiele, in welch außerordentlichem Maße auch die Rechtsgeschichte der Frühzeit auf schriftliche Quellen angewiesen bleibt.
2.1.4 Der Rechtsbegriff als Problem der Rechtsgeschichte
In gebotener Kürze ist auf ein weiteres Problem hinzuweisen. Der Begriff des Rechts ist gerade für die älteste Zeit bis weit ins Mittelalter hinein unsicher und streitig. Die altbekannte Diskussion, ob Geschichtsschreibung mit zeitgenössischen Wörtern oder mit modernen Forschungsbegriffen arbeiten sollte, um die Vergangenheit angemessen zu erfassen, spitzt sich hier in besonderer Weise zu. Ganze Bücher und Vortragsreihen gibt es inzwischen zum Rechtsbegriff des Mittelalters. Dieser Streit verliert bei einem problemgeschichtlichen Ansatz erheblich an Bedeutung. Es geht nicht darum, wie die Zeitgenossen etwas genannt haben, mögen in den Texten auch Begriffe wie Recht, ius oder lex auftauchen. Vielmehr kommt es darauf an, ob die Quellen eine Ordnung des menschlichen Zusammenlebens mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit zeigen. Nach soziologischer Sichtweise lässt sich nur dann von Recht im modernen Sinne sprechen. Bei dieser engen Definition mag es lange Zeit kein Recht gegeben haben. In einer auf Konsens aufbauenden Gemeinschaft fehlt es aber schlechthin an der Erzwingbarkeit normativer Vorstellungen. Damit muss die Rechtsgeschichte leben. Dennoch bewahren die Quellen Berichte über Streitlösungsverfahren, die möglicherweise dasjenige ersetzten, was wir heute Recht nennen. Das genügt. Die in der Rechtsgeschichte verbreiteten Abwehrreflexe, die eine wie auch immer geartete Rechtsordnung ins Frühmittelalter hinein zurückverlängern, ebnen leichthin die erheblichen kulturellen Fortschritte ein, die mit der Herausbildung eines eigenen ausdifferenzierten Rechts- und Gerichtswesens verbunden waren.
2.2 Selbsthilfe und Streitschlichtung bei den germanischen Stämmen
Die ältesten schriftlichen Quellen über das einheimische Recht stammen von Römern und sind in lateinischer Sprache überliefert. Es handelt sich um mittelbare Rechtsquellen, um kurze Einsprengsel in der antiken Literatur. Besonders bekannt und umstritten ist die „Germania“ des römischen Historikers Tacitus (98 n. Chr.). Auf knapp 30 Seiten schildert der Römer, der selbst nie nördlich der Alpen war, angebliche Sitten und Gebräuche der Stammesvölker, die dort leben sollten. Dabei hielt das Beispiel eines unverbrauchten Naturvolkes den verlotterten Weichlingen des römischen Imperiums den Spiegel ihrer eigenen dekadenten Verkommenheit vor. Tacitus war also alles andere als ein unvoreingenommener Beobachter. Vor allem lehnte er sich mehrfach an Versatzstücke anderer antiker Autoren an, die ihrerseits verschiedenste Völkerschaften außerhalb des Mittelmeerraumes beschrieben hatten. Dennoch erlangte seine kleine Schrift, nachdem sie erst im 15. Jahrhundert wiederentdeckt worden war, schlagartige Berühmtheit. Die Diskussion um eine germanische Rechtsgeschichte kreist seitdem um wenige Sätze. Für die Fragen von Rechtsdurchsetzung, Gericht und Verfahren sind es vor allem zwei Stellen, die immer wieder hin- und hergewendet werden.
Fehde und Sühne bei den Germanen
Kap. 21. Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est; nec implacabiles durant; luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero recipitque satisfactionem universa domus, utiliter in publicum, quia periculosiores sunt inimicitiae iuxta libertatem.
Aufzunehmen auch die Feindschaften des Vaters oder der Verwandten sowie Freundschaften ist notwendig; sie dauern aber nicht unversöhnlich an: gesühnt wird nämlich sogar ein Totschlag mit einer bestimmten Anzahl von Rindern oder Kleinvieh; und das ganze Haus nimmt die Genugtuung an, zum Nutzen für die Öffentlichkeit, weil Feindschaften in Verbindung mit Freiheit gefährlicher sind.
Vorlage: Tacitus, Germania, Kap. 21,1, in: Erich Köstermann (Hrsg.), P. Cornelii Taciti libri qui super-sunt, tom. II fasc. 2: Germania, Agricola, Dialogus de oratoribus, Leipzig 1964, S. 17; ebenfalls in: Joachim Herrmann/Gerhard Perl (Hrsg.), Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1. Jahrtausends u. Z. – Zweiter Teil: Tacitus, Germania (Schriften und Quellen der Alten Welt 37/2), Berlin 1990, S. 100–101 (dort auch abweichende Übersetzung); die vorliegende Übersetzung nach Sellert/Rüping (Lit. zu 1.), Bd. 1, S. 53. Leicht zugänglich ist die zweisprachige Ausgabe von Hans-Werner Goetz/Karl-Wilhelm Welwei (Hrsg.), Altes Germanien (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters Ia), Darmstadt 1995, S. 126–167.
Tacitus schildert an dieser Stelle, offenbar eng angelehnt an Plinius den Älteren, inimicitiae, also Feindschaften. Warum es derartige Feindschaften gab, bleibt offen, ein Hinweis auf Rechtsstreitigkeiten fehlt. Aber eingebunden sind nicht nur zwei verfeindete Personen, sondern auch die Verwandten und Freunde. Für sie soll die Beteiligung an solchen Feindschaften notwendig gewesen sein. Die Feindschaft zweier oder mehrerer Familienverbände bezeichnet die rechtshistorische Tradition als Fehde. Fehde ist damit ein Zustand, ausgelöst durch eine Tat wie den von Tacitus beispielhaft genannten Totschlag. Doch schwankt die Terminologie. Vielfach bezeichnet Fehde auch die einzelnen Selbsthilfe- und Rachehandlungen, zu denen es im Verlaufe einer solchen Feindschaft kommen mochte. Den Totschlag konnte man freilich durch die Zahlung von Vieh sühnen und auf diese Weise die Feindschaft beilegen. Das Vieh steht für eine materielle Ersatzleistung, denn Geld kannten die germanischen Stämme kaum. Selbst das römische Wort pecunia stammt von pecus