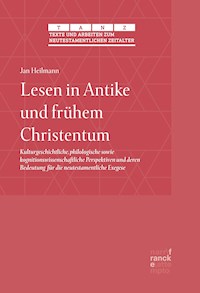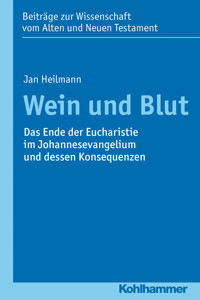
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Studie untersucht die Bedeutung von Wein und Blut im Johannesevangelium und deren relationales Verhältnis. Sie hinterfragt dabei die bisherigen Forschungspositionen. Neuere Ergebnisse der ritual- und sozialgeschichtlichen Forschung zur frühchristlichen Mahlpraxis verändern die Perspektive auf traditionell als "Abendmahlstexte" wahrgenommene Perikopen. Zugleich sind damit aber auch zentrale Fragen der Theologie des Johannesevangeliums mit im Blick. Auch hier bietet die Studie neue Impulse. Der Text des Johannesevangeliums war in seiner Rezeption ritualprägend und eben nicht umgekehrt durch ein angenommenes Eucharistieritual vorgeprägt. Die Metaphorik des Essens und Trinkens für die Annahme von Lehre, die bisher von der "eucharistischen" Diskussion verdeckt war, erlaubt einen neuen Blick auf die ritualgeschichtliche Entwicklung und Theologie des Abendmahls. Die Arbeit wurde mit dem Philipp-Matthäus-Hahn-Preis sowie dem Preis der Armin Schmitt Stiftung für biblische Textforschung für das Jahr 2015 ausgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1066
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament Elfte Folge
Herausgegeben von
Walter Dietrich
Ruth Scoralick
Reinhard von Bendemann
Marlis Gielen
Heft 4 · Der ganzen Sammlung Heft 204
Jan Heilmann
Wein und Blut
Das Ende der Eucharistie im Johannesevangelium und dessen Konsequenzen
Verlag W. Kohlhammer
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
der Georg Strecker-Stiftung
und der Evangelischen Kirche in Deutschland.
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Satz: Jan Heilmann
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-025181-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-025182-3
epub: ISBN 978-3-17-025183-0
mobi: ISBN 978-3-17-025184-7
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich.
Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
In Erinnerung anWilli Labenc(1913–2004)meiner Familie
Inhaltsverzeichnis
I
NHALTSVERZEICHNIS
V
ORWORT
1 H
INFÜHRUNG
1.1 Die Frage nach
der
‚Eucharistie‘ im JohEv vor dem Hintergrund der Forschungsgeschichte zu den frühchristlichen Mählern
1.1.1 Die Frage nach der ‚Eucharistie‘ im JohEv
1.1.2 Herausforderungen für die Johannesexegese: Neuere forschungsgeschichtliche Tendenzen zu Gemeinschaftsmählern im frühen Christentum
1.2 Konsequenzen für die Interpretation des JohEv und exegetische Fragestellung
1.3 Hermeneutische und methodologische Reflexion
1.4 Vorgehen der Untersuchung und Begründung der Textauswahl
2 D
IE SEMANTISCHE
F
ÜLLE DER
W
EINMOTIVIK IN DER ANTIKEN
K
ULTUR
2.1 Sozialgeschichtliche Vorbemerkungen
2.2 Ausgewählte Beobachtungen zum Alten Testament
2.2.1 Überblick
2.2.2 Wein, Blut und die Rauschmetaphorik
2.2.3 Dimensionen des alttestamentlichen Gebrauchs der Bildfelder von Wein und Weinstock
2.2.4 Das Bildfeld des Weines, die Bundesmotivik und das Bundesschlussritual am Sinai
2.2.5 Zwischenfazit
2.3 Ausgewählte Beobachtungen zum hellenistischen Kulturraum mit einem besonderen Blick auf den Dionysoskult
2.3.1 Überblick
2.3.2 Symposion und Gemeinschaft
2.3.3 Cafeteria (Gewerbe)-Pachtvertrag
2.3.4 Zur Identifikation von Wein mit Dionysos
2.3.5 Zu der Annahme einer weit verbreiteten Gleichsetzung bzw. engen Verknüpfung von Wein und Blut in der Antike
2.3.6 Wein und Dionysos als Epiphaniegott
2.3.7 Zusammenfassung und Zwischenfazit
2.4 Einblicke in die Semantik der Weinmotivik im Neuen Testament
2.4.1 Überblick
2.4.2 Der Wein und das Reich Gottes – eschatologische Dimension des Weines in der Erzählung vom letzten Abendmahl
2.4.3 Das sog. ‚Becherwort‘ in der markinischen und matthäischen Fassung der Erzählung vom letzten Mahl
2.4.4 Das ‚Becherwort‘ in der lukanischen Fassung der Erzählung vom letzten Mahl und die paulinische Fassung
2.4.5 Zusammenfassung und Zwischenbilanz
3 E
XEGETISCHE
U
NTERSUCHUNG DER
M
OTIVIK VON
W
EIN UND
B
LUT
3.1 Das Weinwunder auf der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1–11)
3.1.1 Übersetzung und Beobachtungen am Text
3.1.2 Der Wein als (Sühne)Blut?
3.1.2.1 Verweise auf Jesu Tod
3.1.2.2 Voraussetzungen der Deutung des Weines auf das Blut Jesu und die Kontroverse um die Deutung des Todes Jesu
3.1.2.3 Die Identifikation Jesu als Lamm und deren Funktion
3.1.2.4 Zwischenfazit
3.1.3 Der Wein als Ausweis von Jesu Messianität und der von ihm geschenkten Fülle und Freude
3.1.4 Die Funktion der dionysischen Allusionen
3.1.4.1 Der dionysische Hintergrund des Weinwunders: Abhängigkeit, Konkurrenz oder Inkulturationsstrategie?
3.1.4.2 Das Weinwunder als anschauliches Zeichen der Inkarnation, formuliert mit Kategorien aus der hellenistischen Welt
3.1.5 Das Weinwunder als Veranschaulichung der Inkarnation im Kontext der Weinfülle der messianischen Zeit und der Feier zur Begründung der
familia dei
3.1.6 Zusammenfassung und Zwischenbilanz
3.2 Das Motiv des Trinkens von Jesu Blut in Joh 6
3.2.1 Übersetzung und Beobachtungen am Text
3.2.2 Das Problem der ‚eucharistischen‘ Deutung
3.2.2.1 Literarkritisch argumentierende ‚eucharistische‘ Auslegungsansätze
3.2.2.2 Synchron orientierte ‚eucharistische‘ Deutungsansätze
3.2.2.3 Problematische Implikationen der ‚eucharistischen‘ Deutungsansätze
3.2.3 Der Brotdiskurs als kreative Bearbeitung der markinischen Vorlage – das
eine
Brot und das Nicht-Verstehen
3.2.4 Die Bedeutung von „Fleisch essen/kauen“ und „Blut trinken“ innerhalb des relationalen Metaphernfeldes in Joh 6
3.2.4.1 E
SSEN
/T
RINKEN IST
A
NNAHME VON
L
EHRE
bzw. W
EISHEIT
als konzeptuelle Metapher
3.2.4.2 Die Bedeutung von „Fleisch essen/kauen“ und „Blut trinken“ im Rahmen der in Joh 6 entfalteten Metaphorik
3.2.4.3 Brot, Fleisch und Blut in den Ignatianen
3.2.4.4 Ausblick auf die Übernahme der Metapher des „Bluttrinkens“ in den Mahldiskurs
3.2.5 Missverstehen und ‚Scheidung‘ der Jünger als Schritt zur Konstitution der Gemeinschaft des ZwÖlferkreises
3.2.6 Zusammenfassung und Zwischenbilanz
3.3 Der wahre Weinstock in Joh 15
3.3.1 Übersetzung und Beobachtungen am Text
3.3.2 Der wahre Weinstock vor dem alttestamentlichen Bildhintergrund
3.3.3 Die Abschiedsrede als Symposiengespräch
3.3.4 Relevante Implikationen des Symposienkontextes der Abschiedsrede für die Interpretation der Bildrede
3.3.4.1 Das Motiv des Fruchttragens als Klammer zwischen Joh 12,24 und 15,1 ff
3.3.4.2 Joh 15,1–17 und die Erzählung von der Fußwaschung
3.3.4.3 Die Freundschaftskategorie als weiterführende Erläuterung der im Weinstockbild repräsentierten Liebesgemeinschaft
3.3.4.4 Tod und Symposion
3.3.5 Fazit und Zwischenbilanz
3.4 Blut und Wasser in der Kreuzigungsszene
3.4.1 Übersetzung und Beobachtungen am Text
3.4.2 Defizite der sakramentalen und antidoketischen Interpretation
3.4.3 Zur Bedeutung von Blut und Wasser in Joh 19,34
3.4.4 Fazit
4 E
RGEBNIS UND WEITERFÜHRENDE
S
CHLUSSFOLGERUNGEN
4.1 Abschließende Bestimmung des Verhältnisses von Wein und Blut im JohEv zum Mahlritual
4.2 Schlussfolgerungen aus dem gewonnenen Verständnis der Motivik von Wein und von Blut im Hinblick auf die johanneische Theologie
4.3 Ausblick auf mÖgliche Impulse für die theologische Diskussion um das Abendmahl
5 A
BKÜRZUNGSVERZEICHNIS
6 Q
UELLEN UND
H
ILFSMITTEL
6.1 WÖrterbücher, Lexika und weitere Hilfsmittel
6.2 Philologische Hilfsmittel
6.3 Konkordanzen und elektronische Hilfsmittel
6.4 Epigraphische und papyrologische Hilfsmittel
6.5 Quellen
6.5.1 Biblische Texte
6.5.2 Editionen und Synopsen
6.5.3 Übersetzungen
6.5.4 Literarische Quellen
6.5.4.1 Quellensammlungen
6.5.4.2 Rabbinische Texte
6.5.4.3 Qumran
6.5.4.4 Griechische und lateinische Einzeltexte
6.5.5 Papyri
6.5.6 Inschriften
6.5.7 Münzen
6.5.8 Bildquellen und archäologische Zeugnisse
7 V
ERZEICHNIS DER ZITIERTEN
F
ORSCHUNGSLITERATUR
8 R
EGISTER
8.1 Sachen und wichtige Personen
8.2 Wichtige griechische Begriffe
8.3 Bibelstellen
8.3.1 AT, sog. Apokryphen und Pseudepigraphen
8.3.2 NT, sog. Apokryphen, Pseudepigraphen und Apostolische Väter
8.4 Literarische Quellen
8.4.1 Rabbinische Texte
8.4.2 Qumran
8.4.3 Griechische und lateinische Texte
8.5 Papyri
8.6 Inschriften
8.7 Bildquellen und archäologische Zeugnisse
Vorwort
Die vorliegende Studie wurde im Sommersemester 2013 von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertationsschrift angenommen und ist für die Drucklegung geringfügig überarbeitet und um neuere Literatur ergänzt worden. Zahlreiche Menschen und Institutionen sind an der Realisierung dieses Forschungsvorhabens beteiligt gewesen. Stellvertretend seien die folgenden besonders hervorgehoben: Zuallererst möchte ich mich bei den Lehrenden der Evangelisch-Theologischen Fakultät, aber auch des Historischen Instituts für die sehr gute wissenschaftliche Ausbildung bedanken, die mir in meiner Zeit in Bochum zuteil geworden ist. Den größten Anteil am Gelingen des Promotionsprojektes hat mein Doktorvater Prof. Dr. Peter Wick, dem ich für die unzähligen Gespräche, Impulse und vor allem für seine – und das muss ich als Kind des Ruhrgebiets hervorheben – bodenständig-herzliche wissenschaftliche Förderung nicht dankbar genug sein kann. Seine Art, neutestamentliche Exegese mit vollem persönlichen Einsatz und großem Enthusiasmus zu betreiben, bot mir ein hervorragendes Umfeld für die freie und kreative Entfaltung exegetischer Ideen sowie neuer und zum Teil auch ungewohnter Sichtweisen auf die Texte des Neuen Testaments. Herrn Prof. Dr. Reinhard v. Bendemann möchte ich ebenfalls für seine Förderung sowie für die Übernahme des Zweitgutachtens ganz herzlich danken. Außerdem seien ihm und Prof. Dr. Marlis Gielen für die unbürokratische Aufnahme in die Reihe BWANT gedankt. Auf meinem Weg der Themenfindung begleitet hat mich aber auch Prof. Dr. Isolde Karle, der ich ebenfalls sehr dankbar für ihre wissenschaftliche Förderung in meiner Zeit als studentische Hilfskraft bei ihr bin. Maßgebliche Beteiligung an dem Gelingen dieser Studie haben Prof. Dr. Christina Hoegen-Rohls, die mich während meiner Zeit an der Fakultät in Münster intensiv betreut hat, und Prof. Dr. Matthias Klinghardt, der mich vor allem im Blick auf zahlreiche Fragen zum Thema „Mahl“ umfangreich beraten und unterstützt hat. Ihnen möchte ich an dieser Stelle auch herzlich danken.
Diese Studie wäre nicht möglich gewesen ohne die ideelle und finanzielle Förderung durch das Käte-Hamburger Kolleg „Dynamics in the History of Religions“ an der Ruhr-Universität Bochum, in dem ich für gut drei Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wirken durfte. Stellvertretend für die Vielzahl von Begegnungen mit Fellows und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Arbeitsgruppen, Tagungen und Konferenzen danke ich dem Direktor Prof. Volkhardt Krech sowie Prof. Dr. Christian Frevel, Prof. Dr. Jörg Plassen, Dr. Marion Steinicke sowie den Gastwissenschaftlern Prof. Dr. Angelos Chaniotis und Prof. Dr. Dr. Christoph Auffarth.
Danken möchte ich ferner Prof. Dr. Angela Standhartinger und Dr. Soham Al-Suadi für den wissenschaftlichen Austausch über das Thema „Mahl“ sowie Prof. Dr. Daniel R. Schwartz, der mich 2010 bei einem Israelaufenthalt ausführlich zu meinem Dissertationsprojekt beraten hat. Ich danke außerdem allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des III. Colloquium Iohanneum, v. a. Prof. Dr. Uta Poplutz, Friederike Kunath und Prof. Dr. Jörg Frey, für die zahlreichen Anregungen, die ich noch in die Druckfassung aufnehmen konnte. Von unschätzbarem Wert sind mir aber vor allem die vielen Gespräche und Diskussionen mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Bochum, Dr. Volker Rabens, Dr. Jens-Christian Maschmeier, Dr. Burkhard Reis, Dr. Meret Strothmann und Johanna Nuhn, in Münster, Michael Schreiter, Lars Maskow, Juliane Ta Van und Stefan Zorn, und in Dresden, Nathanael Lüke, Adriana Zimmermann, Daniel Pauling, Fabian Knopf und Oliver John, denen allen ich nicht zuletzt für ihre Hilfsbereitschaft sehr dankbar bin. Dank schulde ich auch Bahar Oeztamur sowie den Studentischen Hilfkräften Dennis Surau und Daniel Klinkmann, die mir genauso wie die Angestellten in der Theologischen Bibliothek der Ruhr-Universität Bochum vielfältig geholfen haben.
Der Druck der Studie ist dankenswerterweise großzügig von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Georg Strecker-Stiftung und der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt worden. Für die hervorragende Betreuung und Hilfe bei der Erstellung der Reproduktionsvorlage danke ich Florian Specker vom Kohlhammer Verlag. Um diverse Korrekturdurchläufe haben sich Manuela Schwind, Pfr. Dr. Jürgen Schwark, Fridolin Wegscheider und Moritz Schäfer verdient gemacht. Danken möchte ich auch Matthias Braun, der als Freund und Systematiker mit scharfem theologischem Sachverstand stets ein unverzichtbares kritisches Korrektiv für meine exegetische Arbeit darstellte.
Das Buch ist meiner Familie gewidmet, für deren Hilfe und Unterstützung während des Studiums und der Promotionszeit ich zutiefst dankbar bin: meinem Vater, Pfr. Bernd Schäfer, meiner Mutter, Doris Schäfer, die einen besonderen Dank verdient, da sie vermutlich sämtliche schriftliche Arbeiten von mir gründlich Korrektur gelesen hat, meiner Schwester, Lena Schäfer, und zuletzt meiner wundervollen Frau, Claudia, die mich in vielerlei Hinsicht auf meinem wissenschaftlichen Weg unterstützt hat und der ein maßgeblicher Anteil am Gelingen dieser Studie zukommt.
Dresden, im März 2014
Jan Heilmann
1 Hinführung1
Das relationale Verhältnis von Wein und Blut ist v. a. im Hinblick auf das Abendmahlsritual ein zentraler Kristallisationspunkt theologischer Debatten seit der frühen Neuzeit. In der Exegese ist die Erforschung der Motivik von Wein und Blut untrennbar verknüpft mit der Frage nach dem Abendmahl bzw. der Eucharistie im frühen Christentum und in den neutestamentlichen Texten. Dabei ist zu erkennen, dass die meisten Forschungsbeiträge mit einer modellhaften Vorstellung der außersprachlichen Referenz der Begriffe ‚Abendmahl‘/‚Eucharistie‘ operieren, die m. E. problematisch ist. Die zahlreichen Fragekomplexe, die in der Johannesexegese mit der Frage nach dem ‚Abendmahl‘/der ‚Eucharistie‘ bzw. den ‚Sakramenten‘ im JohEv verbunden sind, haben im vergangenen Jh. zu zahlreichen Kontroversen und zu einer nicht mehr überschaubaren Menge an Forschungsliteratur geführt. Die Komplexität wird dadurch erhöht, dass im Rahmen der Problemstellung auch die Forschung zu den frühchristlichen Mählern, deren Form, Deutung und Theologie sowie die Forschung zur antiken Mahlkultur zu berücksichtigen sind. Daneben erschweren unterschiedliche methodische, hermeneutische und theoretische Zugänge zu den neutestamentlichen Texten die Darstellung eines möglichst einfach strukturierten Forschungsüberblicks.
Das Ziel dieser Studie liegt in der Neubestimmung des relationalen Verhältnisses von Wein und Blut im JohEv, die v. a. durch neuere Erkenntnisse in der ritual-und sozialgeschichtlichen Forschung zu den frühchristlichen Mählern notwendig geworden ist. D. h., dass die Bedeutung von Wein und Blut innerhalb ausgewählter Perikopen zu untersuchen ist und auf der Grundlage dieser Ergebnisse zu fragen sein wird, welche Topoi der Theologie des JohEv mit Wein und Blut verbunden sind. Im Folgenden sind zunächst Linien und Argumentationsmuster, aber auch blinde Flecken im Forschungsdiskurs aufzuzeigen, um die exegetische Fragestellung präzise formulieren zu können und in den Diskurs einzuordnen. Dabei ist die Komplexität der bisherigen Forschung notwendigerweise zu reduzieren. Der Dialog mit der Forschung zu den im Einzelnen zu behandelnden Bibelstellen bzw. zu weiteren Einzelfragen wird in den jeweils relevanten Kapiteln und Abschnitten geführt. Aber auch hier wäre angesichts der Fülle an Forschungsliteratur und Forschungsdiskursen ein Anspruch auf Vollständigkeit nicht einlösbar.
1.1 Die Frage nach der ‚Eucharistie‘ im JohEv vor dem Hintergrund der Forschungsgeschichte zu den frühchristlichen Mählern
1.1.1 Die Frage nach der ‚Eucharistie‘im JohEv
Die johanneische Motivik von Wein und Blut wird üblicherweise mit Bezug auf das ‚Abendmahl‘ bzw. die ‚Eucharistie‘ im JohEv bzw. in der sog. johanneischen Gemeinde untersucht. Ausgangspunkt ist dabei zumeist die Beobachtung, dass im JohEv der sog. ‚Einsetzungs- oder Stiftungsbericht‘ Jesu fehle – bzw. dass der Evangelist diesen verschweige – und dass an dieser Stelle die Fußwaschungserzählung stehe. Viele Exegeten sehen in diesen Unterschieden zu den Synoptikern einen wichtigen Schlüssel für die Beantwortung der Frage nach der ‚Eucharistie‘/dem ‚Abendmahl‘ im JohEv. Die verschiedenen Erklärungsmodelle für diese Besonderheit, die in der Forschung gegeben werden,2 beeinflussen wiederum die Interpretation der Motivik von Wein und Blut.
Die Forschungsgeschichte, die von D. C. Bienert in seiner Dissertation sehr detailliert und ausführlich dargestellt wird,3 weist insgesamt das Spektrum von einer ‚antisakramentalen‘ und ‚asakramentalen‘ bis hin zu einer ‚betont sakramentalen‘ Auslegung des JohEv auf.4 In dieses Spektrum kann man bis heute die verschiedenen Forschungspositionen einordnen, wenn auch die Tendenz zu einer ‚betont sakramentalen‘ Auslegung im Sinne der 1950er Jahre, wie sie etwa bei O. Cullmann5, B. Vawter6 und W. Wilkens7 zu finden ist, nicht mehr vertreten wird.
Besonders einflussreich in der Forschungsgeschichte ist die Position R. Bultmanns, die er in seinem Johanneskommentar von 1941 dargelegt hat und die der ‚antisakramentalen‘ und ‚asakramentalen‘ Deutung des Evangeliums zuzuordnen ist. Nach R. Bultmann sei die Stellung des Johannes zu den ‚Sakramenten‘ problematisch, wobei das „Herrenmahl […] von ihm überhaupt nicht genannt“8 werde. In der Darstellung Jesu spiele das Herrenmahl keine Rolle, was R. Bultmann damit erklärt, „daß sich der Evglist [sic!] mit dem kirchlichen Brauch von Taufe und Herrenmahl zwar abfindet, daß dieser ihm aber infolge des Mißbrauchs verdächtig bleibt, und daß er deshalb davon schweigt. In Wahrheit sind für ihn die Sakramente überflüssig.“9 R. Bultmanns Verständnis erwächst aus seiner Auffassung über die Theologie des JohEv: „Der Tatsache, daß bei Johannes die ‚Heilstatsachen‘ im traditionellen Sinn keine Rolle spielen, und daß das ganze Heilsgeschehen: Menschwerdung, Tod und Auferstehung Jesu, Pfingsten und die Parusie, in das Geschehen verlegt ist: die Offenbarung der άλήθεια Gottes im irdischen Wirken des Menschen Jesus und die Überwindung des Anstoßes im Glauben – dieser Tatsache entspricht es, daß auch die Sakramente keine Rolle spielen.“10 Insgesamt stehe der Evangelist den ‚Sakramenten‘ aber nicht feindlich gegenüber, wie es auch in der Forschung als Extremposition immer wieder zu finden ist, sondern eher in kritischer oder zurückhaltender Distanz.11 R. Bultmann sieht aber einige Stellen im JohEv, die auf die ‚Sakramente‘ hin gedeutet werden könnten (Joh 3,5; 6,51b–58; 19,34b–35). Innerhalb seines literarkritischen Drei-Schichten-Modells werde diese als kirchliche Interpolation allerdings dem Redaktor zugeschrieben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!