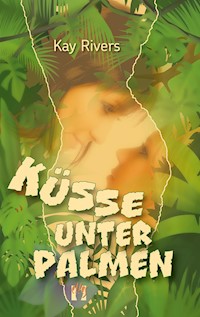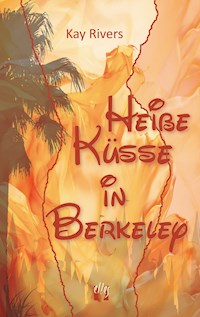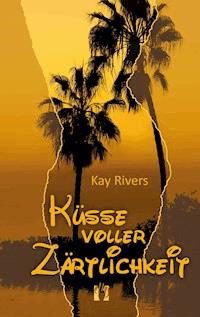8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach ihrer Entlassung aus der Army kommt Sergeant Tyne Monroe einer letzten Pflicht nach: Sie überbringt Shannon Wells, der Witwe eines gefallenen Kameraden, etwas Persönliches von ihm. Und ehe sie es sich versieht, hat sie einen Job bei Shannons Vater in dessen Baufirma und eine Unterkunft in Shannons Haus. Während Tyne sich in der neuen so familiären Umgebung leicht unwohl fühlt, beginnt Shannon, nach ihrer Trauerzeit wieder aufzublühen. Etwas wächst zwischen ihnen, wovor Tyne die Flucht ergreifen will, während Shannon nicht weiß wohin mit ihren neuen Gefühlen. Doch dann holt Tyne ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit ein, und ihr neues Leben scheint vorbei, kaum dass es begonnen hat. Tyne will Shannon beschützen, ohne alles zu offenbaren – doch für Shannon ist es alles oder nichts ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kay Rivers
WENN DAS LEBEN NEU BEGINNT
Roman
© 2025édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-400-2
Coverfoto:
1
Das waren die grünsten Bäume, die sie je gesehen hatte, dachte Tyne Monroe, als sie ohne Eile die Landstraße entlangschritt und zu den dichten Baumkronen hinaufsah.
Vielleicht lag es auch nur daran, dass sie in den letzten Jahren fast ununterbrochen Wüste und Sand um sich gehabt hatte. Da erschien ihr jeder kleinste Grashalm wie ein grünes, lebendiges Wunder.
Obwohl dieser Waldweg ins Nirgendwo zu führen schien, wusste sie, dass schon hinter der nächsten Biegung die Stadt beginnen musste.
Sie hätte bis dahin mit dem Bus fahren können, aber sie war eine Station eher ausgestiegen, um die Strecke zu laufen. Laufen war sie gewöhnt, und sie hatte es vermisst, weil sie gefühlt seit Tagen nur im Flugzeug oder dann im Bus gesessen hatte. Sie wollte ihre Beine wieder spüren.
So berühmt der Staat Oregon auch für seine Wälder war, bevor sie hierherkam, hatte sie nicht gewusst, wie dicht und undurchdringlich diese Wälder wirklich sein konnten. Sogar hier, wo sich eine große Stadt in der Nähe befand. Portland.
Es gab eine sehr befahrene Autostraße dorthin, die auch der Bus genommen hatte, doch die Landstraße, fast nur ein Pfad, auf dem Tyne sich befand, führte direkt durch die Wälder, und Autos schienen sich hier nicht wohlzufühlen.
Im Gegensatz dazu fühlte Tyne sich sehr wohl. Sie liebte die Einsamkeit. Zwar war sie zuvor in ihrem Leben noch nie in Oregon gewesen, aber schon allein deshalb, weil es hier so einsame Stellen gab, mochte sie es sofort.
Einsamkeit war sie seit ihrer Kindheit gewöhnt. Es war wie ein bekanntes kuscheliges Nest, in das sie sich gern legte. Niemals hatte sie nachvollziehen können, warum so viele Leute diesen Zustand so schnell wie möglich beenden wollten, indem sie eine Familie gründeten.
Was war so schlimm daran, allein zu sein? Nur für sich selbst zu sorgen? Und was war so toll an einer Familie?
Die Kameraderie eines Kampfbataillons – das war etwas anderes. Das hatte sie immer geliebt. Obwohl sie auch dort nie nach einer Familie gesucht hatte, war es doch irgendwie zu einer geworden. Aber zu einer, mit der sie umgehen konnte.
Und die sie jederzeit verlassen konnte. Wie jetzt, da ihre Zeit bei der Army vorbei war. Nach zwölf Jahren war sie auf dem Weg nach Hause.
Nach Hause. Wo immer das war. Jedenfalls nicht in Oregon.
Aber sie hatte hier noch etwas zu erledigen.
2
Mit leerem Blick saß Shannon auf der Couch und starrte vor sich hin. Immer noch hatte sie sich nicht von dem Schock erholt. Vielleicht würde sie es nie.
Dabei war es jetzt doch schon . . . wie lange her? Ihre Stirn zog sich zu gerunzelten Falten zusammen. Sie wusste es nicht einmal mehr. Denn seither war ein Tag wie der andere gewesen. Dunkel und grau.
Dass draußen die Sonne schien, war ihr nicht bewusst. Sie wollte es gar nicht wissen.
Dahinten schien auch die Sonne. Immer. Und was hatte es genützt?
Die Tränen waren versiegt, und doch waren ihre Augen ständig gerötet. Als ob sie eine Krankheit hätte, einen Infekt, den sie nicht mehr loswerden könnte.
Der Infekt hieß Schmerz. Trauer. Unbeschreibliche Sehnsucht und Verzweiflung.
Warum hatte es so kommen müssen? Sie waren jung, hatten ein Leben vor sich gehabt. Und jetzt? War dieses Leben vorbei. Für sie genauso wie für –
Es klopfte an der Tür.
Das war bestimmt ihr Vater. Oder ihr Bruder. Ihre Mutter oder eine ihrer Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen . . . Alle sorgten sie sich um sie. Und doch konnten sie ihr nicht helfen.
Wie sollten sie auch?
Sie hatte keine Lust aufzumachen, und doch wusste sie, dass sie es tun musste. Sie würden nicht lockerlassen. Wahrscheinlich gab es wieder einen Topf mit Essen, den sie mitgebracht hatten.
Ihr ganzer Kühlschrank war voll. Denn sie aß nichts. Seit Tagen aß sie nichts. Oder seit Wochen?
Gefühlt schwer wie ein Elefant erhob sie sich vom Sofa und schlurfte zur Tür, als wäre sie hundert Jahre alt.
Als sie die Gestalt, die vor der Tür stand, verschwommen durch das Glas erkennen konnte, erstarrte sie, dann plötzlich begann sie zu zittern.
Das waren nicht ihr Vater oder ihre Mutter. Oder ihre Tanten. Ihre Cousins oder Cousinen. Das war –
Sie riss die Tür auf und fiel der Gestalt in der Uniform um den Hals. »Ken! Ken! Ich wusste, dass es nicht wahr sein konnte! Ich wusste, dass du zurückkommst! Es war alles nur ein Irrtum!«
Jetzt flossen die Tränen wieder, die sie schon versiegt geglaubt hatte.
»Ähm . . .« Die Gestalt räusperte sich. »Mrs. Wells?«
Da plötzlich wurde es Shannon bewusst, dass das nicht Ken war. Das war die Stimme einer Frau. Eine tiefe Stimme, aber eindeutig die einer Frau.
Als hätte sie eine Tarantel gestochen, sprang Shannon zurück. »Wer . . . Wer sind Sie?« Ihre Augen öffneten sich weit. »Als ich die Uniform sah, dachte ich –« Wie ein letztes Tröpfchen Hoffnung versickerte ihre Stimme im Nichts.
»Ich bin Tyne Monroe«, stellte die Frau in der Uniform sich vor. Sie stand so steif da, als befände sie sich auf einem Paradeplatz. »Ken und ich waren in derselben Einheit.«
3
Tyne wusste nicht, wie sie darüber hinaus, was sie bereits gesagt hatte, reagieren sollte. Solche Gefühlsausbrüche waren ihr fremd.
Und dass diese Frau, Kens Ehefrau, sie mit Ken verwechselt hatte und ihr gleich um den Hals gefallen war, machte es nicht besser. Eher im Gegenteil.
Sie trat einen Schritt zurück. »Es tut mir leid, Mrs. Wells«, fuhr sie immer noch fast wie zur Salzsäule erstarrt fort. »Vermutlich störe ich Sie in Ihrer Trauer. Aber Ken hat mich beauftragt –«
»Ken hat Sie beauftragt?«, unterbrach Shannon Wells sie mit weit aufgerissenen Augen und so etwas wie einem spitzen Schrei in der Stimme. »Womit beauftragt?«
»Das wollte ich ja gerade –«
Bevor sie weitersprechen konnte, unterbrach Shannon sie, indem sie auf einmal nach ihrem Arm griff und sie ins Haus zog. »Bitte . . . Bitte erzählen Sie mir, was Ken gesagt hat. Jedes Wort.«
Worauf sie gehofft hatte, wusste Tyne nicht genau, aber insgeheim hatte sie wahrscheinlich erwartet, dass dieser ganze . . . Auftrag sich an der Tür abwickeln ließe.
Schließlich kannte sie Shannon Wells nicht, hatte sie nie getroffen. Nur Ken hatte ihr von seiner Frau vorgeschwärmt und ihr Fotos gezeigt. Immer und immer wieder.
Eine durchschnittlich hübsche, blonde junge Frau. Nichts Besonderes, hatte Tyne gedacht.
Aber das hatte sie Ken natürlich nicht gesagt. Sie hatte ihm bestätigt, dass seine Frau die schönste, beste, engelhafteste auf der Welt wäre, so wie er es wollte.
Schließlich verstand sie nichts davon. Sie hatte Frauen . . . gehabt, aber sich nie wirklich für sie interessiert. Für ihren Körper, das ja, für eine kurze Zeit, aber für nichts darüber hinaus. Es waren immer nur Stippvisiten gewesen, noch nicht einmal Besuche. Wenn sie Urlaub von der Army hatte.
Wie ein Matrose, der in einen Hafen einlief und seinen Nachholbedarf stillen wollte. Schnell und problemlos. Ohne großen Schnickschnack und auch ohne großen Nachhall. Bis zum nächsten Mal. In einem anderen Hafen.
Die Frau hatte dabei keine große Rolle gespielt. Sie war mehr eine . . . Funktion.
Ken hatte seine Frau nie als eine Funktion betrachtet. Für ihn war sie die Erfüllung seiner Träume gewesen.
Träume, die Tyne noch nicht einmal kannte. Nie gekannt hatte.
Doch jetzt zog diese Frau sie in dieses Haus hinein, ihres und Kens Haus, bis aufs Sofa, auf das sie Tyne niederdrückte.
»Wollen Sie etwas essen?«, fragte sie atemlos. »Mein ganzer Kühlschrank ist voll. Ich kann Ihnen jegliche Variation eines Auflaufs anbieten.« Sie lachte etwas hysterisch. »Aber nein . . . nein . . .« Suchend blickte sie sich um. »Sie sind Soldatin. Sie wollen bestimmt etwas trinken. Ken wollte immer etwas trinken . . .« Wie halb blind stolperte sie fast zu einem kleinen Barwagen, der in der Ecke neben der Tür stand. »Whisky. Ken mag Whisky . . .«
»Ich nicht«, unterbrach Tyne ihren sie beunruhigenden Monolog. In ihrem Inneren verstärkte sich das Verlangen, schleunigst zur Tür zu gehen und dieses Haus zu verlassen. Loszumarschieren und erst ganz weit weg von hier stehenzubleiben. Wenn überhaupt. »Bitte, Mrs. Wells . . .« Mit einer möglichst gelassenen Bewegung – Deeskalation war hier angesagt, das hatte sie bei der Army gelernt – stand sie auf und begab sich zu Shannon hinüber. »Beruhigen Sie sich. Ich brauche nichts zu essen. Und auch nichts zu trinken. Ich wollte Ihnen nur etwas bringen.«
Mit einem Blick, der nichts zu erkennen schien, starrte Shannon auf den Barwagen, als hätte sie gar nicht gehört, was Tyne gesagt hatte. Wie bei einer Marionette bewegte sich ihre Hand trotzdem auf eine Whiskyflasche zu, als würde sie von außen gesteuert.
Ohne darüber nachzudenken, griff Tyne nach ihrem Handgelenk und hielt es fest. »Ich möchte nichts trinken. Möchten Sie etwas?«
Es dauerte ein paar Sekunden, während der Tyne Shannons Handgelenk nicht losließ und Shannon sich nicht bewegte, als wäre sie plötzlich zur Salzsäule erstarrt. Dann schüttelte sie langsam den Kopf.
»Möchten Sie sich vielleicht auf die Couch setzen?«, fragte Tyne, ließ Shannons Handgelenk los und legte eine Hand auf ihre Schulter.
Wieder dauerte es ein paar Sekunden, bis die Worte anscheinend bei Shannon ankamen. Dann nickte sie, machte aber keinerlei Anstalten, sich zur Couch hinüberzubegeben.
Mit der Hand, die auf Shannons Schulter lag, dirigierte Tyne sie vorsichtig in Richtung des Sitzmöbels. Es war, als würde sie einer alten Frau über die Straße helfen, denn Shannon war völlig in sich zusammengesunken.
Früher hätte Tyne so etwas wahrscheinlich nicht getan, aber bei der Army hatte sie gelernt, dass solche Verhaltensweisen bei den vom Krieg Betroffenen Sympathie wecken konnten. Wenn ihr Hass nicht so groß war, dass das auch nichts mehr nützte.
Sie waren alle darin geschult worden, und doch war Ken bei genau so einer freundlichen Aktion gestorben.
Da sie das Sofa erreicht hatten, drückte Tyne nun Shannon darauf nieder, wie es Shannon zuvor mit ihr getan hatte, und trat einen Schritt zurück. »Besser?«
Shannon antwortete nicht, aber das hatte Tyne auch gar nicht erwartet. Sie war nur froh, dass sie die junge Frau in eine sitzende Position gebracht hatte. Wenn sie nun auf dem Sofa umkippte, fiel sie nicht so tief und das Verletzungsrisiko war geringer.
Es war wirklich erstaunlich, was sie in den letzten zwölf Jahren alles gelernt hatte, dachte Tyne aus irgendeinem ihr unerklärlichen Grund. Denn keine dieser Fähigkeiten hatte sie besessen, als sie in die Army eingetreten war.
Ein unterdrücktes Schluchzen entrang sich Shannons Kehle. »Entschuldigen Sie«, schlüpfte es fast unverständlich zwischen ihren Lippen hervor. »Entschuldigen Sie bitte.«
»Nichts zu entschuldigen.« Tyne verschränkte die Hände hinter dem Rücken und stand mit leicht gespreizten Beinen so da, wie es der Befehl Rührt euch! beim Exerzieren erforderte.
Es war meistens auch die Position, die man einnahm, wenn man einem Vorgesetzten gegenüberstand. Shannon war zwar nicht ihre Vorgesetzte, aber als ebenbürtig empfand Tyne sich ihr gegenüber auch nicht.
Vielleicht lag es daran, dass Ken Shannon immer so auf ein Podest gehoben und fast wie überirdisch engelhaft dargestellt hatte, dass auch Tyne nun nicht genau wusste, wie sie mit Shannon umgehen sollte.
Sicherlich war sie kein Engel, der extra für Ken vom Himmel gefallen war, aber sie war auch keine der Frauen, mit denen Tyne in ihren Urlauben zu tun gehabt hatte.
Ihr fehlte tatsächlich ein Muster für diese Art von Frau. In den letzten zwölf Jahren hatte sie keine Frau kennengelernt, die man mit Shannon hätte vergleichen können.
»Sie sagten . . .« Shannon schluckte, pulte ein zerknülltes Taschentuch aus ihrer Hand und wischte sich damit über die Augen. »Sie sagten«, wiederholte sie, »Sie wollten mir etwas bringen?«
»Ja.« Tyne nickte. »Als Ken im Lazarett lag, hat er es mir gegeben.«
Mit einem Griff in die Hosentasche zog sie etwas heraus. Es war in ein sorgfältig gefaltetes Armeetaschentuch eingeschlagen.
»Was ist das?« Zum ersten Mal, seit Tyne sie zum Sofa bugsiert hatte, blickte Shannon auf.
»Eine Kette, die er immer um den Hals getragen hat«, erklärte Tyne. »Er nannte es seinen Glücksbringer.«
Sie schlug das Taschentuch auf und nahm den kleinen Gegenstand heraus, reichte ihn Shannon.
Doch Shannon nahm ihn nicht, starrte ihn nur an. Ihre Augen waren tief gerötet. Es schienen keine Tränen mehr darin zu sein.
Dann plötzlich wisperte sie, und es war nur wie ein Hauch: »Den habe ich ihm gegeben. Damit ihm . . . nichts . . . passiert.« Erneut schluchzte sie auf, wandte ihren Blick aber nicht ab. »Es ist ein Christophorus. Er sollte ihn beschützen.«
Das hat er wohl nicht getan, dachte Tyne.
Sie war nicht religiös und hatte nie an irgendetwas geglaubt, das über den täglichen Wahnsinn, der sie seit Beginn ihres Lebens begleitete, hinausging.
»Ken wollte nicht, dass er mit den anderen Sachen an Sie geschickt wird«, sagte sie. »Die haben Sie doch bekommen?«
Shannon sah sie an, als hätte sie sie wieder nicht verstanden, doch dann nickte sie. »Ja, die habe ich bekommen.«
»Gut.« Für Tyne war ihr Auftrag damit erledigt.
Doch sie hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt einfach so gehen konnte. Was sie tun sollte, wenn sie blieb, wusste sie aber auch nicht.
Eine ganze Weile saß Shannon nur so da, rührte sich nicht. Dann raffte sie sich auf und sah Tyne an. Die Kette hatte sie immer noch nicht genommen.
»Legen Sie sie bitte auf den Tisch?«, bat sie.
Da sie ohnehin nichts anderes tun konnte, legte Tyne das Schmuckstück direkt vor Shannon ab. Dann steckte sie ihr Taschentuch wieder genauso sorgfältig gefaltet wie zuvor in die Hosentasche.
»Einen Whisky wollen Sie nicht, aber hätten Sie vielleicht gern einen Kaffee?« In Shannons Gesicht versuchte ein gequältes Lächeln, sich einen Platz zu erobern.
Schon wollte Tyne dazu ansetzen, den Kopf zu schütteln, da fuhr Shannon bereits fort: »Sie haben mir noch gar nichts von Ken erzählt. Waren Sie lange in seiner Einheit?«
»Nicht so lange«, sagte Tyne. »Das letzte halbe Jahr. Aber wir haben uns gleich gut verstanden.«
Shannons Mundwinkel zuckten. »Ken hat sich mit jedem verstanden. Manchmal schon zu gut.« Mit einer schwerfällig wirkenden Bewegung stützte sie sich neben ihren Beinen auf dem Sofa ab und stand auf. »Einen Kaffee schlagen Sie mir nicht ab, oder? Sie waren doch bestimmt eine Weile unterwegs. Kommen Sie aus Oregon?«
»N-Nein.« Eigentlich neigte Tyne nicht zum Stammeln, aber auf einmal tat sie es, während Shannon zu einer Schwingtür ging, die den Küchenbereich von diesem Zimmer hier trennte.
Es war ein kleines Haus, ein sogenanntes Einsteigerhaus, wie diese Art Häuser als erstes eigenes Heim für junge Leute, die gerade erst geheiratet hatten oder sonst wie zusammenziehen wollten, angepriesen wurde.
Eine Durchreiche verband die beiden Räume, sodass Shannon und Tyne sich weiterhin sehen konnten, während Shannon eine Kaffeemaschine mit Kaffeepulver und Wasser versorgte und dann anschaltete.
»Dauert nur eine Minute.« Sie versuchte erneut ein Lächeln, das aber nicht bis in ihre Augen stieg.
»Sie müssen sich wirklich keine Mühe machen meinetwegen«, wehrte Tyne ab, obwohl sie schon das Gefühl hatte, dass das sinnlos war.
Eins hatte Ken ihr nicht über Shannon erzählt: dass Shannon anscheinend genau wusste, was sie wollte, und das auch durchsetzte. Selbst in ihrem jetzigen mitgenommenen Zustand.
»Ist keine Mühe.« Das Lächeln blieb genau da, wo Shannon es zuvor hinbefördert hatte. Es war wie eine aufgesetzte Maske. »Normalerweise trinke ich den ganzen Tag über Kaffee, und es ist immer eine Kanne fertig. Aber ich war so nervös –« Sie brach ab.
»Bei der Army trinken wir auch viel zu viel Kaffee«, schloss Tyne sich ihrer Bemerkung an. »Im Dienst ist kein Alkohol erlaubt.«
»Wie lange haben Sie Urlaub?«, fragte Shannon, nahm zwei Becher aus einem Oberschrank und stellte sie neben die Maschine.
»Ich . . .« Tyne räusperte sich. »Ich habe keinen Urlaub . . . mehr. Meine zwölf Jahre sind um.«
»Zwölf Jahre?« Shannons Augenbrauen schoben sich erstaunt in die Höhe. »Sie sind Berufssoldatin?«
»Ich war es«, berichtigte Tyne. »Ich hatte mich für zwölf Jahre verpflichtet, und die sind jetzt vorbei.«
»Wie kann man –?« Kopfschüttelnd goss Shannon Kaffee in die beiden Becher und hob sie dann an. »Ken wurde eingezogen. Er wollte nie Soldat werden.«
Mit den beiden Bechern kam sie durch die Schwingtür wieder heraus und reichte einen davon Tyne. »Hier, bitte. Milch und Zucker?«
Verneinend bewegte Tyne den Kopf von einer Seite zur anderen. »Schwarz.«
»Brrr!« Shannon schüttelte sich. »Das könnte ich nie. Zucker muss sein. Ohne Zucker kann ich nicht leben.« Ein leichtes Lachen unterstrich diese Aussage, und diesmal schien es ein echtes Lachen zu sein, kein erzwungenes.
Doch es dauerte nur kurz. »Ken hat sich immer darüber lustig gemacht«, fügte sie hinzu. »Er trank seinen Kaffee auch schwarz. Oder mit einem Schuss Whisky darin.«
»Ich weiß«, sagte Tyne. »Er mochte Whisky. Manchmal hatte er deshalb Probleme mit unserem Kommandanten.«
»Darüber hat er nie was gesagt.« Shannon setzte sich wieder aufs Sofa. »Aber er war ja auch nicht lange dabei. Nicht so lange wie Sie.« Leicht irritiert blickte sie zu Tyne hoch. »Wollen Sie sich nicht setzen? Im Stehen trinkt sich Kaffee so ungemütlich.«
Gemütlichkeit war für Tyne noch nie ein Kriterium gewesen, aber sie folgte Shannons Aufforderung und ließ sich auf die Kante eines Sessels sinken, der der Couch gegenüberstand.
»Ich bin das Stehen gewöhnt«, sagte sie. »Das macht mir nichts aus.« Sie nahm einen Schluck von dem Kaffee. »Oh, der ist gut.«
»Sie klingen so überrascht.« Shannons Lächeln wirkte nun etwas amüsiert. Anscheinend entspannte sie sich. »Haben Sie mir das nicht zugetraut?«
»Nein. Nein, nein. Das wollte ich nicht damit sagen.« Schnell versicherte Tyne ihr das, weil sie das Gefühl hatte, etwas falschgemacht zu haben.
»Ken hat mir nie viel zugetraut«, sagte Shannon. »Er meinte immer, er wäre der Mann im Haus, und ich brauchte mich um nichts zu kümmern. Außer ums Kochen. Das betrachtete er nicht als Arbeit.«
»Was es natürlich ist«, bemerkte Tyne höflich. »Aber Ken hatte zu vielem seine eigene Ansicht. Das habe ich gleich gemerkt.«
»Ja, er . . .« Shannon nahm noch einen Schluck von ihrem Kaffee und stellte den Becher dann auf den niedrigen Couchtisch. »Er hat sich öfter mit meinem Vater gestritten deshalb. Mein Vater hat nämlich auch zu allem seine eigene Ansicht, in die er sich nicht reinreden lassen will. Und Ken war bei ihm angestellt.«
»Ach?« Das hatte Tyne noch nicht gewusst.
Über Shannon hatte Ken ihr viel erzählt, aber nicht über ihre Familie. Für Tyne hatte das so gewirkt, als hätte sie gar keine.
»So haben wir uns kennengelernt«, erklärte Shannon. »Es war Liebe auf den ersten Blick. Was meinem Vater gar nicht recht war. Er schätzte Ken als Zimmermann sehr, aber als Schwiegersohn . . .«, sie holte tief Luft, »war er ihm nicht gut genug. Er ist Bauunternehmer, wissen Sie.«
Das ging für Tyne nun fast schon etwas zu weit bezüglich dessen, was sie eigentlich gar nicht wissen wollte. Zu viele Informationen, die ihr nichts bedeuteten.
»Tja«, machte sie deshalb nur, trank ihren Kaffee aus und stellte den Becher ebenfalls auf den Tisch, direkt neben den von Shannon. »Vielen Dank für den Kaffee, Mrs. Wells. Ich muss dann mal wieder . . .« Sie stand auf.
»Weiter zu Ihrer Familie, nicht wahr?«, vermutete Shannon. »Die werden sich bestimmt freuen, Sie nach so langer Zeit wiederzusehen. Wann haben Sie sie das letzte Mal besucht?«
Tyne räusperte sich erneut. »Ähm, ja. Wie gesagt, vielen Dank für den Kaffee, Mrs. Wells.« Sie begab sich zur Tür.
»Sie wollen wirklich schon wieder gehen?«, fragte Shannon, auf einmal mit einem erschrockenen Ausdruck in der Stimme. »Habe ich etwas Falsches gesagt?«
Sie erhob sich ebenfalls und kam zur Tür herüber, an der Tyne bereits mit der Hand auf dem Türknopf stand.
»Überhaupt nicht«, behauptete Tyne. »Alles in Ordnung. Ich wollte nur das erledigen, worum Ken mich gebeten hatte, und das ist ja jetzt erledigt.«
»Ja.« Shannons Blick huschte zum Couchtisch hinüber, auf dem das Kettchen mit dem Anhänger lag. »Das ist erledigt.« Ihr Blick kehrte zu Tyne zurück. »Aber Sie haben mir immer noch nicht viel von Ken erzählt. Und das . . .«, sie schluckte, »ist jetzt alles, was ich noch von ihm habe.« Ihre Hand legte sich auf ihren Bauch. »Und sein Kind.«
»Sie sind schwanger?« Tynes Augen öffneten sich weit. »Das hat Ken mir gar nicht erzählt.«
»Er wusste es auch noch nicht«, murmelte Shannon. »Ich wollte ihm gerade schreiben, als . . .«, um ihre Augenlider herum zuckte es, »die Nachricht kam.« Sie senkte den Blick. »Aber ich will Sie natürlich nicht aufhalten, wenn Sie etwas Wichtiges zu tun haben«, fügte sie leise hinzu.
Tyne stand etwas unentschlossen da. Das war wiederum eine Situation, für die sie kein Muster hatte. »Na ja, Wichtiges . . .«, schränkte sie dann ein. »Ich muss mir einen Job suchen, das ist eigentlich alles.«
Eben noch hatte Shannon die Augen auf den Boden gerichtet gehalten, doch ganz überraschend schnellte ihr Kopf auf einmal hoch, als hätte sich plötzlich eine Feder gelöst. »Einen Job? Sie suchen einen Job?«
»Ja.« Was interessierte Shannon das? Tynes Stirn runzelte sich leicht vor Verständnislosigkeit. »Mein Gehalt von der Army bleibt ja nun aus. Ein bisschen was habe ich zwar gespart –«
»Kommen Sie«, unterbrach Shannon sie mit unerwarteter Energie, packte sie am Arm und öffnete die Tür. »Kommen Sie mal mit.«
Ihre antrainierten Reflexe hätten beinah dazu geführt, dass Tyne Shannon mit einem einzigen Krav-Maga-Schwung auf den Boden befördert hätte, aber glücklicherweise hatte sie aufgrund der Situation ein wenig gezögert und unterbrach den Ansatz ebenso schnell, wie er gekommen war.
»Wohin?«, fragte sie verdutzt.
»Zu meinem Vater«, erklärte Shannon. »Es ist gleich hier drüben.«
Mit mehr Kraft, als Tyne ihr zugetraut hätte, zerrte sie Tyne über den Hof, auf dem ihr Haus stand.
Als sie die Straße entlanggekommen war, hatte Tyne das Baugeschäft zwar gesehen, aber sich nicht dafür interessiert. O’Malley Construction stand in großen Lettern über dem Eingang.
Das war der Vordereingang gewesen. Shannon zog sie nun zum Hintereingang hinein, der einer hohen Scheunentür glich.
»Wo ist Dad, Mikey?«, fragte sie einen jungen Mann, der kaum die Schule abgeschlossen haben konnte und an einem Gabelstapler stand. »Ist er hier?«
Der mit Mikey Angesprochene wirkte etwas überrascht von ihrem Auftauchen und antwortete nicht sofort.
»Mikey«, wiederholte sie ungeduldig drängend. »Ist er hier?«
Langsam nickte der Junge. Dann hob er den Arm und wies zum anderen Ende der Halle. »Dahinten.«
Und schon zog Shannon Tyne weiter. »Sie sind doch handwerklich begabt?«, fragte sie nach hinten, während Tyne sich vorkam wie ein Stück Vieh, das zur Schlachtbank geführt wurde. »Natürlich sind Sie das. Sie waren bei der Army.«
Ob das eine wirklich das andere beinhaltete, da war Tyne sich nicht so sicher, aber Shannon nahm es ganz offenbar an.
»Dad!«, rief sie laut, und Tyne wunderte sich, was für eine Kraft plötzlich in dieser Frau steckte, die eben noch ein zusammengesunkenes Häufchen Elend gewesen war. »Dad!«
Eine tiefe Stimme antwortete: »Shannon? Bist du das?«
»Wer sonst?«, fragte Shannon zurück.
Mit einem erstaunten Gesichtsausdruck trat ein kräftiger Endvierziger hinter einem großen Truck hervor, der schmutzstarrend in der Halle stand. Anscheinend hatte er ein Vollbad im Matsch genommen.
»Du hast das Haus verlassen?«, fragte er noch erstaunter als zuvor.
»Sieht man doch«, gab Shannon wegwerfend Antwort.
Dieses Gespräch war wie Pingpong, dachte Tyne auf eine Art verwirrt, die sie gar nicht kannte.
Mittlerweile hatte Shannon sie bis kurz vor ihren Vater gezogen und blieb nun stehen. »Das ist Tyne«, stellte sie vor. »Tyne . . .« Ihre Stirn kräuselte sich angestrengt.
»Monroe«, half Tyne ihr aus.
»Ja genau, Tyne Monroe«, wiederholte Shannon. »Und sie sucht einen Job. Ist gerade raus aus der Army. Sie war mit Ken in einer Einheit.«
Das waren wohl ein paar Informationen zu viel auf einmal für den älteren Mann, dessen Blick zwischen seiner Tochter und Tyne ziemlich planlos hin- und herwanderte.
»Das ist mein Vater, Sean O’Malley«, stellte Shannon nun auch ihn vor. »Ihm gehört die Baufirma hier.«
Das hatte Tyne sich zwar langsam schon gedacht, aber immer noch wusste sie nicht, warum Shannon sie über den Hof in diese Halle gezerrt und mit ihrem Vater bekanntgemacht hatte, den eine Tyne Monroe, die gerade die Army verlassen hatte, kaum interessieren konnte.
»Guten Tag, Mr. O’Malley«, begrüßte sie Shannons Vater mit einem respektvollen Nicken ihres Kopfes.
Die Hand streckte sie ihm nicht hin, denn das Vorrecht hatte er als Älterer. Die Hierarchien und Befehlsstrukturen der Army waren tief in sie eingebrannt.
Es gab kein Gleich. Es gab immer nur ein Oben und ein Unten, je nach Dienstrang.
»Tach«, antwortete O’Malley ziemlich gleichgültig, dann wandte er seine Aufmerksamkeit seiner Tochter zu. »Geht es dir gut? Was machst du hier draußen?«
»Seit wann darf ich das nicht mehr?«, fragte Shannon ziemlich frech. Eine erstaunliche Veränderung war mit ihr vorgegangen. »Das habe ich doch immer getan.«
»In letzter Zeit«, er räusperte sich, »nicht mehr so.«
»Du suchst doch Leute, oder?«, kam Shannon wieder auf das Thema zurück, das sie anscheinend als Einziges interes-sierte. »Und Tyne«, sie drehte sich zu Tyne, die immer noch halb hinter ihr stand, »sucht einen Job. Also?«
»Also was?« Noch einmal ließ er kurz seinen Blick über Tyne schweifen. »Ich brauche kein Büropersonal. Ich brauche Männer, die auf dem Bau anpacken können. Zimmerleute, Dachdecker, Maurer und so. Das weißt du doch.«
»Sie kann anpacken. Sie war in der Army«, behauptete Shannon, und Tyne wunderte sich erneut, woher sie diese Überzeugung hatte, ohne sie, Tyne, überhaupt zu kennen. »Ist doch so, nicht wahr?« Jetzt wandte sie sich an Tyne.
Ziemlich überrumpelt konnte Tyne nur nicken. »Ich war im Panzerpionierbataillon«, sagte sie. »Wir mussten alles Mögliche zusammenschustern und freiräumen, Schneisen schlagen, Wasser oder sonst welche Hindernisse überwinden, Behelfsbrücken bauen und so weiter.«
Sean O’Malleys Augenbrauen schossen interessiert nach oben. »Im selben Bataillon wie Ken?«, fragte er.
»Sagte ich doch«, meinte Shannon zappelig von einem Fuß auf den anderen tretend. »Also? Was ist jetzt?«
»Na ja . . .« O’Malley betrachtete Tyne, die ziemlich stramm in ihrer Uniform dastand, nun interessierter von oben bis unten. »Groß sind Sie ja. Kräftige Schultern.« Er grinste. »Oder ist das nur die Uniform?«
In Tyne regte sich maßlose Verblüffung. Was tat sich hier gerade? Sie hatte sich auf eine lange und frustrierende Jobsuche eingestellt, und nun fiel ihr das regelrecht in den Schoß? So sah es zumindest aus.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ich war immer schon breitschultrig. Und groß für mein Alter. Schon mit fünfzehn hat man mich für erwachsen gehalten.«
»Na dann . . .« Noch einmal betrachtete Sean sie. »Haben Sie eine Unterkunft? Familie hier in Portland?«
Erneut setzte Tyne zu einem Kopfschütteln an, da warf Shannon ein: »Sie kann bei mir wohnen. Das Haus hat zwei Schlafzimmer. Und sie hat es nicht weit zur Arbeit.«
Mit demselben Grinsen wie ihr Vater sah sie Tyne an.
Der streckte Tyne die Hand hin.
»Schlagen Sie ein«, forderte Shannon Tyne auf, als die sich nicht rührte. »Ein Handschlag von meinem Vater ist besser als ein geschriebener Vertrag. Das können Sie mir glauben.«
Zögernd trat Tyne vor und legte ihre Hand in die von Sean O’Malley. »Wenn Sie sicher sind, Mr. O’Malley . . .«
O’Malley lachte. »Shannon hat zwar nicht immer die beste Menschenkenntnis«, er blinzelte seiner Tochter zu, »aber ich bin durchaus bereit, es noch mal mit jemandem zu versuchen, den sie mir anschleppt. Schlimmer als andere«, sein Blick schweifte durch die Halle, »können Sie auch nicht sein. Sie haben doch keine Höhenangst?«
»Nein.« Tyne schüttelte erneut den Kopf. »Habe ich nicht. Ich konnte immer auf die höchsten Bäume klettern.«
»Dann werden Sie mal dieses Ballkleid los.« O’Malley wies auf Tynes Uniform. »Nicht dass Sie sich noch schmutzig machen. Haben Sie Arbeitskleidung?«
»Eine Arbeitsuniform«, nickte Tyne. »Das ist ein Overall, ähnlich wie Ihrer«, erklärte sie. »Nur mit ein paar Militärabzeichen.«
»Wird für den Anfang reichen«, meinte O’Malley. »Und jetzt müssen wir arbeiten.« Er wandte sich zu dem Truck zurück. »Damit dieses Schätzchen bald wieder läuft. Verstehen Sie was von Autos?«, warf er in Tynes Richtung zurück, während er sich schon wieder von ihnen entfernte.
»Mehr von Panzern«, sagte Tyne, »aber ja, Autos gehen auch.«
Er drehte sich halb über die Schulter, hob die Hand und streckte den Daumen nach oben. »Na, da hast du ja wieder jemand angeschleppt«, zog er seine Tochter auf.
Dann verschwand er unter den riesigen Rädern des Trucks.
Shannon lachte und klatschte in die Hände. »Jobsuche beendet!«, rief sie.
Im nächsten Moment sanken ihre Hände herab, und ihr Lachen verschwand. »Was tue ich denn hier?«, fragte sie sich selbst.
Vielleicht auch Tyne. Das war nicht so klar.
Auf einmal wieder zusammengesunken trat sie den Rückweg ins Haus an.
Tyne hatte nicht die geringste Ahnung, was geschehen war. Ob sie ihr folgen sollte.
Also sah sie ihr nur nach.
4
Shannon hatte nicht die geringste Ahnung, was in sie gefahren war. Auf einmal hatte sie alles vergessen, was sie belastet hatte, war losgestürmt wie damals. Wie damals, als . . . bevor . . .
Vielleicht war es die Uniform. Auch wenn sie jetzt wusste, dass Tyne nicht Ken war, hatte die Uniform ihr eine gewisse Vertrautheit vermittelt. Ein gewisses Zurückfallen in die Vergangenheit.
Wenn Ken zurückgekommen wäre, hätte er weiterhin bei ihrem Vater gearbeitet. Es wäre alles wieder so gewesen wie früher.
Früher . . . Sie erreichte das Haus und sah eine Tasche auf der Veranda stehen. Olivgrün. Sackartig. Militärisch.
Wie geistesabwesend griff sie danach. Der Sack war schwer. Sie konnte ihn kaum anheben.
Also zog sie ihn ins Haus hinein und deponierte ihn im zweiten Schlafzimmer.
Das Kinderzimmer, hatten Ken und sie gedacht. Aber was da in ihrem Bauch wuchs – lächelnd strich sie ohne nachzudenken darüber –, war noch lange nicht so weit, ein eigenes Zimmer zu brauchen. So lange konnte Tyne es haben.
So lange? Ein paar Sekunden starrte sie auf den olivgrünen Sack, dann drehte sie sich um und ging ins Wohnzimmer zurück.
Es war, als hätte eine Weile das Leben wieder Besitz von ihr ergriffen, doch nun war es genauso schnell erneut fort. Seit Ken zur Army gegangen war, war das Leben hier zu Hause dennoch weitergelaufen. Es war nicht wirklich unterbrochen worden.
Erst mit der Nachricht von Kens Tod war das geschehen. Da war plötzlich etwas in ihr abgerissen. Die Verbindung zu dem, was man als normal betrachtete. Ein normales Leben, wie es die meisten erwarteten und jeden Tag führten.
Das hatte sie auch getan. Sie hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon gehabt, wie ihr Leben ablaufen würde. Erst die Highschool, dann ein Mann und Kinder, ein Haus mit einem weißen Zaun.
Ihr Bruder würde die Baufirma übernehmen, und sie selbst würde eine Familie haben, sich darum kümmern. Sehr viel weiter hatte sie nicht gedacht.
Nun hatte der Krieg in irgendeinem fremden Land, das sie nicht kannte und auch niemals kennenlernen wollte, ihr schon gleich zu Anfang einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Es war einfach nicht fair. Überhaupt nicht fair. Was gingen sie die Leute dahinten am anderen Ende der Welt an? Wie kamen sie dazu, Ken einfach umzubringen? Er hatte ihnen doch nichts getan. Das Pionierbataillon kämpfte nicht. Sie räumten nur den Weg frei.
Nichts anderes hatte Ken getan, und bei nichts anderem war er gestorben. Wieder versuchten Tränen, sich in ihre Augen zu kämpfen, aber wie schon zuvor blieben die trocken. Tränendrüsen konnten offenbar nur eine bestimmte Menge an Flüssigkeit produzieren, dann waren sie leer.
Wie sollte es nun weitergehen? Jemand war aus dem Krieg zurückgekommen. Tyne, nicht Ken. War das eine Prophezeiung? Ein Zeichen dafür, dass nicht alle starben, dass für einige das Leben weiterging?
Aber wie? Wie sollte es weitergehen? Es war so schwer, sich das vorzustellen.
Seit sie Ken geheiratet hatte, hatte ihr Weg wie eine gerade Linie vor ihr gelegen. Keine Abzweigungen. Keine Umwege. Alles war vorbestimmt.
Ken war ein guter Zimmermann. Er würde immer einen Job finden, auch wenn es nicht der bei ihrem Vater war.
Gut, er trank ein bisschen viel. Aber auch das war normal. Auf dem Bau wurde immer viel getrunken. Alle Leute, die auf dem Bau arbeiteten, tranken.
Nur ihr Vater war eine Ausnahme. Er war Abstinenzler. Absolut ungewöhnlich für einen Iren. Beziehungsweise für einen Amerikaner irischer Abstammung. Weshalb er damit auch immer aufgezogen wurde. Aber das störte ihn nicht.
Ihre Mutter machte die Buchhaltung für das Baugeschäft. Aber lieber noch hatte sie sich darum gekümmert, ihre Kinder großzuziehen. Sie war immer Shannons Vorbild gewesen. Für alles hatte sie stets eine Lösung gefunden, und ihre ruhige Art war ein ausgleichender Gegenpol zum Temperament ihres Vaters.
Das Shannon geerbt hatte. Ihr Bruder war eher der Ruhepol wie ihre Mutter. Da hatten sich in den Kindern die Veranlagungen der Eltern umgekehrt.
Auch wenn in ihrem Bauch noch gar keine Bewegung zu spüren sein konnte, legte sie erneut eine Hand darauf. Das schien das Einzige zu sein, was jetzt noch vorbestimmt war. Sie würde dieses Kind bekommen. Aber ohne den Mann dazu. Ohne Ken.
Doch obwohl Ken nicht da war, nie mehr da sein würde, lag da ein grüner Militärrucksack im zweiten Schlafzimmer, der an ihn erinnerte. Auch wenn es nicht seiner war.
Was für ein merkwürdiger Zufall. Oder nein, es war kein Zufall. Tyne Monroe war mit einem Auftrag von Ken zu Shannon gekommen, nicht zufällig. Vielleicht war es Zufall gewesen, dass Ken und sie in derselben Einheit gedient hatten, aber dass sie hier in Portland aufgetaucht war, konnte man nicht als Zufall bezeichnen.
Was war es dann? Schicksal? Wäre Tyne ein Mann gewesen, hätte Shannon ihr niemals angeboten, das zweite Schlafzimmer zu nutzen. So war der noch größere Zufall vielleicht, dass Tyne eine Frau war. Eine Frau, die eine Uniform trug und in der Army gedient hatte.
Auf den Gedanken wäre Shannon niemals gekommen. Wie kam man als Frau dazu, sich für eine Militärkarriere zu entscheiden? Das musste sie Tyne mal fragen. Ken hatte nicht zum Militär gewollt, was für Shannon die normale Reaktion war, aber Tyne hatte sich offenbar bewusst dafür entschieden. Für viele, viele Jahre.
Und dabei war sie noch so jung. Oder auch nicht. So richtig konnte Shannon das nicht einschätzen. Sie selbst war dreiundzwanzig. Wenn das Kind kam, würde sie vierundzwanzig sein. Ken war genauso alt gewesen. Acht Monate älter, aber das zählte kaum.
Tyne wirkte . . . Ja, wie wirkte sie eigentlich? Jünger sicherlich nicht, aber älter? Viel älter?
Angestrengt runzelte Shannon die Stirn. Tynes Augen wirkten älter. Als hätten sie mehr gesehen, als Shannon sich je hätte vorstellen können.
Und die stramme Haltung in der Uniform trug dazu bei, dass sie erwachsener wirkte als Ken, der immer wie ein großer Junge herumgelümmelt hatte. Sein Hemd hatte sich selten lange in der Hose gehalten, wenn er es einmal hineinstopfte. Meistens hing es ohnehin darüber.
Unwillkürlich hatte Shannon angenommen – wenn sie überhaupt darüber nachgedacht hatte –, dass Tyne genauso alt sein musste wie Ken, weil sie zusammen gedient hatten, aber das konnte ja gar nicht sein. Nach zwölf Jahren Verpflichtung zum Militär.
Tyne musste noch ein halbes Kind gewesen sein, als sie sich verpflichtete. Aber achtzehn musste man ja sein. Also achtzehn plus zwölf. Das ergab dreißig. Tyne musste mindestens dreißig Jahre alt sein.
Ja, dachte Shannon. Das kam hin. Sieben Jahre älter als sie selbst. Und vermutlich, sie seufzte, wesentlich erfahrener, was das Leben betraf. Shannon hatte Portland noch nie verlassen außer zu einem Feriencamp im Sommer, als sie noch auf der Highschool gewesen war.
Tyne hatte so viel mehr gesehen, so viel mehr erlebt. Sie wusste, wie es in anderen Ländern aussah, nicht nur ein paar Hundert Meilen außerhalb von Portland. Fremde Menschen, fremde Länder, fremde Sitten.
Im Moment konnte Shannon nicht entscheiden, ob sie das überhaupt interessierte. Sie fand Amerika eigentlich groß genug, um alles erleben zu können, was man erleben wollte.
Anscheinend war Tyne nicht der Meinung gewesen. Hatte sie sich nach fremden Ländern gesehnt, weil sie hier nicht zufrieden gewesen war?
Dabei war schon der Unterschied zwischen der amerikanischen Westküste und Ostküste gewaltig. Die Menschen waren völlig verschieden, auch die Lebensweise. Jeder Staat hatte seine eigene Lebensart und seine eigene Philosophie. Manchmal sogar jede Stadt.
Bei Leuten aus New York und Leuten aus Los Angeles lagen Welten dazwischen, ein ganzer Kontinent.
Ihre eigenen Urgroßeltern waren aus Europa gekommen. Für sie musste es mehr als ein Ozean gewesen sein, der zwischen ihrem alten und ihrem neuen Leben lag. Sie hatten Traditionen aus Irland mitgebracht, die heutzutage nur noch teilweise aufrechterhalten wurden.
Saint Patrick’s Day. Das war eine irische Tradition, die sich sogar bis zu Nicht-Iren ausgebreitet hatte. Aber vieles andere war verschwunden, wie ihre Großmutter ihr erzählt hatte.
Tyne war sicher keine Irin. Dunkelbraune Haare und haselnussbraune Augen sah man bei Iren selten. Obwohl ja nichts unmöglich war. Sie musste sie mal fragen.