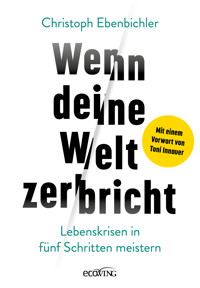
18,99 €
Mehr erfahren.
Neu orientieren in der Krise: Ein praktischer Leitfaden aus persönlicher Erfahrung Christoph Ebenbichler ist Sportwissenschaftler und unterstützt nach seiner eigenen aktiven Karriere Spitzensportler bei der Rückkehr nach Verletzungen. Als er 2021 bei einer Skitour stürzt und sich schwer am linken Bein verletzt, reißt es ihm buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. Selbst zum Patienten geworden, fällt er zunächst in ein tiefes Loch und sieht keinen Weg, wie er diese Lebenskrise meistern kann. Doch dann beginnt seine Recherche, und er stellt schnell fest, dass es zwar zahlreiche theoretische Abhandlungen darüber gibt, wie Rückschläge verkraftet werden können – aber ein praktischer Ansatz fehlt. In diesem Selbsthilfe-Buch hat er den Weg zusammengetragen, der ihm selbst aus dem Dunkel geholfen hat. - Krisen als Chance? - Was hilft: Christoph Ebenbichlers fünf Schritte zur Bewältigung von Lebenskrisen - Persönliche Ressourcen kennenlernen: Übungen und Impulse, die die Resilienz stärken und bei der Neuorientierung helfen - Mit einem Vorwort von Skisprung-Legende Toni Innauer - Ein Leitfaden aus Theorie und Erfahrung, voller wertvoller Hilfestellungen bei Lebenskrisen Praxiserprobte Coping-Strategien, um Rückschläge zu verkraften Jede Krise ist anders und wird sehr individuell erlebt. Und doch gibt es Methoden, die übergreifend in unterschiedlichen Fällen helfen. Das Fünf-Schritte-Programm, mit dem Christoph Ebenbichler selbst neuen Lebensmut schöpfte, besteht aus Akzeptanz, Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Reflexion und Konsequenz. Jedem dieser Schritte hat er ein eigenes Kapitel mit Übungen und Impulsen gewidmet, die ihm selbst geholfen haben. Entstanden ist ein Lebenshilfe-Ratgeber, der sowohl präventiv eingesetzt werden kann, um stressbedingten Erkrankungen vorzubeugen, als auch Betroffenen wirksame Achtsamkeitsübungen und Strategien zur persönlichen Entwicklung an die Hand gibt, selbst wenn die Hoffnung gerade nicht greifbar scheint: Steigen Sie aus der negativen Gedankenspirale aus und glauben Sie wieder fest an die Kraft der Zuversicht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christoph Ebenbichler
Wenn deine Welt zerbricht
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen. Sollten Sie dahingehend Versäumnisse feststellen, so bitten wir Sie, dies zu entschuldigen und uns die korrekten Nachweise für etwaige Nachauflagen mitzuteilen.
Zitat S. 114: Gerald Hüther (2015). Die Macht der inneren Bilder.
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG. Göttingen. Abdruck
mit freundlicher Genehmigung von Vandenhöck & Ruprecht.
Zitat S. 68: Ernest Hemingway (2018). In einem anderen Land.
Rowohlt Verlag. Hamburg.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2025 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Cover-, Innenteilgestaltung und Satz:
www.b3k-design.de, Andrea Schneider, diceindustries
Gesetzt aus der Palatino und Korolev Condensed
Lektorat: Caroline Metzger
Autorenillustration: © Claudia Meitert/carolineseidler.com
Foto Umschlag: © Max Draeger
Printed by PNB Print, Latvia
ISBN: 978-3-7110-0362-1
eISBN: 978-3-7110-5378-7
Für meine Familie
Vorwort
Vor vielen Jahren, im Dezember 1980, hätte ich genau dieses Buch gebraucht, es sollte aber noch lange nichts Vergleichbares auf den Markt kommen … Meine Mannschaft hatte mich gerade mit zertrümmertem Unterschenkel und quasi als Totalschaden in St. Moritz bzw. im Krankenhaus von Samedan zurückgelassen, um zum Training nach Oberstdorf weiterzureisen.
Die Erinnerungen an diese Situation, an den Sturz, die Schmerzen und all die belastenden Gedanken, Fragen, Ängste und Unsicherheiten wurden beim Lesen von Christoph Ebenbichlers Skiunfall-Geschichte wieder lebendig.
Christoph liefert der Leserschaft sauber recherchierte wissenschaftliche Einblicke, Erklärungen und Modelle – so etwas mag ich. Aber mindestens gleich gut gefällt mir, dass er uns auf seiner »Expedition« auch emotional in sein persönliches Erleben, Zweifeln, Hoffen und Wachsen mitnimmt. Er beschreibt eine lange, anstrengende Herausforderung, die nicht mit überbordenden Erwartungen, umsichtiger Planung und Vorfreude, sondern mit einem Ereignis aus heiterem Himmel, mit existenzieller Erschütterung, Schmerz und Ängsten eine völlige Neuorientierung erzwingt. Doch weit und breit sind weder Hoffnung, Energie noch Pläne dafür greifbar. Noch nicht.
All das beamte mich zurück zu meinem Aufschlag im Schnee von Graubünden bei –25 Grad Celsius. Zurück zu einer niederschmetternden Diagnose, die das viel zu frühe Ende meiner Skispringerlaufbahn bedeutete, und zurück zu den Gedanken und Emotionen, als ich dieses Drama Schritt für Schritt zu realisieren begann. Das mit dem Akzeptieren sollte – wie bei Christophs »Abenteuer« – noch länger dauern, aber wichtig werden.
Das vorliegende Buch spricht detailliert und systematisch viele Ebenen unseres Menschseins in Leidensprozessen an, es ist gespickt mit klug ausgewählten, hilfreichen Theorien, Denkmodellen und praktischen Tipps. Für besonders Neugierige geht es dabei auch in die Tiefe und verweist auf Weiterführendes. Meine Schwiegermutter selig meinte einmal über den Schwiegersohn in spe: »Der ist mir unheimlich, der geht den Dingen dermaßen auf den Grund!« Seit ich Christoph besser kenne, orte ich diese »bedrohliche Eigenschaft« auch bei ihm. So etwas verbindet. Schön für manche, aber offenbar einschüchternd für andere.
Der rote Faden des Buches ist die persönlich erlebte, erlittene und bewältigte Geschichte dahinter. Sie bringt die erstaunliche Fülle an Modellen, Theorien und Ratschlägen in eine organische, leicht zu lesende und überschaubare Struktur. Die Metapher der Bergtour tut ihr Übriges, um all die Phasen, Ereignisse und Werkzeuge zuordenbar und anregend zu halten.
Die Aufarbeitung des »Falls Ebenbichler« ist nicht nur deshalb so ergiebig, weil Christoph vor seinem Crash ein scheinbar unverwundbarer Extremsportler war. Der von seinem geliebten Sport so brutal abgeworfene und gezeichnete Jungvater ist zudem ausgebildeter Sportwissenschaftler und arbeitet als Universitätslektor und Trainer. Er kannte, analysierte und betreute schon viele ähnliche Fälle in seiner täglichen Berufspraxis. Urplötzlich fand er sich nach seinem Unfall in einer anderen Rolle wieder. Auf einen Schlag war er der leidende, geknickte Patient und nicht mehr der souveräne Wegweiser im Wiederaufbau einer Karriere, der nach dem Training pumperlgesund zu seiner Familie heimkehrt. Jetzt hing er selbst für Monate und mit düsteren Perspektiven in den Seilen.
Der alpine Skirennsport liefert schon seit Jahrzehnten eine schwer erträgliche und nicht zu verantwortende Anzahl an Unfällen und Verletzten. Vielen von ihnen half und hilft Christoph mit akribisch geplanten und durchgeführten Prozessen zurück auf die Ski, die Pisten und in den Weltcup.
All sein Wissen war ihm in der Rolle als frisch Betroffener zunächst nicht mehr zugänglich. Hilfe, entscheidende Impulse und Rettungsringe kamen aus dem Umfeld, von seiner Frau Mia, die sein Opferdenken demaskierte, aus der Biografie seines Leidensgenossen Aksel Lund Svindal, unzähligen Gesprächen sowie der täglichen, strukturierten Arbeit mit Ärzten, Psychologinnen, Physiotherapeuten und einem unterstützenden Freundeskreis.
Und es keimte die Idee, ein Projekt daraus zu machen – eine gelebte Parabel. Einen Weg, der Energie und doppelten Nutzen vermittelt: Intensivierung des eigenen Heilungsprozesses, Modellwirkung und Sinn! Die Frankl-Schülerin Elisabeth Lukas fasste diese Transformation in ihrem Buch Auch dein Leiden hat Sinn inspirierend zusammen. Manche Menschen haben lebensbedrohende Krisen, Schicksalsschläge und Belastungen bewältigt, verarbeitet und wegweisende Berichte darüber hinterlassen. Diese Beispiele geben vielen anderen Mut, Hoffnung und eine Perspektive. Insbesondere dann, wenn die Protagonistinnen und Protagonisten im Stande sind, ihren Weg und die Begleitumstände, die in der Person ablaufenden Prozesse, detailreich und bewegend zu beschreiben.
Was mich betrifft: Vielleicht war es eine der versteckten Stärken meiner Betreuertätigkeit im Spitzensport, eben nicht nur Olympiasiege und Weltrekorde, sondern auch spektakuläre Niederlagen, schwere Verletzungen und Rückschläge am eigenen Leib erlebt, übertaucht und für Weiterentwicklung genutzt zu haben. Jedenfalls konnten daraus Empathie und Einfühlungsvermögen entstehen. »Durch Leiden bildet der Herr seine Experten aus«, pflegte unser legendärer Trainer Baldur Preiml in den 1970er-Jahren zu sagen, wenn es wieder einen erwischt hatte.
Der schwierige, aber erkenntnisreiche Weg, den Christoph gegangen ist und nach wie vor geht, hat ihn Wertvolles entdecken und anhäufen lassen. In vielen Kehren, Steigungen, Plateaus und allen Rastplätzen auf dem Weg zum Gipfel der Bergtour hat er es identifiziert und markiert.
Beständig hat er den ganzheitlichen Heilungsprozess vorangetrieben und sachlich reflektiert, das Erleben und all die verwendeten Techniken, Theorien, Werkzeuge, Abläufe und detaillierten Prozesse dokumentiert. Das ist der entscheidende Unterschied zu so mancher spektakulären Erstbesteigung oder Eroberung: Erkenntniszuwachs, der über den Beweis der erstaunlichen Machbarkeit hinausreicht, wird dort oft vergeblich gesucht.
Was wir hier in Händen halten, ist zudem mehr als das facettenreiche, wissenschaftlich untermauerte Logbuch einer schwierigen Expedition. Das Buch wird vielen Betroffenen – nicht nur im Sport – eine Menge an Ansätzen, Impulsen und Zuversicht liefern. Vielen Betreuern, Trainern, Lehrern, Therapeuten und Führungskräften kann es ein wertvolles begleitendes Handbuch zum Verständnis und zur Gestaltung des transformativen und erfolgreichen Weges von weit unten bis nach oben sein.
Toni Innauer
Dezember 2024
INHALT
PROLOG
WAS IST EINE KRISE?
Übung: Box Breathing – die Kastenatmung
SALUTOGENESE
Impuls: Die drei Dimensionen der Kohärenz
DEINE KRISE - DEIN WEG
SCHRITT 1: AKZEPTANZ
NUTZE DEINE ANGST!
ÜBUNG Das Gedankentagebuch
NIMM ES AN!
IMPULS Die vier Hauptmodule aus Marsha Linehans Therapieansatz
ÜBUNG Die 5-4-3-2-1-Methode
VERMEIDE DAS WARUM!
ÜBUNG Der Gedankenstopp
SCHRITT 2: ZUVERSICHT
BERUHIGE DICH!
ÜBUNG Die SWOT-Analyse
PFLEGE DEINE BINDUNGEN!
IMPULS Die Buddy Night - dein monatlicher Freundschaftsabend
SEI REALISTISCH!
ÜBUNG Die Dankbarkeitsliste
SCHRITT 3: SELBSTWIRKSAMKEIT
ÜBUNG Testung der Selbstwirksamkeit
FINDE DEINEN SINN!
IMPULS Die Morgenroutine
SETZE DIR ZIELE!
ÜBUNG Erstellung einer Zielhierarchie
WÄHLE DEINEN FOKUS!
IMPULS Dein erster Schritt zur Organisation - alles erfassen
SCHRITT 4: REFLEXION
LERNE ZU FÜHLEN!
ÜBUNG Das Energiefass
ATME TIEF DURCH!
ÜBUNG Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
FÜTTERE DEN RICHTIGEN WOLF!
IMPULS Tauche ein in die heilende Kruft des Wuldes
SCHRITT 5: KONSEQUENZ
SEI HARTNÄCKIG!
IMPULS Raus aus der Komfortzone!
LEBE DEINEN TAG!
IMPULS Neue Gewohnheiten formen
VERSUCH’S MIT LIEBE!
IMPULS Geduld und Gelassenheit kultivieren
EPILOG
DANKE
Verzeichnis
Über den Autor
»Nur manchmal, während wir soschmerzhaft reifen, dass wir an diesembeinah sterben, dann:formt sich aus allem, was wir nicht begreifen, ein Angesicht und sieht uns strahlend an.«
RAINER MARIA RILKE, LYRIKER
PROLOG
Das Leben ist nicht immer fair. Manchmal werden wir von den Wellen des Schicksals einfach überrollt. In einem Moment haben wir noch alles fest im Griff – kurz darauf wird unsere Welt aus den Angeln gehoben. Bekommt Risse. Einfach so. Wie konnte das passieren? Weshalb gerade jetzt? Warum ich? Fragen, die sich in solchen Augenblicken regelrecht in unseren Köpfen festfressen. Sie sind meist laut, ständig präsent und wir können keinen anderen, klaren Gedanken mehr fassen. Nichts erscheint uns mehr möglich, und alles dreht sich unaufhaltsam um dasselbe Problem.
In diesen Momenten aber, wenn das Herz schwer ist und die Dunkelheit uns zu erdrücken droht, liegt in Wahrheit eine unermessliche Kraft. Denn wir können entscheiden, wie wir auf diesen Stressor reagieren. Wenn Probleme sich häufen und wir den Eindruck haben, dass uns etwas verfolgt, dass etwas gegen uns kämpft und unsere Zukunft bedroht, liegt in dieser Belastung vielleicht eine Lektion verborgen. Auch ich habe eine Krise erlebt. Eine lähmende, dunkle Zeit. Oft habe ich sie gehört, die gut gemeinten Sätze, dass dies auch eine Chance für Veränderung sein könne. Und doch blieb für mich lange Zeit die Frage offen, ob ich überhaupt bereit bin, den Schmerz zu ertragen, der mit diesem Wachstum einhergeht.
Jeder und jede von uns kennt dunkle Phasen, vielleicht erlebst du eine solche gerade jetzt, während du diese Zeilen liest, vielleicht liegt diese Zeit schon hinter dir, vielleicht liegt sie aber auch vor dir. Du lässt dir von dieser Situation diktieren, wie es dir geht. Du fragst dich ständig nach dem Warum. Ich frage mich jedoch: Wirst du umfallen, auseinanderbrechen und klein beigeben?
Was ich dir unbedingt schon an dieser Stelle sagen will: Du bist nicht allein. Ich verstehe dich. Ja, deine Krise ist individuell, nicht vergleichbar und ich habe keine Ahnung, worum genau es geht. Aber lass mich dich mitnehmen auf meine Reise. Du wirst schon bald verstehen, etwas mitnehmen können, und ich bin mir sicher, früher oder später wird alles gut. Auf seine ganz besondere und eigene Art und Weise.
Meine Geschichte beginnt an einem Sonntag im März des Jahres 2021. Ein schrecklich normaler Tag. Es ist kalt, mit meinem besten Bergfreund breche ich am Morgen zu einer Skitour in den Stubaier Alpen auf. In der Nacht zuvor hat es geschneit und der Himmel ist noch wolkenverhangen. Die Schneebedingungen sind perfekt. In der Luft tanzen diese zauberhaften, glitzernden Kristalle. Seit ich denken kann, liebe ich einfach alles am Skifahren. Die Zeit am Berg stillt Sehnsüchte in mir, denen ich seit jungen Jahren verfallen bin. Es ist mehr als nur ein Sport für mich – es ist immer auch eine Rückkehr zu diesen unbeschwerten, frohen Momenten meiner Kindheit. Aber dieser Tag wird einer, der mein Leben verändert, der alles auf den Kopf stellt und der meine Welt zerbrechen lässt.
Am Gipfel angekommen, verweilen wir nicht lange und fahren gleich wieder ab. Die Sicht wird schlechter. Wir entscheiden uns für eine eher gemütliche Variante. Keine schwierige Route, keine besonders steilen oder gefährlichen Hänge. Bei jedem einzelnen Schwung fühle ich mich frei, leicht, fast schwerelos. Ich genieße dieses Gefühl, und ich muss nicht groß darüber nachdenken, was ich tue. Meter um Meter erhöhe ich die Geschwindigkeit, und obwohl die vorherrschenden Sichtverhältnisse alles andere als optimal sind, komme ich nicht auf die Idee, langsamer zu werden. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit lässt mich den sicheren Korridor auf der langen, abfallenden Schneewehe verlassen. Und bevor ich reagieren kann, verliere ich den Kontakt zum Schnee. Es treibt mich über den Rand der Abbruchkante. Ein kurzer Moment im freien Fall. Stille. Dann der Aufprall.
Noch heute läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich mich in diesen Moment zurückversetze. Die Geräusche, als ich mit voller Wucht in das Astwerk krache. Der stechende Schmerz, der wie ein Blitz durch meinen Körper schießt, und der laute Schrei aus meinem Mund. Alles ist noch da. Im Augenblick der Kollision mit dem Baum weiß ich sofort, was geschehen ist. Mit all meiner Kraft versuche ich, die Wucht, mit der ich den Hang hinunterdonnere, abzufangen und irgendwie zum Stillstand zu kommen. Erst Monate später kann ich mir das Videomaterial meiner Helmkamera ansehen und den Unfallhergang rekapitulieren. Beim Zusammenstoß mit dem Stamm wird diese von meinem Kopf geschleudert, zeichnet aber noch lange die Schreie, die Telefonate mit der Bergrettung und die wirren Gespräche zwischen meinem Freund und mir auf. Eine gefühlte Ewigkeit in der Kälte beginnt. Ich bin erschöpft, geschockt und nur die Schmerzen, die wie Wellen durch meinen Körper schießen, hindern mich daran, einzuschlafen. Natürlich ist es nicht der erste Sturz in meiner Skikarriere. Es ist aber, wie mir schnell bewusst wird, der mit Abstand folgenschwerste.
Später sprechen die Ärzte von einer drittgradig offenen Unterschenkelfraktur. Die Bruchstelle ragt offen durch die Haut; Schien- und Wadenbein sind regelrecht zertrümmert. Durch eine Knieluxation, bei der das Gelenk vollständig verrenkt ist, sind die Kreuzbänder, Seitenbänder und andere wichtige Stabilisationsstrukturen gerissen. Diese Art von Verletzung ist deshalb besonders ernst, da nicht nur die Knochen und Bänder betroffen sind, sondern auch das umliegende Gewebe stark beschädigt und das Infektionsrisiko durch die offene Wunde sehr hoch ist. Die großflächigen Gewebsverletzungen sind so schwerwiegend, dass später Gewebe aus anderen Teilen meines Körpers transplantiert werden muss, um überhaupt eine kleine Chance auf Heilung zu ermöglichen. So wird dieser kalte, ganz normale Wintertag für mich zu dem Tag, den ich fast mit meinem linken Bein bezahlt hätte. Dem Tag, an dem ich für lange Zeit meine Freude und meinen Willen zu leben irgendwo im tiefen Pulverschnee verloren habe.
Jeder Mensch erlebt Krisen auf seine Weise. Manchmal sind es gravierende Ereignisse, manchmal scheinbar unbedeutende Vorfälle, die eine solche auslösen können: eine schlechte Note, eine Kündigung, eine Trennung, finanzielle Schwierigkeiten, der Tod eines Angehörigen, verpasste Gelegenheiten oder der Verlust von etwas, das dem eigenen Leben Bedeutung, Richtung und Sinn verliehen hat.
Mein Leben war schon immer vom Sport und von den Bergen bestimmt. Bewegung gibt mir Halt. In jungen Jahren besuchte ich die Skimittelschule Neustift und das Skigymnasium in Saalfelden. Neben den ganz normalen Unterrichtsfächern erfahren Schülerinnen und Schüler dort auch professionelles Training – nicht nur der Körper wird auf die hohen physischen Anforderungen und den Druck des Leistungssports vorbereitet, sondern auch der Geist. Es geht dabei auch um den Umgang mit Niederlagen und dem Verfehlen von selbst gesetzten oder von anderen erwarteten Zielen, um Selbstmotivation und mentales Training. Mit 22 Jahren gehörte ich als Skicross-Athlet zum A-Kader des Österreichischen Skiverbands. Ziel: die Olympischen Spiele 2010 im kanadischen Vancouver. Größter Traum: eine Medaille. Mein gesamter Alltag – Ausbildung, private Termine, Trainingsroutine, Ernährung und so weiter – war auf dieses Ziel ausgerichtet. Ein Sturz beim letzten Weltcup vor der Eröffnungsfeier in Nordamerika zerschlug damals jäh alle meine Hoffnungen und beendete meine professionelle Karriere. Trotz Rehabilitation und intensivem Training konnte ich nie an meine frühere Leistung anschließen. Ich wagte mich daraufhin ins hochalpine Gelände und suchte neue Herausforderungen abseits des professionellen Wettkampfes und abseits gesicherter Pisten.
Doch beruflich blieb ich dem Leistungssport treu und wechselte auf die theoretische Seite. Ich beendete mein Masterstudium und arbeite heute als Sportwissenschaftler und Trainer im Olympiazentrum Tirol. Parallel zu dieser Tätigkeit unterrichte ich als Dozent am Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck. Das wissenschaftliche, methodische Vorgehen in Kombination mit praktischem Nutzen lag mir schon immer nahe, inzwischen habe ich es zu meiner Hauptaufgabe gemacht: Seit 2011 bin ich für die Gesundheit und Leistungsentwicklung von unzähligen österreichischen Spitzensportlern und -sportlerinnen verantwortlich. Eines meiner Kerngebiete: Regenerationsmanagement nach Verletzungen.
Jetzt, an diesem kalten Wintertag im Jahr 2021, werde ich selbst zu einem dieser »zerstörten« Sportler, die Hilfe in ihrer Rehabilitation benötigen. Der Rettungshubschrauber fliegt mich aus dem sanften Weiß meiner geliebten Berge in die Innsbrucker Uniklinik, hinein in eine kalte Dunkelheit zwischen hell leuchtenden OP-Lampen. Dieser Dunkelheit werde ich in den kommenden vier Jahren immer wieder begegnen. An diesem Tag ist der letzte klare Satz des Oberarztes vor meiner ersten von insgesamt acht Operationen in drei Jahren dieser: »Herr Ebenbichler, stellen Sie sich darauf ein, dass Sie ohne Ihren Unterschenkel aufwachen könnten.« Dann setzt die Narkose ein – und es wird dunkel.
Acht Stunden später komme ich im Aufwachraum zu mir. Meine Augen sind noch geschlossen, aber mein Geist ist in heller Aufruhr. Vorsichtig wage ich einen Blick nach unten. Ich will es mir nicht ausmalen. Was wäre, wenn? Doch nein, mein linkes Bein ist noch da. Ob das jedoch so bleiben wird, kann mir vorerst niemand konkret beantworten. Es folgen Tage voller Ungewissheit. In der Dunkelheit. Dort befindet sich meine mentale Verfassung nach dem Unfall. Nichts ist mehr da, kein Funke Hoffnung, keine Kraft, kein Antrieb und kein Wille. Den Platz meiner Stärken nehmen Verzweiflung, Angst, Schwäche und Schuldgefühle gegenüber meiner jungen Familie ein.
Vielleicht denkst du nun: »Warum? Es gibt weit schlimmere Schicksale, er hat sein Bein doch behalten!« Das stimmt zwar, aber in der ersten Zeit nach dem Unfall wird mir langsam klar, was ich alles verloren habe: die Bewegung und den Sport, die mich mein ganzes Leben lang begleitet und bereichert haben. Die Ärzte erklären mir, dass ich nie wieder Skifahren werde. Auch die Möglichkeit, Bergabenteuer mit meinen Kindern zu erleben, scheint mir genommen. Man sagt mir Sätze wie: »Machen Sie sich keine Hoffnung, dass Sie mit Ihrer Familie je wieder einen Gipfel besteigen können.« Oder: »Sie werden vermutlich bis an Ihr Lebensende eine Gehhilfe benötigen.« Sie alle schwingen noch heute in meinen Gedanken mit.
Nach den trüben ersten Tagen im Krankenbett ist es meine Frau, die mich motiviert und mir dabei hilft, mich meiner Lage zu stellen. In ihrer direkten, aber optimistischen Art konfrontiert sie mich: »Ich habe immer gedacht, du bist stark. Aber jetzt liegst du hier und versinkst in Selbstmitleid. Auch wenn sie dir das Bein amputieren, werden wir das gemeinsam schaffen. Tu etwas! Nutz die Zeit und hör auf zu heulen!« Das ist anscheinend genau die Ansprache, die ich nötig habe. Nach Tagen der völligen Hoffnungslosigkeit nähere ich mich ganz vorsichtig meiner Problematik auf die Art und Weise, die mir am vertrautesten ist: wissenschaftlich und analytisch. Mein Ausgangspunkt ist eine gründliche Online-Recherche. Liegend, an alle möglichen Geräte angeschlossen, google ich nach Schlüsselbegriffen: »Krise«, »Resilienz«, »Regeneration nach Operation«, »Stressforschung« und »Trauma bewältigen«. Anschließend vertiefe ich mich immer weiter in das Thema, lese Bücher, Studien, akademische Essays, analysiere wissenschaftliche Konzepte.
Sehr schnell merke ich aber: Wer sich im Dunkel gefangen fühlt, dem hilft die Theorie nur bedingt. Wer nichts anderes als Hoffnungslosigkeit verspürt, keine Kraft für Alltägliches hat, kann Studien, Statistiken, wissenschaftliche Modelle und Vergleiche ebenso wenig gebrauchen wie gut gemeinte Ratschläge und leere Versprechungen. In der ersten Phase meiner Rehabilitation kann ich die physiologischen Aspekte meiner Verletzung aufgrund meiner Ausbildung sehr gut fassen und einordnen. In meiner Psyche jedoch herrscht Panik und absolutes Chaos. Ich muss mir eingestehen, dass ich mental nicht auf eine solche Situation vorbereitet bin. Vor meinem inneren Auge sehe ich den elfjährigen Jungen aus dem Zillertal, der vor Energie fast zu platzen scheint und bei einem bekannten Berglaufevent, dem Steinbockmarsch in Mayrhofen, eine für sein Alter beeindruckende Zeit erreicht: Er bewältigt die 30 Kilometer und 1870 Höhenmeter in weniger als vier Stunden. Doch dieses Bild von hoch oben in den Bergen verblasst schnell. Ich weiß nicht, wo ich anfangen und wie ich da wieder rauskommen soll.
So intensiv ich auch recherchiere, es scheint keinen Leitfaden zu geben, der sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praktisch in meiner aktuellen Situation für mich handhabbar und umsetzbar ist. Ein bekanntes Sieben-Säulen-Modell zum Beispiel mag gerechtfertigt sein. Doch was bedeutet das für mich akut? Säulen existieren nebeneinander, in einer Art simultaner Existenz. Aber ich befinde mich im Krankenhaus und über mir hängt wie ein Damoklesschwert – oder passender: wie ein chirurgisches Skalpell – eine drohende Amputation. Jederzeit könnte ein Arzt mir mitteilen, dass sich meine medizinischen Werte verschlechtert haben und ich mein Bein doch verlieren werde. Unter diesen Umständen kann ich nicht einfach, so wie es die Säulen vorschlagen, optimistisch sein, die volle Kontrolle und Verantwortung übernehmen und aktiv meine Zukunft gestalten – und das alles gleichzeitig. Kein theoretisches Konzept bietet für mich eine befriedigende Antwort auf diese eine einfache, doch entscheidende Frage: Wie soll ich diese Scheiße bewältigen? Wo soll ich überhaupt anfangen? Je tiefer ich mich in dieser Thematik vergrabe und je länger keine der literarisch-theoretischen Quellen zufriedenstellende Antworten bieten, desto mehr scheint die Dunkelheit um mich herum zuzunehmen.
Ich komme zu der Erkenntnis: Es gibt eine Vielzahl von Büchern und Publikationen über Resilienz und das Überwinden von Krisen – doch im Notfall praktisch anwendbar sind diese für mich nicht. Manche davon zielen nicht einmal darauf ab, als Ratgeber zu dienen. Für den gewöhnlichen, von Krisen betroffenen Menschen sind sie viel zu theoretisch und akademisch überladen. Andere Werke bieten trügerische Hoffnungen, versprechen schnelle, mühelose Lösungen und lassen jegliche wissenschaftliche Fundiertheit oder den Blick auf die harte Realität vermissen. Als ich meinem Vater davon berichte, meint er nur: »Dokumentier alles. Schreib deine Gedanken nieder und kreier selbst eine Methode, die tatsächlich Unterstützung bietet. Wenn sie auch nur einer Person hilft, hat es einen Sinn.« Also mache ich mich auf die Suche nach einzelnen Techniken und Ansätzen, die ich selbst zu einer Methode zusammenfüge. Sie muss praktisch sein, umsetzbar, sie muss Lösungen bieten, statt nur noch mehr Fragen aufzuwerfen. Und sie muss auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und tragfähig sein.
Zu Beginn dieser Ausarbeitung ist mir nicht klar, wie groß der Bedarf für so ein Konzept wirklich ist. Hand aufs Herz: In erster Linie geht es mir an diesem Punkt um mein eigenes Seelenheil. Ich will einfach verstehen und einen Weg aus diesem Dilemma finden. Schon bald merke ich aber, dass ich wirklich helfen kann. Denn die Ausgangslage ist erschreckend: Nahezu jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens mit mindestens einer schweren Krise konfrontiert. Das Leben ist voll von potenziell traumatisierenden Ereignissen für uns. Aktuell berichten 40 Prozent der erwachsenen Österreicher über Anzeichen von Burnout.1 Laut Untersuchungen gelten bereits acht Prozent als psychisch krank. Fast ein Viertel aller Deutschen gibt an, in den vergangenen zwölf Monaten psychische Probleme durch Stress gehabt zu haben. 27 Prozent der Befragten hatten im gleichen Zeitraum depressive Phasen, zwölf Prozent klagten gar über Panikattacken.2 Nach einem aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind derzeit etwa 280 Millionen Menschen weltweit von Depressionen betroffen, was nicht nur zu individuellem Leid, sondern auch zu erheblichen negativen sozioökonomischen Auswirkungen führt. In den USA ist Depression die häufigste Ursache für langfristige Erwerbsunfähigkeit, während sie in Europa an dritter Stelle steht. Laut Prognosen der WHO werden affektive Störungen bis zum Jahr 2030 weltweit die höchste Anzahl an sogenannten Disability-adjusted Life Years (DALYs), also Jahren mit krankheitsbedingten Einschränkungen, verursachen, noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gefäßerkrankungen des Gehirns.3 Krisen wie die Coronapandemie und der sich zuspitzende Klimawandel tragen zusätzlich dazu bei, dass psychische Erkrankungen auf dem besten Wege sind, zur Volkskrankheit zu werden. Personen, die unter diesen Störungen leiden, erleben sie oft über längere Zeiträume – Wochen, Monate oder sogar Jahre.
Du musst keinen Skiunfall erfahren und dabei fast dein Bein verlieren, um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Resilienz und Strategien zur Bewältigung von Rückschlägen sind nicht nur in schweren Lebenskrisen hilfreich, sondern können auch bei alltäglichen Hürden im Beruf und in Beziehungen sowie präventiv eingesetzt werden, um stressbedingten Erkrankungen wie Burnout oder Depression vorzubeugen. Raffael Kalisch, ein deutscher Neurowissenschaftler, Psychologe und Gründungsmitglied des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung (LIR) an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, beschreibt in seinem Buch Der resiliente Mensch4 Resilienz als »die Aufrechterhaltung oder schnelle Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während und nach Widrigkeiten«. Über Monate hinweg setze ich mich intensiv mit der Theorie dieser Aufrechterhaltung und schnellen Wiederherstellung der psychischen Gesundheit auseinander. Ich versuche, diese Informationen mit meinen eigenen Erfahrungen während der schwierigsten Zeit meines Lebens und meinem Know-how aus dem Spitzensport zu verweben. Die Herausforderung besteht dabei darin, diese wichtigen theoretischen Erkenntnisse praxistauglich und in den Alltag von uns allen integrierbar zu machen. Die große Frage lautet also: Wie kann ich Menschen helfen – sowohl mir selbst als auch anderen?
Ich sage gleich zu Beginn: Es gibt kein Patentrezept, um Krisen schadlos zu überstehen. Es gibt keinen einfachen Trick und keine »Quick-Fix-Lösung«, um einem mentalen Rückschlag schnell und mühelos zu entkommen und wieder zu erstarken. Jede Krise läuft auf ihre eigene Art ab. Keine ist wie die andere. Auch die Schweizer Psychotherapeutin Verena Kast, Expertin für Trauer und Trauma, unterstreicht die individuelle Natur der Krisenbewältigung.5 Sie erklärt, dass dieser Prozess dynamisch ist und Zeit benötigt. Das ist wichtig zu begreifen. Nichts passiert von heute auf morgen. Und sollte die Besserung ins Stocken geraten, kann und soll sie durch externe Unterstützung wie Therapieangebote und das soziale Umfeld positiv gestaltet werden. Dazu aber später mehr.
Obwohl es kein Patentrezept gibt, habe ich jedoch meinen Weg aus der Krise gefunden – und diesen will ich dir zeigen. Dieses Buch soll dir dazu als Leitfaden dienen, dir erklären, wo du beginnen kannst, und dir eine Richtung weisen. Ich erkläre dir, was für mich funktioniert hat – basierend auf einer Vielzahl wissenschaftlicher Erkenntnisse. Denn es gibt viele theoretische Bücher zu diesem Thema, aber keines, das aus der Verbindung von Wissenschaft und persönlicher Erfahrung ein im Alltag gut anwendbares Konzept macht. Und genau das ist mein Weg. Mein Weg aus der Krise zurück ins Leben. Er soll aber nicht vergleichen, nicht werten. Denn wie bereits erwähnt, sind Krisen individuell. Oder, um es mit einem berühmten Zitat zu sagen, das oft dem US-amerikanischen Schauspieler Robin Williams zugeschrieben wird: »Wir müssen verstehen, dass jede und jeder in einer eigenen Schlacht kämpft, von der wir nichts wissen. Lasst uns also nett zueinander sein. Immer.«
Ich will dir mit diesem Buch ein kleines Stück Hoffnung schenken. Bestimmt dient es aber nicht als Allheilmittel und ich empfehle dir – je nachdem, wie schwer deine persönliche Krise ist –, dich unbedingt professionell unterstützen zu lassen. Meine gesammelten Erkenntnisse sind das solide Fundament dieses Buches. Auf ihnen baut der Weg raus aus dem tiefen Tal und zurück zum Gipfel auf. Dieser Aufstieg steht sinnbildlich für jede Lebenssituation, in der wir uns an einem Tiefpunkt befinden und uns wieder nach oben kämpfen wollen, und hat fünf Schritte. Ich hoffe natürlich, dass du sie nie gehen musst. Aber falls doch, falls du gerade jetzt in einer Krise steckst, oder jemanden in deinem Umfeld kennst, der eine schwierige Zeit durchmacht, und dich dieses Buch deshalb gefunden hat, soll es dir die Richtung weisen.
Es ist in zwei Hauptteile gegliedert und bietet dir eine Mischung aus fundiertem Wissen, persönlichen Einblicken und einer metaphorischen Wanderung in neue Höhen. Zunächst werfen wir einen Blick auf wissenschaftliche Grundlagen: Was passiert in uns, wenn wir in eine Krise geraten? Welche Mechanismen wirken in unserem Körper und Geist? Dieser Abschnitt hift dir, die oft komplexen Prozesse besser zu verstehen. Danach beginnen wir gemeinsam den Weg nach oben. Jeder der fünf Schritte steht für eine Phase der Krisenbewältigung, wie die einzelnen Abschnitte einer Bergtour, die uns sicher aufwärts und über Hindernisse hinweg führen. Alle fünf Etappen enthalten praxisnahe Übungen und Impulse, die dich in der jeweiligen Phase unterstützen sollen. Die erste Hürde hast du schon allein genommen. Ab sofort gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam.
»Inmitten vonSchwierigkeiten liegen oft Möglichkeiten.«
ALBERT EINSTEIN,PHYSIKER UND NOBELPREISTRÄGER
WAS IST EINE KRISE?
Bevor wir zu unserer gemeinsamen Wanderung aufbrechen, sollten wir zusammen ein Verständnis von Krisen erarbeiten. Denn sie sind ein unvermeidlicher Bestandteil unseres Lebens – und zwar jedes Lebens – und können jede und jeden von uns jederzeit treffen. Krisen treten sowohl individuell als auch kollektiv auf und reichen von alltäglichen Herausforderungen bis hin zu globalen Katastrophen. Ein Überblick über die verschiedenen Formen von Krisen und die wissenschaftlichen Hintergründe wird uns helfen, das Thema besser zu verstehen, um schlussendlich gut mit schwierigen Situationen umzugehen und Strategien zu entwickeln, diese erfolgreich zu bewältigen.
Eines gleich vorweg: Irgendwann auf diesem Weg wird es wichtig für dich, zu erkennen, dass Krisen nicht nur Herausforderungen darstellen, sondern auch Chancen für Entwicklung bieten können. Das willst du im Angesicht einer akuten Krise vermutlich gerade nicht hören. Ging mir genauso. Aber schenk mir ein wenig Vertrauen und wir tasten uns langsam voran.
Das Wort »Krise« stammt aus dem Griechischen und wird vom Begriff krísis (κρίσις) abgeleitet. Im ursprünglichen Sinn bedeutete krísis eine Entscheidung oder einen Wendepunkt. Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung erweitert und umfasst heute allgemein einen schwierigen oder entscheidenden Umstand, der oft eine Anpassung in unserem Alltag oder in unserem Leben erfordert und mit großer Unsicherheit und emotionalem Stress einhergeht. Krisen können als externe oder interne Ereignisse auftreten, die das Gleichgewicht eines Individuums, einer Gruppe oder einer Gesellschaft stören. Aus psychologischer Sicht definierte der Psychiater und frühere Professor an der Harvard School of Public Health Gerald Caplan eine Krise als einen Zustand, in dem eine Person die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, nicht mit den üblichen Bewältigungsmechanismen, die ihr zur Verfügung stehen, meistern kann. Krisen erfordern also häufig neue Strategien und Lösungsansätze, um erfolgreich überwunden zu werden. Dazu ist ein gewisses Basiswissen im Verarbeitungsprozess genauso hilfreich wie ein wenig Handwerkszeug, das bei der Bewältigung dieser Situationen hilft. Zuallererst ist es aber wichtig, die verschiedenen Arten von Krisen zu verstehen.
ARTEN VON KRISEN
Die Einteilung von Krisen in verschiedene Kategorien erfolgt üblicherweise abhängig von ihrem Ursprung und ihrer Natur. Eine Hauptkategorie ist die individuelle Krise, die das Leben einzelner Personen tiefgreifend beeinflussen kann. Durch lebensverändernde Ereignisse wie Todesfälle, schwere Verletzungen oder andere Krankheiten und Unfälle müssen die Betroffenen mit schwerwiegendem Verlust oder Schmerz und Veränderungen umgehen. Solche Ereignisse können zu Trauer und Depression bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.6 Aber auch »alltägliche« Herausforderungen wie Beziehungsprobleme und berufliche Unsicherheiten erzeugen erheblichen Druck und erfordern effektive Bewältigungsstrategien, da chronischer Stress zu Burnout und gesundheitlichen Problemen führen kann.7 Übergangsphasen im Leben wie Pubertät, Midlife-Crisis und Ruhestand bringen ebenfalls oft Schwierigkeiten mit sich. Diese Phasen sind aber laut dem Psychoanalytiker Erik Erikson auch entscheidend für die gesunde Reifung und Entwicklung von Menschen, da sie spezifische Aufgaben beinhalten, in deren Lösung großes Potenzial verborgen liegt.8
Neben individuellen Krisen gibt es auch kollektive oder globale Krisen, die Gemeinschaften, Gesellschaften oder sogar die Welt im Gesamten betreffen. Diese zu lösen, ist an dieser Stelle nicht unser Ziel, denn dazu braucht es mehr als die individuelle Anstrengung Einzelner. Dennoch sollen sie nicht unerwähnt bleiben, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Nehmen wir als Beispiel die Klimakrise: Sie hat weitreichende Auswirkungen auf Ökosysteme und uns Menschen. Der Klimawandel führt zu extremen Wetterereignissen, dem Anstieg des Meeresspiegels und einem massiven Verlust an Biodiversität, was bei Menschen wiederum sowohl psychische als auch physische Gesundheitsprobleme verursachen kann. Aber nicht nur der Klimawandel ist eine kollektive Krise: Wirtschaftskrisen wie jene von 2008 zeigen, wie finanzielle Turbulenzen zu weitreichender Arbeitslosigkeit, Armut und sozialen Unruhen führen können, wodurch das Vertrauen in Institutionen und Märkte erschüttert wird. Politische und soziale Krisen wie Konflikte, Kriege und Unruhen verursachen humanitäre Notlagen, Vertreibungen und langfristige psychische Traumata.9 Ein aktuelles Beispiel hierfür ist auch die Covid-19-Pandemie, die weltweit Millionen von Menschenleben forderte, Gesundheitssysteme überlastete und weitreichende wirtschaftliche und soziale Störungen verursachte. Die Pandemie führte weiters zu massiven psychischen Belastungen, Isolation und Unsicherheit.10





























