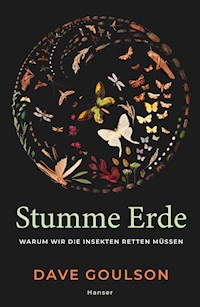Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der britische Biologe Dave Goulson unternimmt eine Expedition auf den Planeten der Insekten – genauer auf die Blumenwiesen rund um sein marodes französisches Landhaus. Die Helden seiner Feldforschungsabenteuer sind nicht nur Bienen und Hummeln, sondern alles, was kreucht und fleucht: Grillen, Grashüpfer, Glühwürmchen – und Libellen, denen beim Liebemachen zuzusehen eine Freude ist. Goulson taucht dabei so tief ins Reich der Tiere ein wie kaum jemand zuvor. Ein Buch, das die entscheidende Bedeutung von Insekten für unsere Umwelt und das ganze globale Ökosystem beleuchtet. Und ein Weckruf, die Nutzung von Insektiziden zurückzufahren, um das Sterben der Bienen und anderer Bestäuber zu stoppen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dave Goulson
Wenn der Nagekäfer zweimal klopft
Das geheime Leben der Insekten
Aus dem Englischen von Sabine Hübner
Titel der Originalausgabe:
A Buzz in the Meadow
London, Jonathan Cape 2014
Alle Zitate in diesem Buch wurden von Sabine Hübner selbst übersetzt, sofern nicht auf eine andere Übersetzung verwiesen wurde.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Copyright © Dave Goulson 2014
Dave Goulson has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 to be identified as the author of this work
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© 2016 Carl Hanser Verlag München
www.hanser-literaturverlage.de
Herstellung: Thomas Gerhardy
Umschlaggestaltung unter Verwendung des Designs von James Jones und Illustrationen von © Louise Bird
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media, Krugzell
ISBN 978-3-446-44700-4
E-Book-ISBN 978-3-446-44708-0
Inhalt
Prolog
Teil IGeschichten von der Wiese
1 Ein Wiesenspaziergang
2 Das Insektenimperium
3 Bei den Molchen
4 Das Paarungsrad und sexueller Kannibalismus
5 Schmutzige Fliegen
6 Das geheime Leben des Großen Ochsenauges
7 Papierwespen und wandernde Hummeln
8 Das Paarungsverhalten des Gescheckten Nagekäfers
9 Die Hemiptera
Teil IIDas komplexe Gewebe der Lebensformen
10 Treibhausblumen
11 Klappertopf und Nektardiebe
12 Besudelte Lichtnelkenblüten
Teil IIIDie Auflösung des Gewebes
13 Das Verschwinden der Bienen
14 Die Inseln der Inzucht
15 Rapa Nui
Epilog
Dank
Für Lara
Prolog
Im Jahr 2003 kaufte ich mitten im ländlichen Frankreich ein baufälliges Gehöft mit 13 Hektar Wiesenfläche. Mein Ziel war es, einen geschützten Lebensraum für Tiere zu schaffen, in dem Schmetterlinge, Libellen, Wühlmäuse und Molche gedeihen konnten, frei von der Belastung durch die moderne Landwirtschaft. Vor allem ging es mir um ein Habitat für meine geliebten Hummeln, deren Erforschung und Schutz ich mich seit zwanzig Jahren verschrieben habe. Und so handelt mein Buch auch von diesem kleinen Fleckchen Erde im ländlichen Frankreich, von den dortigen Pflanzen und Tieren und ihrer naturgeschichtlichen Entwicklung, und von meinen Bemühungen, sie zu schützen und zu erhalten. Die meisten Naturdokumentationen und ein Hauptteil der Artenschutzmaßnahmen konzentrieren sich ja auf große, charismatische Tiere wie Wale, Pandas oder Tiger. Darum möchte ich mit diesem Buch auch all den kleineren Tieren, von denen wir täglich umgeben sind, zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen – den zahlreichen Insektenfamilien. Der Zufall will es, dass ich viele der Insekten- und Blumenspezies, die in meiner Wiese heimisch geworden sind, im Laufe meiner wissenschaftlichen Karriere selbst jahrelang erforscht habe. Von dieser Forschungsarbeit, die das geheime Leben der Blumen und Insekten erkundet, möchte ich hier erzählen. Unter anderem werden Sie erfahren, wie der Gescheckte Nagekäfer seine Partnerin findet, wie wichtig Fliegen sind, wieso manche Blumen den Hummeln und Bienen als Wärmedecken dienen und welchen komplexen Regeln das Zusammenleben in einem Papierwespenstaat gehorcht. Vielleicht kann ich Ihnen durch diese Geschichten etwas von der Entdeckerfreude und Befriedigung vermitteln, die man empfindet, wenn man sich intensiv mit dem Leben all der Tiere befasst, mit denen wir unseren Planeten teilen. Noch wichtiger ist mir jedoch: Ich möchte Ihnen vermitteln, dass alles, was wir über Naturkunde wissen, nur die Spitze des Eisbergs ist. Allein schon meine Wiese in Frankreich birgt eine schier unendliche Zahl faszinierender Geheimnisse, die noch der Aufklärung harren, Tiere, die noch niemand erforscht, Verhaltensweisen, die noch niemand beobachtet hat. Welche Wunder mag es da noch zu entdecken geben?
Im zweiten Teil des Buchs möchte ich zeigen, wie die tierischen und pflanzlichen Lebensformen dieser Wiese auf vielfache Weise miteinander verbunden sind. Pflanzen konkurrieren um Raum, Wasser und Licht, dienen Herbivoren als Nahrung und beherbergen Parasiten und Krankheitserreger. Sie verfügen über diverse Strategien, Bestäuber anzulocken, und diese wiederum haben zahllose Tricks entwickelt, um zu erkennen, welche Blumen am lohnendsten sind und wie man diese Belohnung ohne Gegenleistung kassieren kann. Manchmal läuft das aber auch umgekehrt, und sie werden von den Pflanzen übertölpelt, sodass sie sie bestäuben, ohne für ihren Aufwand entlohnt zu werden. Pflanzen sind darauf angewiesen, dass eine Vielzahl kleiner Tiere und Mikroorganismen Blätter und Dung zersetzen und die darin enthaltenen Nährstoffe freisetzen. Sie profitieren davon, dass Raubvögel, Spinnen und Insekten Unmengen von Raupen, Heuschrecken und Blattläusen vertilgen, die ihre Blätter bedrohen. Jede einzelne Spezies ist in einem Netz von Wechselwirkungen mit Hunderten anderer Spezies verknüpft – und wir sind noch weit davon entfernt, all diese Wechselwirkungen wirklich zu verstehen.
Unsere moderne Welt wurde für wild lebende Tiere im Lauf der Zeit zu einem immer unwirtlicheren Ort. Im Schlussteil werde ich erläutern, wie es dazu kommen konnte und was unser Drang, den Agrarflächen immer größere Erträge abzupressen, damit zu tun hat. Die Verheerungen, die wir auf unserem Planeten angerichtet haben – und weiterhin anrichten –, möchte ich an einigen Beispielen demonstrieren. Welche Folgen hatte es, dass sich der prähistorische primitive Mensch von Afrika aus über die ganze Welt verbreitet hat? Und schließlich werde ich auf die schleichenden Schäden zu sprechen kommen, die der maßlose Einsatz giftiger Chemikalien in der Landwirtschaft unserer Umwelt zufügt. Durch unser Handeln verschwinden viele faszinierende Tiere – oft sogar bevor wir überhaupt etwas von ihrer Existenz und ihrer Funktion in den komplexen ökologischen Zusammenhängen ahnen. Dieses Buch ist als Weckruf gedacht, als Erinnerung daran, dass wir das Leben auf dieser Erde in all seinen Formen und Facetten hegen und bewahren sollten. Wird eine Spezies ausgelöscht, geht ihr Geheimnis für immer verloren. Wir zerstören das Erbe unserer Kinder und berauben sie der Freude, die Natur zu entdecken und zu erforschen. Darüber hinaus untergraben wir unsere eigenen Lebensgrundlagen; denn obwohl wir noch sehr wenig über das Beziehungsgeflecht wissen, das alle Lebewesen verbindet, gibt es klare Beweise dafür, dass diese Wechselwirkungen für das Fortbestehen des Planeten Erde und somit auch für unser eigenes Wohlergehen, ja unser schieres Überleben, unabdingbar sind.
Ich wünsche mir, dass Sie die Welt mit neuen Augen betrachten; ich wünsche mir, dass Sie in Ihren Garten oder einen öffentlichen Park gehen und sich auf Hände und Knie niederlassen. Es gibt so viel zu sehen! Schauen wir doch einmal ganz genau hin, dann werden wir die verborgenen Herrlichkeiten des Lebens auf unserem Planeten Erde erkennen. Wenn wir das, was wir haben, wertzuschätzen lernen, finden wir vielleicht auch einen Weg, es zu bewahren.
Teil IGeschichten von der Wiese
Wir bewohnen einen kugelförmigen Felsbrocken mit einem Durchmesser von nur 13 000 Kilometern, der in den unvorstellbaren Weiten des Alls schwebt. Die Entfernung zum nächsten Planeten, auf dem es möglicherweise Leben geben könnte, beträgt mindestens 10 000 Milliarden Kilometer, eine Distanz, die unsere menschliche Vorstellungskraft bei Weitem übersteigt. Wir investieren viel Zeit und Mühe in die Konstruktion von Teleskopen, mit denen wir immer weiter in den leeren Raum vordringen, wir werden nicht müde, Radiowellen aus fernen Galaxien aufzufangen und zu analysieren, in der Hoffnung, Hinweise auf andere Lebensformen zu entdecken. Viele Filme, Fernsehserien und Romane spekulieren darüber, was es dort draußen geben könnte. Dabei müssten wir gar nicht in die Ferne schweifen. Auch hier auf der Erde sind wir von den Wundern des Universums umgeben – doch schenken wir ihnen kaum Beachtung. Wir haben das Glück, unseren kleinen Felsbrocken mit etwa zehn Millionen verschiedenen Spezies teilen zu dürfen, von denen viele noch nicht einmal benannt sind.
Ich bin stolzer Besitzer einer kleinen Wiese im ländlichen Frankreich. Man könnte mich als das entomologische Pendant eines Trainspotters bezeichnen, denn mittlerweile habe ich in dieser Wiese über siebzig Bienen- und Hummelspezies, fünfzig Schmetterlingsspezies, sechzig Vogelarten und weit über hundert verschiedene Pflanzen identifiziert. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil des großen Ganzen; zu einer Bestandsaufnahme all der Springschwänze, Milben, Würmer, Spinnen, Käfer, Schnecken und anderen Lebewesen bin ich noch gar nicht gekommen und werde aller Wahrscheinlichkeit nach auch nie Zeit dafür haben. Die Lebewesen, die wir ignorieren, sind meist sehr klein, manche so winzig, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Macht man sich aber einmal die Mühe, eine dieser winzigen Kreaturen unter ein Mikroskop zu legen, erkennt man ihre exakte Symmetrie, ihre fein gegliederte Struktur. Jedes einzelne dieser Lebewesen hat eine eigene Lebensgeschichte; es muss Futter finden, wachsen, vor Fressfeinden fliehen, einen Paarungspartner finden, Eier legen usw. Jeder Schritt ist mit Herausforderungen verbunden, mit Hindernissen, die überwunden werden müssen, und jede Spezies hat ihre ganz eigenen, einzigartigen Strategien entwickelt, um zu überleben und zu gedeihen. Hätten sie das nicht, wären sie schon längst vom Erdboden verschwunden. Selbst in Westeuropa, wo das Studium der Naturgeschichte eine lange Tradition hat, wissen wir noch immer viel zu wenig über das Leben dieser wild lebenden Tiere.
In diesem Teil des Buchs möchte ich Ihnen einige der Insekten und anderen kleinen Tiere vorstellen, die in meiner Wiese leben und zumindest ansatzweise erforscht sind. Auch werde ich Ihnen etwas über einige ihrer Verwandten erzählen, die in exotischeren Klimazonen leben. Sie werden faszinierende Details über das Verhalten dieser Tiere erfahren, über ihre Lebensweise und ihre Rolle in unserem Ökosystem. Und schließlich möchte ich von meinem Versuch erzählen, auf meinem kleinen Stück Land in Frankreich möglichst viele Arten heimisch zu machen. Willkommen auf der Wiese!
Ein Wiesenspaziergang
24. April 2007. Morgendliche Laufzeit: 9,5 Kilometer in 42 Minuten 2 Sekunden. Wie immer hier in Frankreich auf dem Land begegnete ich keiner Menschenseele; dafür bellten mich fünf Hunde an; sie sind Jogger nicht gewohnt. Ein schöner kühler Morgen, klarer blauer Himmel, das Gras mit dicken Tautropfen bedeckt, die Wallhecken voller Schlüsselblumen. Zahl der gesichteten Schmetterlingsspezies: sechs – ich lenkte mich von den Schmerzen beim Laufen dadurch ab, dass ich Arten bestimmte, ohne stehenzubleiben. Das Gleiche habe ich auch schon mit Hummeln probiert, aber die sind beim Laufen schwieriger zu identifizieren. Zur heutigen Schmetterlingsausbeute gehörten ein Faulbaum-Bläuling und ein männlicher Zitronenfalter, dessen schwefelgelbe Flügel in der Sonne leuchteten. Auch ein Grünspechtpärchen scheuchte ich auf, das auf dem Weg am obersten Feld entlang mit Einemsen beschäftigt war, zweifelsfrei zu erkennen am aufgeregten Glük-Glük-Glük und dem wellenförmigen Flug. In jedem Gehölz, das ich passierte, zwitscherten Zaungrasmücken, ein melodisch dahinströmender Gesang. Die Paarungszeit ist voll im Gange – auch jetzt, während ich auf der Gartenbank neben der Haustür sitze und Schweiß auf meine Notizen tropft, höre ich das Gezwitscher immer noch aus allen Richtungen.
65 Kilometer nordwestlich von Limoges, in der Nähe des hübschen romanischen Örtchens Confolens an der Vienne, steht ein altes Bauernhaus. Etwa in der Mitte einer gedachten Nord-Süd-Linie und etwa 110 Kilometer von der Westküste entfernt zum Landesinneren hin, liegt das Gehöft in der Charente, einem großen, verschlafenen Département mit Eichenwäldern, rostroten Limousin-Rindern und Sonnenblumenfeldern – eine hügelige Landschaft, durch die träge der Fluss Charente mäandert. Das Haus wurde vor ungefähr 160 Jahren erbaut, wohl von einem gewissen Monsieur Nauche, der dem Anwesen auch seinen Namen gab, Chez Nauche. In dieser Region gibt es viele prächtige Bauernhäuser aus behauenem Naturstein, mit drei oder mehr Stockwerken und hohen, symmetrisch zu beiden Seiten eines imposanten Haupteingangs angeordneten Fensterreihen. Chez Nauche gehört nicht dazu. Seine dicken Mauern bestehen aus unbearbeitetem Kalkstein, ungleich großen Felsbrocken voller Fossilien, die man wohl aus den umliegenden Feldern ausgegraben hat. Statt mit Mörtel sind die Steine mit orangefarbenem Lehm verfugt, der gleichfalls dem hiesigen Boden entstammt. Die Wände haben sich über die Jahre verschoben und neigen sich einander in abenteuerlichen Winkeln zu. Die meist kleinen, in unregelmäßigen Abständen eingelassenen Fenster besitzen Laibungen aus verwitterten Eichenbalken; alte Holzläden, von denen die Farbe abgeblättert ist, hängen lose in den Angeln. Das langgestreckte, nach Süden ausgerichtete Haus ist niedrig und gedrungen; es wurde so entworfen, dass sich alle Wohnräume im Erdgeschoss befanden, was dem Grundriss der meisten einfachen Bauernhäuser hier in der Gegend entspricht. Der riesige Dachboden diente zur Aufbewahrung von Heu, das gleichzeitig isolierende Wirkung besaß und die Bewohner im Winter vor Kälte schützte. Die Decken zwischen Wohnbereich und Heuboden bestehen aus dicken Planken, die auf massiven quadratischen Balken ruhen. Das Holz stammte vorwiegend von den Eichen der Umgebung, von Hand zugesägt, und tatsächlich kann man an den Balken auch heute noch die Sägespuren erkennen. Es muss eine Herkulesaufgabe gewesen sein, ein solches Haus zu bauen, auch wenn dadurch so gut wie keine Materialkosten anfielen.
Die Herstellung von Eichenbalken lief folgendermaßen ab: Man suchte in der Nähe einen möglichst ebenmäßig gewachsenen Baum und fällte ihn. Dann hob man unter dem Stamm eine Grube aus, tief genug, dass ein Mann darin liegen konnte, und zersägte den Stamm mithilfe einer riesigen Zweimannsäge in Vierkantbalken; dabei lag einer der Männer in der Grube und bekam den ganzen Sägestaub ins Gesicht, während der andere auf dem Baumstamm stand. Am Ende schleppte ein Pferd den fertigen Balken zum Haus, wo man ihn mithilfe von Seilen emporwand und in die richtige Position wuchtete.
Auch die Terrakotta-Dachziegel wurden aus Lehm gebrannt, der aus dem Umland stammte. Ihr typisches Aussehen geht auf die Römer zurück. Sie werden auch Klosterziegel genannt und abwechselnd in Reihen konvexer (»Mönche«) und konkaver Dachziegel (»Nonnen«) verlegt. Monsieur Nauche hat sie aber wohl kaum selbst gebrannt, sondern in einer Ziegelbrennerei gekauft. So zählen diese Ziegel zwar zu den wenigen größeren Anschaffungen, die er tätigen musste, stammten aber immerhin aus einem Betrieb in der Nähe. Ansonsten wurden das ganze Gebäude und die angrenzenden Scheunen aus Materialien erbaut, die sich kostenlos vor Ort gewinnen ließen, was den Gebäuden ein natürliches, organisches Flair verleiht, fast so, als seien sie aus dem Boden geschossen wie seltsame rechteckige Pilze.
Ich habe Chez Nauche im Jahr 2003 gekauft, von einem alten Bauern namens Monsieur Poupard. Wenn ich ihn mit meinen dürftigen Französischkenntnissen richtig verstanden habe, hat er dort sein ganzes Leben verbracht, Milchkühe gehalten und Landwirtschaft betrieben. Weit über sechzig Jahre alt und ohne Kinder, denen er das Gehöft hätte hinterlassen können, beschloss er, es zu verkaufen und in den Ruhestand zu gehen. Da er sich nie wirklich um das Anwesen gekümmert hatte, war es ziemlich zerfallen. Das Dach leckte, die Holzbalken rotteten vor sich hin, die alte Tünche hatte schwarze Schimmelflecken und schälte sich von den Wänden. Die Fensterrahmen waren verfault, die geborstenen Glasscheiben mit alten Plastikplanen bedeckt und die modrigen Stellen unten an der Haustür mit plattgehämmerten Konservendosen vernagelt. Die sanitären Einrichtungen beschränkten sich auf einen alten, tropfenden Wasserhahn über einem steinernen Ausguss – es gab weder Bad noch Dusche, und die Toilette bestand aus einem Eimer im Schuppen.
Obwohl das Ganze also, gelinde gesagt, renovierungsbedürftig war, besaß es für mich, den von der Tierwelt faszinierten Biologen, trotz aller Mängel eine enorme Anziehungskraft. Durch Monsieur Poupards Nachlässigkeit wimmelten das Haus und die angrenzenden Gebäude von Leben. Viele stolze Hausbesitzer im heutigen Großbritannien reagieren entsetzt, wenn sie eine Assel auf dem Teppich oder eine Ameise in der Küche entdecken. Von dieser Furcht sollte man sich in Chez Nauche schleunigst verabschieden, sonst ist ein Nervenzusammenbruch vorprogrammiert. Das Haus ist über die Jahrzehnte praktisch mit seiner Umgebung verschmolzen. Und obwohl ich in den zehn Jahren seit dem Kauf einiges instand gesetzt habe, ist das Haus auch heute noch ein Zufluchtsort für unzählige Pflanzen und Tiere – die Dachziegel sind mit orangefarbenen, schwarzen und cremefarbenen Flechten überkrustet, auf denen Raupen weiden. In den Rinnen zwischen den Ziegeln wächst Moos, vor allem auf der Nordseite des Hauses, und in den feuchten grünen Kissen wuseln zahllose Tausendfüßler, Asseln, Bärtierchen1 und andere kleine Insekten herum. Auch die Mauern sind mit Flechten überwuchert und vom üppigen Laub wilden Weins bedeckt, der sich an einem rostigen Spalier emporrankt. Wenn die Sonne scheint, was hier oft der Fall ist, wärmen sich dort gern Schmetterlinge, Hummeln, Bienen und Fliegen auf, bevor sie sich auf Partner- oder Nektarsuche begeben. Diese Insekten werden von schwarz-weiß gestreiften Springspinnen und braun-grün gefleckten Eidechsen gejagt, flinken Tieren mit langen, klauenbewehrten Zehen, die in unglaublichem Tempo senkrecht an den Wänden emporflitzen und beim geringsten Zeichen von Gefahr blitzschnell in Löchern im weichen Lehmmörtel verschwinden. Die meisten Fluginsekten sind zu schnell, um sich fangen zu lassen, vor allem, wenn es ihnen gelingt, warm und startklar zu bleiben. Doch wenn sie sich dann in der Luft befinden, werden sie zur leichten Beute der Schwalben, die in den Scheunen nisten und in geringer Höhe an den Gebäuden entlangsegeln. Vor dem Haus sprießen alte Lavendelbüsche, deren verdrehte, verholzte Stängel sich unter dem Gewicht purpurner Blüten neigen. Es umtanzen sie Hummeln, Schmetterlinge und, mit schwirrenden Flügeln, Taubenschwänzchen, die ihre langen gekrümmten Rüssel in die Nektarien der Blumen tauchen.
Ein alter gepflasterter Pfad führt zur Eingangstür. In den Ritzen zwischen den warmen Steinen wohnen die kugelköpfigen Feldgrillen, unablässig hört man den fröhlichen Lockgesang der Männchen. Auch Eidechsen und junge gelbgrüne Zornnattern nutzen die Spalten, um dort Käfer und Spinnen zu jagen. Vor dem Haus stehen ein paar uralte, knorrig-gebeugte Nektarinen- und Pflaumenbäume, von deren Blättern sich die dicken grünen Raupen des seltenen Schwalbenschwanzes ernähren. Auf manchen Ästen wachsen Baumpilze. Grüne Laubheuschrecken thronen auf den Zweigen, von wo aus die Männchen versuchen, mit ihrem endlosen rauen Gesäge den Gesang der Grillen zu übertönen.
Im kühlen Dunkel des Hauses, wo das Zirpen der Grillen nur noch als fernes Summen zu vernehmen ist, wimmelt es von dämmerungsaktiven Lebewesen, darunter zahllose Spinnenarten. Spindeldürre Weberknechte spinnen nachlässig bizarre Netze zwischen den alten Balken, von denen sie kopfüber herabhängen, während riesige Hauswinkelspinnen, Tegenaria domestica, dichte trichterförmige Gespinste weben, die in tiefe Wohnhöhlen führen, ideale Verstecke. Die Holzbalken ihrerseits sind mit Tunneln durchzogen, angelegt von den fetten weißen Larven der solitären Langhornbiene und des Gescheckten Nagekäfers, oder auch von Holzwürmern, die in Wirklichkeit gar keine Würmer, sondern winzige Käfer sind. Unter den Möbeln und in Küchenschränken lauern satinschwarze Schwarzkäfer, die sich gravitätisch langsam fortbewegen; sie sind so schwer bewaffnet, dass sie Eile gar nicht nötig haben.
Nachts übernehmen die Mäuse das Regiment; Hausmäuse huschen über den Boden, gelegentlich auch die stattlichere, großäugige Waldmaus. Sie suchen nach Essensresten, schmackhaften Spinnen oder tagaktiven Insekten, die sich ins Haus verirrt haben und nicht mehr ins Freie finden. Über Mauern und Balken trippeln Bilche: Gartenschläfer mit ihrer feinen, waschbärartigen Gesichtszeichnung und dem langen Schwanz, der in einer flauschigen Spitze endet; aber auch der seltene essbare Siebenschläfer, der von den Römern als Delikatesse geschätzt wurde. So süß sie aussehen mögen, die Gartenschläfer sind aggressive kleine Biester, die sich nachts mit zittrigen Rufen verständigen und mich oft durch ihr lärmendes Gebalge wecken. Weil sie so lästig sind, habe ich Dutzende von ihnen gefangen; sie stehen total auf Cantal, einen pikanten Hartkäse aus den Bergen der Auvergne, auf diesen Köder sind sie bis jetzt noch jedes Mal hereingefallen. Als meine beiden ältesten Jungs, Finn und Jedd – damals etwa sieben und fünf Jahre alt –, zum ersten Mal einen dieser Gartenschläfer erblickten, der sie wütend aus der Falle heraus anknurrte und verzweifelt am Drahtgeflecht nagte, kamen sie angerannt und weckten mich mit der Botschaft: »Daddy, komm schnell, wir haben ein kleines Teufelchen gefangen!« Er sah wirklich ziemlich wild aus – das arme Ding hatte sich bei seinen Fluchtversuchen die Nase aufgeschürft. Ich lasse sie immer in großer Entfernung zum Haus frei, nachdem ich sie gut gefüttert habe, doch all meine Bemühungen scheinen die Population nicht im Geringsten zu reduzieren. Viel sanfter wirken da die Siebenschläfer, mit ihrem wunderschönen samtweichen Schwanz; sie sind so groß, dass man sie leicht für kleine, unglaublich süße Eichhörnchen halten könnte. Was sicherlich mit ein Grund dafür ist, dass ich es einfach nicht fertigbringe, sie aus dem Haus zu jagen.
Die vielen Mäuse, die auf dem Dachboden leben, sind nervös, denn sie haben ein Problem: ein Problem namens Schleiereule. Die Eulen hinterlassen riesige Gewöllehaufen; diese werden von den Larven der Kleider- und Fellmotte gefressen, die sich von den getrockneten Ausscheidungen anderer Tiere ernähren. Aber es gibt noch ein weiteres, ein mysteriöses Wesen, das die Mäuse fürchten sollten. Vor einigen Jahren habe ich in dem alten Dach ein Fenster eingebaut und bald danach auf dem Glas die Fußspuren eines großen Tiers entdeckt. Auch fand ich längliche, stinkende Exkremente, manchmal in der Einfahrt und sogar auf einem Fenstersims im Dachboden. Um welches Tier es sich auch handeln mochte, es machte fette Beute: Einmal fand ich Flügel und Kopf einer Schleiereule. Ein andermal, bei einem Ausflug am frühen Morgen, entdeckten meine beiden Jungs in der Einfahrt einen blutigen Fleischklumpen – die traurigen Überreste einer großen Zornnatter. Dem Durchmesser des Klumpens nach zu urteilen, muss es sich um eine mindestens anderthalb Meter lange Schlange gehandelt haben, doch bis auf ein 15 Zentimeter langes Mittelstück hatte der Angreifer sie komplett verschlungen. Das mysteriöse Tier, das für all das verantwortlich war, erlangte in unserer Familie bald schon fast mythischen Status, die Kinder stellten wilde Spekulationen darüber an. Erst viele Jahre später fand ich die Wahrheit heraus.
Ich möchte Sie jetzt auf einen Spaziergang mitnehmen. Wir beginnen oben an der Einfahrt im Norden des Hauses, bei dem großen Kastanienbaum. Es ist ein Spätnachmittag Ende Mai, und der Baum steht in voller Blüte. Die mit duftenden cremefarbenen Blüten übersäten Kerzen ziehen Unmengen von Hummeln an, deren emsiges Geschwirre welke Blütenblätter auf den Weg regnen lässt. Wir schlendern die alte asphaltierte Einfahrt hinab, deren warme Oberfläche rissig ist, weil die Baumwurzeln von unten durchbrechen; kärgliche Büschel Wiesen-Kammgras sprießen aus den Spalten. Wir bleiben links stehen, um das Waldameisennest zu bewundern, eine sanft gewölbte Kuppel aus getrocknetem Gras, wimmelnd von großen kastanienbraunen Ameisen. Das Nest befindet sich meines Wissens seit zehn Jahren am gleichen Platz. Meine Jungs lieben es, den Ameisen zuzusehen und im Nest herumzustochern, und ich habe sie im Verdacht, dass sie ihnen gelegentlich Insekten zum Fraß vorwerfen. Schon bei der kleinsten Störung breitet sich wellenförmige Aktivität aus, da die Ameisen Alarmpheromone ausscheiden, um die anderen vor der Gefahr zu warnen. Die Ameisenpfade verlaufen vom Nest aus kreisförmig über den Asphalt, und die heimkehrenden Ameisen schleppen Pflanzen- und Insektenteile herbei, um die Brut zu füttern.
Jenseits des Ameisennests zu unserer Linken befindet sich eine dichte Ginsterhecke, die mindestens fünf Meter breit ist. Ein männliches Schwarzkehlchen sitzt auf dem höchsten Punkt der Hecke. Sein typischer Ruf erklingt – als schlage man zwei Kieselsteine gegeneinander. Das Weibchen sitzt irgendwo tief im Dickicht auf seinem muldenförmigen Moosnest und brütet seine himmelblauen Eier aus. Spähen wir durch die dichte Ginsterhecke in östlicher Richtung zur Einfahrt hinüber, sehen wir meinen großzügig angelegten Obstgarten: fünfzig junge Apfelbäume, die ich aus Kernen gezogen habe. Die größten von ihnen sind jetzt fast vier Meter hoch. Zwei der Bäume haben letztes Jahr erstmals Früchte getragen. Meine drei Jungs jagen in fünfzig Metern Entfernung Schmetterlinge. Die beiden ältesten, Finn und Jedd (mittlerweile zwölf und zehn), laufen voraus, aufgeregt schwatzend, jeder mit einem großen Schmetterlingskescher bewaffnet. Hinter ihnen kämpft sich unser Jüngster, Seth (drei Jahre alt), tapfer durchs hohe Gras, und das Einzige, was man in all dem Grün von ihm sieht, ist sein weißblonder Haarschopf.
Zu unserer Rechten steht eine Bienen-Ragwurz. Ihre purpurrote Blüte ahmt Duft und Textur einer weiblichen Biene nach und verlockt so die männlichen Bienen zu einem Kopulationsversuch. Deren Mühe wird zwar nur damit belohnt, dass ihnen eine Pollenkugel am Kopf kleben bleibt, aber offenbar sind sie dumm genug, immer wieder in die gleiche Falle zu tappen, sonst ginge die Strategie der Bienen-Ragwurz ja nicht auf.
Ein Stück weiter wird die Einfahrt rechts von einer Reihe hoher Eichen und links von Ulmen und Eichen beschattet. Morsche braune Eicheln vom letzten Herbst liegen immer noch auf dem Boden verstreut. Die Ulmen wurden wiederholt vom Ulmensterben heimgesucht, das die Bäume, wenn sie erst einmal sechs bis sieben Meter hoch sind, in kurzer Zeit vernichtet, doch zum Glück haben sie sich rasch durch Wurzelschößlinge verbreitet, sodass immer wieder neue Bäumchen aus dem Boden sprießen. Ein Laubfaltermännchen, auch Waldbrettspiel genannt, fliegt von einem sonnigen Plätzchen in der Einfahrt auf, um sein Territorium zu verteidigen: Es verjagt einen Zitronenfalter, der es gewagt hat, in seine Domäne einzudringen.
Ich liebe die fantasievollen französischen Schmetterlingsnamen. Im Vergleich dazu wirken die englischen Namen meist recht einfallslos. Zum Beispiel beschreibt der englische Begriff für den Aurorafalter – orange tip – nur die orangerote Zeichnung der Flügel, wogegen das französische l’aurore – die Morgendämmerung – gleich viel poetischer klingt. Wie nennen wir Briten einen getüpfelten Schmetterling, oben erwähntes Waldbrettspiel? Natürlich speckled wood – die Franzosen hingegen nennen ihn le Tircis, nach einem Schäfer in einer Fabel von Jean de La Fontaine aus dem 17. Jahrhundert. Vor einigen Jahren kam mir die Idee, interessierten Nachbarn eine Führung durch die Welt der Schmetterlinge in Chez Nauche anzubieten. Ich schickte Info-Blätter an den Bürgermeister meines Dorfs Épenède und den Bürgermeister des nahe gelegenen Pleuville, mit der Bitte, sie an der Anschlagtafel der Gemeinde zu veröffentlichen. Ich kaufte jede Menge Limonade und büffelte die Namen sämtlicher französischer Schmetterlinge und anderer Insekten, obwohl sich mein schlechtes Französisch gewiss als Handicap erweisen würde. Am Tag des Events wartete ich zur angegebenen Zeit nervös vor meinem Haus – aber kein Mensch erschien. Zehn Minuten später tauchte schließlich doch noch ein Wagen auf; ihm entstiegen eine Engländerin und ihre jugendliche Tochter, die in der Nähe wohnten. Ich kannte sie zwar nicht, führte sie aber sehr gerne durch die Wiese, obwohl mich die geringe Resonanz von Seiten der französischen Nachbarn enttäuschte. Nun ja, vielleicht ist die Schmetterlingsjagd ja nur eine Beschäftigung für exzentrische Briten, der französische Landbewohner nichts abgewinnen können. Jedenfalls steht fest, dass Vogel- und Schmetterlingsschutzorganisationen in Großbritannien weltweit die höchsten Mitgliederzahlen aufweisen. Wir genossen den Spaziergang, auf dem wir zahlreiche Hummeln, Schmetterlinge und Grashüpfer beobachten konnten. Gegen Ende führte ich sie an einem alten Stück Wellblech vorbei, das ich am Rand des Felds platziert hatte. Da Schlangen wegen der Wärme ausgesprochen gern unter Blechplatten liegen, war ich mir ziemlich sicher, dass uns hier eine tolle Überraschung erwartete, als glanzvolles Finale unseres Rundgangs. Und tatsächlich entdeckten wir eine große Äskulapnatter, die ich mit einer schwungvollen Bewegung einfangen konnte. Wir nahmen sie mit zum Wagen, wo die Mutter ihre Tochter fotografierte, wie sie die Schlange streichelte, und ließen sie danach wieder frei. Was dann passierte, hatte ich allerdings nicht vorausgesehen. Die Schlange schoss unters Auto und fand irgendwie in den noch warmen Motor! Die nächste Stunde verbrachten wir damit, bei hochgeklappter Motorhaube intensiv nach ihr zu suchen – ohne Erfolg. Schließlich mussten die arme Frau und ihre Tochter widerwillig ins Auto steigen und zurückfahren, mit der Schlange im Wagen. Ich kann nur hoffen, dass alle drei die Reise gut überstanden haben.
Nun aber zurück zu unserem eigenen kleinen Rundgang. Wir erreichen das Ende der Einfahrt. Zu unserer Linken befindet sich ein Rechteck aus robusten Wänden – »das Alamo«, wie mein Vater es getauft hat –, die Überreste einer riesigen Scheune. Als ich Chez Nauche kaufte, befand sich diese Scheune in desolatem Zustand: Im Dach klafften Löcher, die schönen alten Eichenbalken waren verrottet. Da ich mir eine Reparatur nicht leisten konnte, entfernte ich das Dach und verkaufte die noch einigermaßen brauchbaren Balken an einen Händler. Die alten Mauern bieten seither Eidechsen und wärmeliebenden Schmetterlingen ein sonniges Plätzchen; aus dem steinigen Boden sprießen Unmengen von Karden und Disteln, zwischen denen man oft Peitschennattern entdeckt.
Zu unserer Rechten befindet sich eine kleine, mit Schlehdorn und Eschen überwachsene Mulde, einst ein flacher saisonaler Teich, den ich versehentlich mit Bauschutt aufgefüllt habe. Seitdem bin ich dabei, den Schutt nach und nach wieder abzutragen, in der Hoffnung, dass die Molche, die dort einst lebten, zurückkehren werden.
Biegen wir nun rechts von der Einfahrt ab und gehen am Teich vorbei über die offene Wiese. Dieser westliche Teil der Wiese ist einem großen Langzeitexperiment vorbehalten, das dazu dient, das Blumenwachstum zu fördern und die Gräser nach und nach zu verdrängen. Auf quadratischen Parzellen habe ich dort Kleine Klappertöpfe, Augentrost, Frühlings-Zahntrost und Wiesen-Wachtelweizen ausgesät, alles hemiparasitäre Pflanzen, die Kraft aus benachbarten Gräsern ziehen, indem sie deren Wurzeln anzapfen und die darin enthaltenen Nährstoffe aufsaugen. Wird das Wachstum der Gräser unterdrückt, entsteht mehr Raum für andere Blumen, so zumindest die Theorie. Der Klappertopf ist voll erblüht: Diese hübsche einjährige Pflanze mit ihren zarten gelben Blüten, die in der Mitte purpurrote Spitzen zieren, hat sich in kleinen Büscheln auf den Parzellen angesiedelt. Zu diesem frühen Zeitpunkt kann man zwar noch nicht sagen, ob sich die Anzahl der Blumen dadurch tatsächlich erhöht hat, aber zumindest bietet die Wiese jetzt im späten Frühjahr einen wirklich schönen Anblick. Nach zehn Jahren ohne Dünger und Pestizide haben sich dort zahlreiche Wildblumen selbständig etabliert. Die vorherrschenden Grassorten sind das Knaulgras, das Wollige Honiggras und der Gewöhnliche Glatthafer, große, dominante Spezies, die alles andere ersticken, doch im Laufe der Zeit hat sich dies glücklicherweise etwas reduziert, und nun gibt es auch feinere, weniger aggressive Gräser, die für eine richtige Heuwiese typisch sind: das Schwingelgras, das Gewöhnliche Ruchgras und der Wiesen-Fuchsschwanz. Zwischen den Gräsern verstecken sich Blumen: wilde Geranien, Vergissmeinnicht, Jakobs-Greiskraut, Weiße Lichtnelken, Löwenzahn, Klee und Schneckenklee, um nur einige zu nennen. Manche davon wachsen in klar abgegrenzten Büscheln, entweder, weil sich ihre Samen nicht so leicht ausbreiten, oder eventuell auch, weil sie aufgrund subtiler Unterschiede der Bodenbeschaffenheit an diesen Stellen bessere Wachstumsbedingungen vorfinden.
Sobald wir die Einfahrt verlassen, betreten wir ein Beet, in dem das Fingerkraut, ein Kriechgewächs, üppig gedeiht; es ist mit der Rose verwandt und hat schlichte gelbe Blüten, die den Blumen auf Kinderzeichnungen ähneln. Die horizontal kriechenden Stängel sind wahre Fallstricke für den Spaziergänger. Fünf Meter weiter endet das Fingerkraut abrupt, und wir stehen vor einem dichten Büschel Wiesen-Platterbsen, einer Erbsensorte, die sich an größeren Grashalmen emporrankt. Zwischen der dichten Vegetation hören wir die hohen Schreie kämpfender Spitzmäuse; diese kleinen, aber gefräßigen Raubtiere absolvieren ihr kurzes Leben in hektischem Tempo, ständig damit beschäftigt, zu fressen und ihr Territorium erbittert gegen Artgenossen zu verteidigen. Auf die Platterbsen folgt ein üppiges Ackerklee-Beet. Hier schwirrt die Luft von langrüssligen Hummeln – Gartenhummeln und Ackerhummeln –, die den süßen Nektar und proteinreichen, toffeebraunen Pollen des Ackerklees sammeln. Zuletzt folgt ein Beet, das dicht mit Labkraut bewachsen ist, einer angenehm duftenden Kriechpflanze mit winzigen dunkelgrünen Blättern und Köpfchen aus zahllosen gelben Blüten. Vor langer Zeit, bevor es komfortable Federkernmatratzen gab, wurde das Labkraut als süß duftende Einstreu für Betten verwendet – daher auch sein Spitzname Liebfrauenstroh.
Wir gehen jetzt in südwestlicher Richtung weiter, einen sanft abfallenden Hang hinab, von dem aus man die alten Bauernhäuser des Weilers Villemiers erblickt, auf der anderen Talseite, einen Kilometer entfernt. Der Transon, ein Nebenfluss der Charente, schlängelt sich am Talgrund entlang, ein träges, von kleinen schlammigen Pfützen durchsetztes Rinnsal, in dem zahllose Nutrias (oder Sumpfbiber) leben, südamerikanische Nagetiere, die vor langer Zeit aus Pelztierfarmen entkamen und in den vielen Flüssen und Teichen des Départements eine zweite Heimat gefunden haben. Es sind semi-aquatische, also teilweise im Wasser lebende Biber, die sich von anderen Biberspezies darin unterscheiden, dass sie lange, an Ratten erinnernde Schwänze haben. Sie können ziemlich lästig sein, da sie die Erde durchwühlen und riesige Bauten in die Uferböschungen graben, direkt an der Wasserlinie, was einem Fluss zwar kaum schadet, sich auf einen künstlich angelegten Teich jedoch katastrophal auswirkt, falls dadurch der Damm durchlöchert wird.2
Irgendwo links in der Ferne hört man die wehklagenden Schreie eines Vogels. Meine Söhne und ich haben viele Stunden damit zugebracht, uns an dieses Tier heranzupirschen, das ich in Chez Nauche zum ersten Mal gehört habe. Sein Ruf erklingt fast den ganzen Frühling und Sommer über, meist aus südöstlicher Richtung, ein nasales Wack-Wack mit einer kurzen, aber prägnanten Pause zwischen den einzelnen Tönen.
Offenbar handelt es sich stets nur um ein einzelnes Exemplar dieses Vogels. Immer wenn ich meinen gelehrten ornithologischen Freunden einen Eindruck davon vermitteln möchte, wie er klingt, lachen sie mich aus und behaupten, es sei wohl nur eine Ente, aber das liegt nur daran, dass ich den Laut nicht richtig wiedergeben kann. Ich bin mit meinen Söhnen schon oft durchs hohe Wiesengras gerobbt, um das Tier zu finden, das diesen Ruf ausstößt. Wir verorten es in einer großen Eiche an der Grundstücksgrenze, doch immer wenn wir uns nähern, verstummt es, ein Vogel jedenfalls kam uns nie zu Gesicht. Die Jungs vermuten, es müsse irgendein Fabelwesen sein, bunt gefärbt, mindestens einen Meter groß, mit Kamm und langem scharfem Schnabel, doch in diesem Fall müsste es sich schon sehr gut verstecken können. Ich frage mich langsam, ob es vielleicht gar kein Vogel ist, sondern irgendeine seltene Froschart. Vielleicht finden wir es eines Tages heraus.
Die Wiese wird jetzt trockener, während wir uns auf den steilen Südhang an ihrem südlichen Ende zubewegen. Hier gedeiht vor allem Spitzwegerich. Das ist eine völlig unscheinbare kleine Pflanze, mit lanzettförmigen Blättern und unauffälligen braunen Blüten, aus denen ein Saum gelber Staubfäden baumelt. Doch die Blätter sind die bevorzugte Futterpflanze des wunderschönen Wegerich-Scheckenfalters. Der englische Name dieses Schmetterlings, Glanville fritillary, geht auf Lady Eleanor Glanville zurück, eine der ganz wenigen Schmetterlingsforscherinnen des 18. Jahrhunderts. Sie hat diese hübsche Spezies, die sie in der Nähe ihres Hauses in Lincolnshire fand, als Erste beschrieben. Der Wegerich-Scheckenfalter ist seit Langem aus fast ganz Großbritannien verschwunden; man findet ihn nur noch an der Südküste der Isle of Wight, doch in Chez Nauche ist er zu dieser Jahreszeit einer der häufigsten Schmetterlinge überhaupt, und so scheuchen wir während unseres Wiesenrundgangs Dutzende Exemplare auf. Die Oberseite ihrer Flügel ist orange-schwarz kariert, die cremeweiße Unterseite sehr hübsch orangefarben gestreift und schwarz getüpfelt. Mit ihrem pelzigen Leib wirken sie recht knuffig. Ich hatte schon immer ein Faible für den Wegerich-Scheckenfalter, habe mir die Puppen dieser Spezies schon als Kind bei Worldwide Butterflies besorgt und die Schmetterlinge dann in meinem Zimmer selbst gezüchtet. Aus den großen Gelegen gelber Eier schlüpfen samtschwarze ungewöhnlich gesellige Raupen; sie leben auf den Blättern des Spitzwegerichs in seidenen Gespinsten, die sie selbst produzieren. Sobald die Pflanze, auf der die Eier abgelegt wurden, komplett kahlgefressen ist, verständigen sich die Raupen auf irgendeine Weise und ziehen im Konvoi zur nächsten Pflanze.
Wir nähern uns jetzt einem tief eingesunkenen Weg, der die westliche Grenze der Wiese markiert. Zahllose Eichen, Haselnuss- und Schlehensträucher säumen beide Wegesränder. Als wir uns durch eine kleine Lücke in der Hecke zwängen, werden unsere Beine von der extrem stachligen Dornmyrte zerkratzt, die im Unterholz gedeiht. Auf dem Weg ist es schattig; an heißen Tagen versammeln sich dort Fliegen, um der Hitze zu entfliehen. Hier wollen wir uns die Senfweißlinge ansehen, gespenstisch weiße Wesen, die gemächlich den Weg entlangschweben, hin und her, mit sterbensmatt wirkendem Flügelschlag. Auch dies ist eine Spezies, deren Population in Großbritannien aus bislang noch unbekannten Gründen stark zurückgeht, doch in Frankreich scheint sie zu gedeihen. Nun biegen wir links ab, immer weiter steil bergab zum Transon, der direkt an mein Grundstück grenzt. Bevor er kurzerhand unter dem Weg verschwindet, bildet er einen kleinen Tümpel, auf dessen Oberfläche hektisch ein Schwarm glänzender Taumelkäfer kreiselt. Ich habe hier schon oft Ringelnattern beobachtet, die im seichten Gewässer Fische und Molche jagen; heute aber scheinen sie sich zu verstecken. Gerade als wir uns abwenden, flitzt eine männliche Prachtlibelle an uns vorbei, deren metallisch blauer Leib im Sonnenlicht schimmert. Das ist eindeutig die spektakulärste der Libellen, sie ist größer als jede andere europäische Spezies. Nicht nur schillert der Leib des Männchens, auch die Flügel sind mit großen blau-schwarzen Pigmentklecksen versehen, die bei jedem Flügelschlag aufblitzen. Das Weibchen weist eine etwas dezentere, schimmernde Grünfärbung auf, und wenn ein Paar zusammensitzt, was oft geschieht, ist das ein atemberaubender Anblick.
Wir gehen nun wieder ein kleines Stück den Berg hinauf und zwängen uns wieder durch die Hecke, um zur südlichen Ecke meiner Wiese zu gelangen. Nachdem wir einen steilen Hang hinaufgeklettert sind, laufen wir in nordöstlicher Richtung weiter, auf einen kleinen, vereinzelt stehenden Baum zu. Es ist ein Walnussbaum, den ich vor über sechs Jahren gepflanzt habe und der inzwischen ungefähr drei Meter hoch ist. Eines Tages wird er so groß sein, dass er vielleicht sogar Nüsse trägt, auf jeden Fall aber wird man in seinem Schatten wunderbare Picknicks veranstalten können. Auf dem schlanken grauen Stamm sitzt eine junge Gottesanbeterin, deren dreieckiger Kopf jeder unserer Bewegungen folgt, als taxiere sie eine potenzielle Beute. In grüner Vegetation sind Gottesanbeterinnen kaum zu erkennen, also hat sich dieses Exemplar eindeutig den falschen Platz ausgesucht. Ihre kräftigen Vorderbeine sind unter dem Leib gefaltet, die Reihen scharfer Dornen zusammengeschlossen, jederzeit bereit, überraschend zuzuschlagen, falls ein Insekt sich zu nahe heranwagen sollte. Wird die Gottesanbeterin von einem Vogel attackiert, klappt sie blitzschnell die Flügel auf und enthüllt große Augenflecke, die die meisten Vögel in die Flucht schlagen.3
Direkt hinter dem Walnussbaum beginnt eine sanfte Senke von etwa zwanzig Metern Durchmesser, über der ein berauschender Duft hängt. Denn hier wachsen massenweise Wildkräuter – Basilikum, Thymian, Minze. Wenn man sich hinsetzt, wird man unsichtbar – ein wundervoller Ort, um zu entspannen und die Wiese intensiv in sich aufzunehmen, ihren Anblick, ihren Duft, ihre Geräusche. Ein Hirschkäfermännchen fliegt brummend vorbei; diese riesigen Käfer gibt es hier zu dieser Jahreszeit. Wegen ihrer massiven Kiefer, die sie für die Kämpfe mit Rivalen benötigen, fliegen sie allerdings recht unbeholfen. Sie bewegen sich so langsam, dass man sie ohne Weiteres im Flug fangen kann, aber dieses Exemplar lasse ich unbehelligt weiterziehen.
Von hier aus schlendern wir weiter Richtung Osten. Die Wiese senkt sich erneut in ein sanftes Tal, an dessen Grund eine kleine Quelle entspringt. Diese Quelle war einst die Hauptwasserversorgung für das Gehöft. Die Wassergebühren in Frankreich gehören zu den höchsten weltweit, deshalb zog es Monsieur Poupard vor, sein ganzes Wasser kostenlos aus der Quelle heraufzupumpen und in einen rostigen alten Tank zu leiten, der sich in einer der kleineren Scheunen befindet. Ein Brunnen wurde in die Erde gegraben und mit Steinen gesäumt. Das Bächlein, das dort seinen Ursprung hat, läuft südlich zum Transon hin. Ich lasse um die Quelle herum Sträucher wachsen, vorwiegend Schlehdorn und Brombeeren, wodurch ein wunderbar undurchdringliches Gestrüpp entstanden ist, in dem zahlreiche Vögel nisten. Ein Stück flussabwärts habe ich gelbe Sumpf-Schwertlilien gepflanzt, die gut gedeihen und sich mit ihren wächsernen Blättern und Stängeln hoch über das kriechende Gestrüpp erheben. Ihre leuchtenden Blüten locken Hummeln an.
Hinter den Sumpf-Schwertlilien liegt ein Teich, der von einem klobigen Damm aus Stein und Lehm aufgestaut wird. Dies ist mein Versuch, ein größeres Habitat für Wassertiere zu erschaffen, doch davon später mehr. Wir überqueren den Damm und steigen die andere Talseite wieder hinauf, immer noch in östlicher Richtung. Die Grundstücksgrenze zu unserer Rechten besteht aus riesigen, voll ausgewachsenen Eichen, aus denen der lebhaft plappernde, nasale Ruf der Dorngrasmücken ertönt. Auf dem Hügelkamm angelangt, befinden wir uns jetzt nahe der östlichen Grenze meines Grundstücks. Wir lassen uns nieder und blicken über das Tal und die Quelle hinweg – auf Chez Nauche mit seinen ockerfarbenen Gebäuden, die lange Schatten in unsere Richtung werfen, während dahinter am westlichen Horizont die Sonne versinkt. Ein Schwalbenschwanz segelt vorbei, der erste in diesem Jahr, ein herrliches gelb-schwarzes Exemplar, dessen Hinterflügel mit blau-roten Augenflecken und langen schwarzen »Schwänzchen« geschmückt sind. Es ist ein Männchen, das eifrig nach einem frisch geschlüpften Weibchen sucht, um sich mit ihm zu paaren. Die Grillen, die verstummt waren, als wir uns näherten, erscheinen wieder an den Eingängen ihrer Höhlen und stimmen ihren Gesang an. Der Sommer naht. Für Insekten ist dies die Zeit der Paarung, des Nektars, des Sonnenscheins und der Blumen. Es ist meine liebste Jahreszeit, und mein liebster Ort ist diese Wiese hier, wo die Natur förmlich explodiert und die Welt noch in Ordnung ist. Na ja, beinahe. Wenn ich nur daran gedacht hätte, ein paar Dosen kaltes Bier mitzubringen. Und vielleicht ein Stück Käse.
Das Insektenimperium
27. Juli 2007. Laufzeit: 41 Minuten 15 Sekunden. Wieder einmal ein wunderschöner Tag im Paradies. Menschen: ein alter Mann, der mit seinem weißen Lieferwagen, einem Citroën, in Épenède Brot ausfuhr. Hunde: acht – mein persönlicher Rekord, einschließlich eines riesigen Pyrenäenberghunds in Le Breuil, der ohrenbetäubend laut bellte. Zum Glück wirkte er freundlich. Schmetterlingsspezies: 16. Baumweißlinge gibt’s dieses Jahr reichlich. Sie trotzen den stachligen Kardendisteln entlang der Einfahrt und schlemmen den reichhaltigen Nektar; aus rätselhaften Gründen ist diese Schmetterlingsspezies in Großbritannien vor über hundert Jahren ausgestorben. Während ich eine Weile sitze, um wieder zu Atem zu kommen, sehe ich eine Wiesenweihe, die auf der Jagd nach Wühlmäusen über der frisch gemähten obersten Wiese kreist – ein sehr schlanker, wunderbar anmutiger Vogel mit schiefergrauen, an den Spitzen schwarz gefärbten Flügeln.
Falls die Insekten einmal die Weltherrschaft ergreifen, werden sie sich hoffentlich dankbar daran erinnern, dass sie an all unseren Picknicks teilnehmen durften.
Bill Vaughan
Insekten besitzen drei Paar Beine.Richtige Blutgefäße haben sie keine,und während die Knochen sonst innen liegen,liegt ihr Skelett außen; sie schwimmen und fliegen,ihr dreiteil’ger Leib ist behaart oder kahl,ihr Herz liegt hinten, für sie so normal,wie dass sie Millionen von Eiern legen,und atmen, indem sie sich rhythmisch bewegen.Die Fühler werden fürs Riechen gebraucht,die Füße zum Schmecken ins Essen getaucht – und wirklich erstaunlich, was ihnen so schmeckt:Eine Blume oder ein andres Insekt,mal werden Mäntel und Holz benagt,ein Teppich zerkaut oder Menschen geplagt …Sie fressen, wobei sie selbst uns nicht verschonen,und zählen ganz sicher hundert Trillionen!Alles wird täglich von ihnen zersiebt,ein Wunder, dass es die Welt noch gibt!
Ethel Jacobson, Die Welt der Insekten
Vor etwa einer halben Milliarde Jahren begann eine schleichende Revolution. Auf dem schlammigen Grund eines urzeitlichen Ozeans machte sich eine Gruppe ebenso seltsamer wie wunderbarer Kreaturen daran, die Welt zu erobern. Die meisten hatten kaum Ähnlichkeit mit den heutigen Tieren. Ihre Körper waren in Segmente unterteilt, ausgestattet mit einer wechselnden Anzahl von Tentakeln, Klauen, Stacheln, Augen und zahllosen anderen kuriosen Anhängseln, deren Zweck wir wohl niemals ergründen werden. Wir wüssten gar nichts von diesen fantastischen, längst ausgestorbenen Kreaturen, wenn nicht Charles Walcott, ein Fossilienjäger und Geologe, im Jahr 1909, damals schon im fortgeschrittenen Alter, hoch droben in den kanadischen Rocky Mountains über eine riesige Menge hervorragend erhaltener Fossilien aus eben jener Zeit gestolpert wäre. Die Felsformationen, jetzt als Burgess-Schiefer bekannt, bildeten sich aus Schichten weichen Schlicks, der sich auf dem Grund des Ozeans abgesetzt hatte, die dort lebenden Tiere dann irgendwann einschloss und sie in erstaunlich gutem Zustand konservierte. Wir wissen noch nicht, warum die Fossilien so gut erhalten blieben; kann sein, dass ein Teil des Ozeangrunds anoxisch war, sodass sie erstickten und durch den Sauerstoffmangel perfekt erhalten wurden; möglich wäre aber auch, dass plötzlich abgehende Schlammlawinen die armen Kreaturen einschlossen und konservierten. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, der Burgess-Schiefer liefert uns ein beeindruckendes Abbild dieser lang zurückliegenden Urwelt.
Walcott reiste in seinen letzten Lebensjahren wiederholt zum Burgess-Schiefer und versuchte die gesammelten Fossilien zu bestimmen und zu klassifizieren. Die meisten dieser primitiven Tiere, die er beschreibt, hat er einer Gruppe zugeordnet, den Arthropoden (was »Gliederfüßer« bedeutet). Das ist jene Gruppe, die heutzutage Schalentiere, Arachniden und Insekten umfasst. Alle Arthropoden verfügen über ein in Segmente gegliedertes Außenskelett, also einen starren Panzer, meist mit gelenkigen Extremitäten versehen. Man hat sie mit Schweizer Taschenmessern verglichen; jedes ihrer Glieder kann auf verschiedenste Funktionen spezialisiert sein: laufen, schwimmen, greifen, stechen, sich paaren, atmen, fliegen, weben usw. Wie die einzelnen Teile des Taschenmessers werden die Gliedmaßen eingeklappt, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
Zu den Arthropoden im Burgess-Schiefer gehörten krebstierartige Wesen, Verwandte von Krabben, Hummern, Krill, Rankenfußkrebsen und Ruderfußkrebsen, von denen unsere Meere bis zum heutigen Tage wimmeln. Es gab aber auch noch viele andere Tiere, die kaum in die bekannten Gliederfüßer-Gruppen einzuordnen waren und vermutlich zu Linien gehörten, die im Laufe der Äonen ausgestorben sind. Zum Beispiel Opabinia, ein Wesen mit fünf Augen und einem nach unten geschwungenen Rüssel, wie der eines Miniaturelefanten; und Hallucigenia, eine kuriose Kreatur, die ein wenig an eine Kreuzung zwischen Wurm und Igel erinnert, mit zahllosen Beinen und paarig angeordneten scharfen Stacheln. Als Hallucigenia zum ersten Mal beschrieben wurde, glaubte man, dieses Tier sei auf den Stacheln gelaufen und die tentakelartigen Beine hätten sich über ihm hin- und herbewegt. Inzwischen sieht man dies genau umgekehrt und bildet das Tier mit den Stacheln nach oben ab; wahrscheinlich dienten die Stacheln zur Verteidigung, auch wenn sich das nie genau klären lassen wird. Eine der größeren Gattungen namens Anomalocaris ist oft nur in Fragmenten erhalten geblieben, vielleicht weil ihr Körper nach dem Tod rasch auseinanderbrach – die verschiedenen Körperteile wurden ursprünglich drei unterschiedlichen Tieren zugeordnet, bis schließlich irgendwann ein im Ganzen erhaltenes Exemplar gefunden wurde.4
Seit der Entdeckung des Burgess-Schiefers wurden auch in anderen Weltregionen ähnliche, wenn auch nicht ganz so reichhaltige Fossilienlager aus ungefähr derselben Periode entdeckt. All diese Funde haben zu unserem Wissen über das Leben in den Meeren des Kambriums vor einer halben Milliarde Jahren beigetragen – 499 Millionen Jahre, bevor irgendein auch nur im Entferntesten menschenähnliches Wesen auf der Erdoberfläche erschien. Zusätzlich zu Walcotts kuriosen Kreaturen gab es Arachniden, Vorfahren der heutigen Spinnen und Zecken, einschließlich der Furcht erregenden Riesenskorpione (Eurypteriden), die bis zu zweieinhalb Meter maßen und ihre Beute mithilfe mächtiger Zangen auf dem Grund von Flüssen und Meeren jagten. Es gab Trilobiten, segmentierte schildförmige Tiere, die wir nur noch als Fossilien kennen, die aber vor 250 Millionen Jahren zu den am zahlreichsten vorkommenden Tieren der Erde gehörten, mit vielen Tausend Unterarten – von winzigen, freischwimmenden Versionen, die vermutlich in offenen Gewässern lebten, bis hin zu riesigen gepanzerten Monstren, die über den Ozeanboden zogen, wohl um den Eurypteriden aus dem Weg zu gehen.
Eine Arthropodengruppe, die in den Fossilien des Kambriums auffälligerweise fehlt, sind die Insekten, aber das hätte Walcott nicht weiter überrascht, denn die Insekten haben sich nicht im Meer entwickelt, sondern erst später an Land. Zu der Zeit, als die Ablagerungen im Burgess-Schiefer entstanden, war das Leben an Land ziemlich unspektakulär – es gab ein paar primitive Moosfarne und Lebermoose, die in wassernahen Feuchtgebieten wuchsen, aber das war’s dann auch schon. Vermutlich sammelten sich entlang der Strände angeschwemmte Pflanzen und Tiere an – essbarer Abfall, der sich für die wassergebundenen Tiere außer Reichweite befand. Folglich begannen sich Arthropoden an den Strand zu schleppen, um von diesen brachliegenden Ressourcen zu profitieren. Ihr Außenskelett, das sich ursprünglich wohl zur Verteidigung gegen Fressfeinde entwickelt hatte, diente nun dazu, ihren Körper an Land zu stützen, was ihnen gegenüber Weichtieren wie Quallen oder Würmern einen Vorteil verschaffte und ihnen die Besiedelung des Festlands ermöglichte. Weichtiere hätten keinerlei Schutz gegen Austrocknung besessen und immer wieder ins Wasser zurückkehren oder sich in feuchten Milieus aufhalten müssen, in feuchtem Gras oder Moos.
Wir werden wohl nie erfahren, wie das erste Landtier aussah; vielleicht war es irgendein Tausendfüßler, der auf Moosteppichen an Meeresstränden weidete. Vielleicht handelte es sich aber auch um ein Krebstier, möglicherweise eine Art Assel oder Sandfloh, das sich von angeschwemmter toter organischer Substanz ernährte. Jedenfalls folgten dann sehr schnell Raubspinnen, skorpionartige Tiere, die ihre Beute im Grünen verfolgten – sie rannten ihr entweder hinterher oder bewegten sich rollend fort wie ein Rad. Als sich die Pflanzen langsam anpassten und auch an Land verbreiteten, konkurrierten sie immer stärker um Licht, was wiederum ihr Wachstum beeinflusste – sie wurden größer. Um nachzuziehen, mussten die (ursprünglich im Wasser lebenden) Tiere nun ihre wasserundurchlässige Schutzschicht verbessern. Manche Tiergruppen schafften das nicht so ganz; die wenigen Krebstiere, die erfolgreich das Festland besiedelt haben, wie etwa die Asseln, sind bis zum heutigen Tag auf ein Leben im feuchten Milieu beschränkt. Bei anderen, wie den Arachniden, sind Epidermis und Eier im Zuge der Evolution weitgehend wasserundurchlässig geworden, sodass sie die Meere weit hinter sich lassen und auch die unwirtlichsten, wasserärmsten Gegenden der Erde besiedeln konnten.
Die Insekten entstanden als letzte große Arthropodengruppe vor etwa 400 Millionen Jahren, haben seitdem aber tüchtig aufgeholt. Wir wissen nicht, woraus sie sich entwickelt haben – vielleicht aus Krebstieren, vielleicht aus einer frühen Form des Tausendfüßlers. Sie haben sich höchstwahrscheinlich an Land entwickelt und nicht im Meer wie die anderen Arthropoden, und sind zu den Herrschern des Lebens auf der Erde geworden.