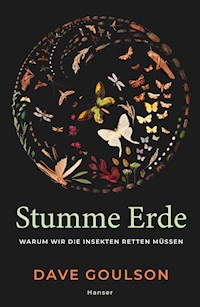Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Revolutionäre Gartenkunst – Dave Goulsons Bestseller bietet eine charmante Anleitung zum bienenfreundlichen und klimaneutralen Gärtnern. Der Klimawandel schreitet voran. Die Insekten verschwinden. Und wir sind machtlos. Oder doch nicht? Dave Goulson zeigt, wie wir im eigenen Garten das Artensterben stoppen und zu Selbstversorgern werden können. Pestizidfrei und CO2-neutral. Mit Katzenminze und Beinwell für die Bienen, mit Holunder- und Brombeersträuchern für die Vögel, mit Bohnen und Blumenkohl für uns selbst. Charmant leitet Goulson zur britischen Kunst des "Wildlife Gardening" an. Dabei verrät er, warum Lavendel nicht gleich Lavendel ist, auf welchen Pflanzen sich Hummeln niederlassen und wie auch in kleinen Gärten Dutzende Gemüsesorten gedeihen. Sie wollen die Erde retten? Lesen Sie dieses Buch. Und fangen Sie an zu buddeln …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der Klimawandel schreitet voran. Die Insekten verschwinden. Und wir sind machtlos. Oder doch nicht? Dave Goulson zeigt, wie wir im eigenen Garten das Artensterben stoppen und zu Selbstversorgern werden können. Pestizidfrei und CO2-neutral. Mit Katzenminze, Beinwell und Sonnenbraut für bedrohte Bienen, mit Holunder-, Schlehen- und Brombeersträuchern für seltene Vögel, mit Bohnen, Brokkoli und Blumenkohl – für uns selbst. Charmant leitet Goulson zur britischen Kunst des Wildlife Gardening an, mit der man reichere Ernten einfährt als mit jeder Monokultur. Dabei verrät er, warum Lavendel nicht gleich Lavendel ist, weshalb wir im Gartencenter darauf achten sollten, auf welchen Pflanzen sich Hummeln niederlassen und wie auch in kleinen Gärten Dutzende Gemüsesorten nebeneinander gedeihen. Mit Tomaten die Erde retten? Dave Goulson zeigt mit seiner revolutionären Gartenkunst, wie es gelingen kann.
Dave Goulson
Wildlife Gardening
Die Kunst, im eigenen Garten die Welt zu retten
Aus dem Englischen von Elsbeth Ranke
Carl Hanser Verlag
Für Gaia, Göttin der Erde
Inhalt
Vorwort
Pflanzen in Hülle und Fülle
Die Gartenwiese
Ohrwürmer in meinem Obstgarten
Der Giftcocktail
Das Summen der Bienen
Falter, Geschöpfe der Nacht
Kopfüber in den Teich
Ameisen im Grün
Das Wimmeln der Würmer
Garten-Invasoren
Der Lebenskreislauf
Gärtnern, um den Planeten zu retten
Meine 16 liebsten Gartenpflanzen für Bestäuber
Meine Top 12 der Beerenpflanzen für Vögel
Bauen Sie Ihre eigene Wurmfarm
Register
Vorwort
In diesem Buch geht es um die natürliche Tier- und Pflanzenwelt direkt vor unserer Nase, in unseren Gärten und Parks, in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen und im Boden unter unseren Füßen. Wo immer Sie jetzt gerade sind, hausen höchstwahrscheinlich Würmer, Asseln, Hundertfüßer, Fliegen, Silberfischchen, Wespen, Käfer, Mäuse, Spitzmäuse und noch viel, viel mehr, und alles das lebt friedlich nur ein paar Schritte von Ihnen entfernt. Schon ein winziger Garten kann viele Hundert wilde Insektenarten, kleine Säugetiere und Pflanzen bergen. Diese Lebewesen sind genauso faszinierend wie die großen Säugetiere oder tropischen Vögel, die wir in Naturdokus im Fernsehen so bestaunen – nur wissen wir über sie häufig viel weniger. Dabei leben diese Tiere hier bei uns und nicht in irgendeinem fernen tropischen Nebelwald; wir können ihnen also direkt begegnen und ihr Tun und Werden unmittelbar beobachten, von der Geburt über Balz und Paarung bis zum Tod – alles passiert vor unserer Haustür. Ich erinnere mich, wie der Naturjournalist Chris Packham einmal sagte, er liege lieber zehn Minuten auf dem Bauch und beobachte eine Kellerassel, als sich eine Stunde lang eine Hochglanz-Doku über die Löwen in der Serengeti anzusehen.
Dieses Buch ist ein Hoch auf das Leben der kleinen Geschöpfe in unseren Gärten. Ich hoffe, es regt auch Sie zu ein paar von den vielen praktischen Schritten an, die wir alle unternehmen können, um diese Artenvielfalt zu fördern und immer mehr dieser kleinen Wunderwesen in unser Leben zu lassen. Das lässt sich ganz einfach kombinieren mit dem Anbau von viel gesundem, pestizidfreiem und unübertreffbar lokalem Obst und Gemüse, denn Gärten und Schrebergärten können bemerkenswert produktiv sein, Orte, an denen Mensch und Natur in harmonischem Miteinander leben können statt in ständigem Kampf. Gärten geben uns einen Ort, an dem wir wieder mit der Natur in Kontakt kommen und entdecken, wo unser Essen eigentlich herkommt. Ja, mit unserem Engagement könnten wir Gärtner sogar den Planeten retten, und damit uns selbst. Also kommen Sie mit auf eine Expedition in den Dschungel gleich vor Ihrer Tür …
Pflanzen in Hülle und Fülle
Rezept für Maulbeer-Muffins
ZUTATEN: 110 g Butter, 250 g Mehl, 250 g Zucker, 2 Eier, 125 ml Milch, 2 TL Backpulver, ½ TL Salz, 250 g Maulbeeren
Einen Maulbeerbaum pflanzen. Bis der langsam wachsende Baum trägt, kann es allerdings zehn Jahre oder länger dauern; wenn Sie es eilig haben, kaufen Sie ein Haus mit einem ausgewachsenen Baum im Garten.
Den Ofen auf 180°C vorheizen. Eine Muffin-Form fetten. Backpulver, Mehl und Salz vermengen.
Butter und Zucker schaumig rühren. Eier hinzugeben und kräftig weiterschlagen. Milch und Mehlmischung einstreuen, rühren. Maulbeeren unterziehen.
Muffinform zu zwei Dritteln befüllen. 25 Minuten backen.
Die Muffins sind unschlagbar lecker, saftig und weich. Die zehn Jahre Wartezeit lohnen sich absolut.
Über Jahrtausende lebten wir Menschen als Jäger und Sammler in kleinen Verbänden, wussten nichts von der Welt jenseits unseres Stammesgebiets, hatten nur mit dem zu tun, was wir sehen, anfassen und schmecken konnten. Wir ernteten Beeren und Nüsse, fingen Fische und Wild, später bauten wir auch Nutzpflanzen an. Die Erde war für uns eine Scheibe. Wir ahnten nichts von globalen Problemen wie Überbevölkerung, Umweltverschmutzung oder Klimawandel, und wahrscheinlich versuchten wir auch nicht, zehn Jahre im Voraus zu planen. Vielleicht sind deshalb unsere Gehirne nicht besonders gut darin, komplexe Probleme zu erfassen, schwerwiegende globale Veränderungen zu begreifen und darauf zu reagieren, wenn ihre Auswirkungen sich erst in Jahrzehnten oder Jahrhunderten zeigen. In Sachen Planung für das langfristige Wohlergehen unseres Planeten hält sich unsere Erfolgsbilanz also ziemlich in Grenzen.
Selbst heute im 21. Jahrhundert und obwohl wir vom Universum inzwischen sehr viel mehr wissen, sprengen die großen Probleme, die vor uns stehen, offenbar unseren persönlichen Rahmen, sind unlösbar, ja unangreifbar. Alles, was ich persönlich vielleicht unternehmen kann, um den Klimawandel zu verhindern, die Rodung des Regenwalds aufzuhalten oder die wegen der angeblichen medizinischen Wirkung ihrer Hörner betriebene Nashornjagd zu stoppen, wirkt trivial und ineffizient. Als Umweltschützer fühlt man sich da leicht einmal hilflos, mutlos. Meine persönliche Motivation, trotzdem weiterzukämpfen, schöpfe ich seit jeher aus den kleinen Siegen, die ich in meinem eigenen Garten erringe, denn auf diesem kleinen Stückchen Erde bestimme ich; es ist klein genug, dass mein Gehirn es erfassen kann, und da kann ich alles richtig machen. Nach einem manchmal mühseligen Tag in meinem Uni-Büro, zum Beispiel mit einer endlosen E-Mail-Schlacht, mit der sich anscheinend die meisten von uns herumschlagen, statt etwas wirklich Sinnvolles zu leisten, ist es für mich unglaublich inspirierend und eine echte Freude, in meinen Garten zu gehen und mir die Hände schmutzig zu machen. Ich säe, ziehe Pflänzchen, gieße, mulche, jäte, ernte, kompostiere und arbeite mit dem Kreislauf der Jahreszeiten. Für mich ist der Maßstab am besten, in dem ich die Ergebnisse meiner Handlungen sehen und anfassen kann. Für mich beginnt die Rettung des Planeten mit der Pflege meines eigenen Stückchens Boden.
Seit ich mit neunzehn von zu Hause weggegangen bin, hatte ich in dreißig Jahren sechs verschiedene Gärten; ausgehend von einem handtuchgroßen Rechteck hinter einem potthässlichen Betonkasten, einer ehemaligen Sozialwohnung in Didcot, bin ich inzwischen aufgestiegen zu meinen aktuellen leicht ungepflegten, aber herrlichen 8000 Quadratmetern im Hügelland von East Sussex. Jeder meiner sechs Gärten war ganz anders, was Boden, Aussehen und die ererbten Pflanzen angeht, aber jedes Mal habe ich, zunehmend bewusster, versucht, ihn sachte so umzugestalten, dass er möglichst vielen natürlichen Arten Raum gibt. Besonders versuche ich Bienen, Hummeln und andere Bestäuber zu fördern, indem ich ihnen Futter zur Verfügung stelle, und, wo immer es geht, ein paar ruhige Stellen zum Nisten, Fortpflanzen oder Überwintern.
Naturgärtnern ist ganz einfach. Die Pflanzen wachsen von selbst, und Bienen und Schmetterlinge finden die Blüten alleine. Es kommen Pflanzenfresser, Schnecken, Rüsselkäfer, Blattkäfer und Raupen und mit ihnen auch ihre Räuber. Wenn man einen Teich gräbt, stellen sich wie durch ein Wunder spontan reihenweise Pflanzen, Insekten und Amphibien ein, irgendwie müssen sie das unbeanspruchte Wasser über Meilen hinweg riechen. Für ein erfolgreiches Naturgärtnern ist das, was man nicht tut, genauso wichtig wie das, was man tut. Das heißt nicht, dass ein Naturgarten ein völliges Chaos sein muss. Viele stellen sich einen Naturgarten als ein wildes Durcheinander von Brombeergestrüpp, Brennnesseln und Löwenzahn vor; und es stimmt auch, dass so ein Laissez-faire-Garten sehr viele natürliche Bewohner anlockt. Genauso gut kann man aber einen gepflegten, hübschen Garten haben, der von Leben nur so brummt (wobei Gepflegtheit natürlich tendenziell etwas mehr Arbeit erfordert). Ob gepflegt oder ungepflegt, ob ein winziger Hinterhof oder hektarweise grünes Hügelland: Wahrscheinlich ist Ihr Garten längst Heimat von Hunderten oder gar Tausenden wilden Tier- und Pflanzenarten.
Wie viel natürliches Leben sich in einem Garten findet, wurde, soweit ich weiß, wirklich gründlich nur einmal quantifiziert, und zwar am Stadtrand von Leicester. Mein Doktorvater war ein reizender, kettenrauchender Gauner namens Denis Owen, Spezialist für tropische Schmetterlinge und Ex-Mann von Jennifer Owen, die später eine der größten Heldinnen des Wildlife Gardenings werden sollte. Jennifer erstellte ab den 1970er-Jahren über Jahrzehnte einen Katalog der Artenvielfalt in ihrem kleinen Garten in Leicester. Eigentlich war es ein ganz gewöhnlicher Garten, allerdings verwendete sie keine Pestizide. Es gab Beete, ein Stück Rasen, einen oder zwei Bäume und ein Gemüsebeet, insgesamt 700 Quadratmeter. In diesem kleinen Garten hatte sie eine Lichtfalle für Nachtfalter, Fallgruben für krabbelnde Insekten und eine sogenannte Malaise-Falle1 für Fluginsekten. Ebenso penibel katalogisierte sie die Pflanzenwelt und sämtliche Vögel oder Säugetiere, die sie besuchten. In fleißigen 35 Jahren identifizierte sie nicht weniger als 2673 unterschiedliche Arten, darunter 474 Pflanzen, 1997 Insekten, 138 andere Wirbellose (Spinnen, Hundertfüßer, Schnecken usw.) und 64 Wirbeltiere (überwiegend Vögel).2 Noch beeindruckender ist, dass Jennifer schon fast genauso lang mit Multipler Sklerose kämpft; leider musste inzwischen ein Großteil ihres Gartens gepflastert werden, damit er für ihren Rollstuhl und Fahrzeuge passierbar ist. Trotzdem, sagt sie, gibt es dort immer noch eine ziemliche Artenvielfalt.
Grundlage eines Naturgartens sind natürlich die Pflanzen; sie stehen ganz unten in der Nahrungskette, sind die Füße, auf denen alles andere aufbaut. Die mikroskopisch kleinen grünen Chloroplasten in Pflanzenblättern fangen die Energie auf, die eine Kugel aus brennendem Wasserstoff ein paar Hundert Millionen Kilometer entfernt im Weltall abgibt. Diese Energie speichern sie in atomaren Verbindungen, als chemische Energie, zunächst in Form von Zuckern, die dann in komplexe Kohlehydrate umgewandelt werden, vor allem Stärke und Zellulose. Die Energie, die in den Blättern, Stämmen und Wurzeln der Pflanzen gespeichert ist, geht dann auf die Raupen und Schnecken über, die ihre Blätter fressen, auf die Blattläuse, die ihren Saft saugen, und auf die Bienen und Schmetterlinge, die den zuckrigen Nektar ihrer Blüten trinken. Diese Tiere werden dann von Drosseln, Blaumeisen, Spitzmäusen und Fliegenschnäppern gefressen, die selbst wiederum die Nahrung für Sperber oder Eulen darstellen. Alles vom leisen Quaken einer Kröte im Gartenteich bis zum Kreisen eines Turmfalken in luftiger Höhe wird letztlich vom Licht dieser fernen Sonne angetrieben. Wenn man zu viel darüber nachdenkt, kommt es einem vor wie ein absurd unwahrscheinliches, wackeliges Konstrukt.
Jede Tierart, die sich von Pflanzen ernährt, hat in der Regel eine Vorliebe für eine bestimmte Pflanzenart und häufig sogar für bestimmte Teile dieser Pflanze. Die Ilexminierfliege etwa verbringt ihre gesamte Entwicklung – also etwas weniger als ein Jahr – unter der Oberhaut eines Ilexblattes. Dort gräbt sie einen typischen bräunlichen Gang und schlüpft schließlich zum Ende des Frühlings als winzige gelbliche Fliege. Man findet sie nie auf anderen Pflanzenarten oder an anderen Stellen eines Ilex-Buschs. Die Raupen des Aurorafalters fressen am liebsten die Schoten vom Wiesenschaumkraut und lassen sich zur Not auch auf die von Knoblauch oder Weg-Rauke ein, verschmähen aber die meisten anderen Kreuzblütler und können sich etwas anderes gar nicht vorstellen. 284 verschiedene Insekten ernähren sich von je einem bestimmten Teil einer Eiche; Gallwespen, Schildläuse, Blattläuse, Nachtfalter- und Schmetterlingsraupen, Schaumzikaden, Rüsselkäfer, Bockkäfer und viele mehr. Jedes Insekt ist dabei meist auf einen bestimmten Pflanzenteil als Nahrung spezialisiert, und auf einen bestimmten Zeitpunkt im Jahr – die Energievorräte, die der Baum anlegt, werden so auf Unmengen winziger Tierchen aufgeteilt. Die Raupen des Blauen Eichen-Zipfelfalters graben sich im Frühling in die Knospen hoch oben in den Wipfeln, während die des Eichenwicklers in Röhren leben, die sie aus älteren Blättern wickeln und mit Seide zusammenkleben. Unterdessen graben sich die Larven des Eichelbohrers still und leise ihre Tunnels durch die Eicheln. So gehen die Insekten dem Wettbewerb untereinander weitgehend aus dem Weg, weil jedes seine eigene kleine Nische besetzt.
Ein paar Insekten sind weniger wählerisch und beweiden die Blätter verschiedener Pflanzen. Die behaarten Raupen des Braunen Bärs können Löwenzahn, Ampfer, Brennnesseln und mehr oder weniger alles fressen, worauf sie gerade stoßen. Doch solche Insekten sind die Ausnahme. Die meisten pflanzenfressenden Insekten fressen nur eine Pflanzenart oder wenige eng verwandte Arten und verhungern eher, als dass sie etwas anderes ausprobieren. Vielleicht wundert Sie diese Spezialisierung und dieses hartnäckige Bestehen auf ihrem Speiseplan. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Pflanzen gegen diese Schädlinge Verteidigungsmechanismen entwickelt haben. Sie können physisch sein – dicke Blätter, Dornen, Borsten usw. –, meist aber sind sie chemisch. Über die Jahrtausende ihrer Evolution haben die Pflanzen die unterschiedlichsten Toxine herausgebildet, die ihr Gewebe durchziehen und die hungrigen Tierchen abschrecken oder vergiften sollen. Kreuzblütler produzieren schwefelhaltige Senfölglycoside, die für den charakteristischen scharfen Kantinengeruch von gekochtem Kohl, Senf, Meerrettich und Rosenkohl verantwortlich sind. Senfölglycoside sind an sich nicht besonders giftig, werden aber in den Pflanzenzellen in kleinen Päckchen gespeichert; wird das Blatt von einer nagenden Raupe oder auch von einem weidenden Schaf zerbissen oder zerquetscht, brechen diese Päckchen auf, und die Enzyme in der Zelle wandeln die Senfölglycoside schnell in giftige Senföle um. Diese Stoffe sind für die meisten Insekten unverträglich, und daher meiden sie Kohl und seine Verwandten. Als die Kreuzblütler erstmals solche Senfölglycoside entwickelt hatten, kann man davon ausgehen, dass sie ein paar Jahrtausende lang ihre Ruhe hatten; doch irgendwann überwanden ein paar Insekten diese Verteidigungsstrategie. Der Aurorafalter zum Beispiel, der Große und der Kleine Kohlweißling und der Rapserdfloh haben alle chemische Mechanismen entwickelt, mit denen die Senfölglycoside in unschädliche Stoffe umgewandelt werden statt in Senföle. Einige Insekten wie die »Harlekin-Wanzen« (Murgantia histrionica) und Rübsen-Blattwespen lagern die Senfölglycoside in ihrem eigenen Gewebe ein und werden dadurch selbst ungenießbar für Räuber.
Zu ähnlichen Abläufen dürfte es in der 400 Millionen Jahre alten Geschichte der Evolution der Landlebewesen wieder und wieder gekommen sein. Jede Pflanze, die einen neuen chemischen Verteidigungsmechanismus herausbildet, der sie ungenießbar macht, hat einen Riesenvorteil vor ihren schmackhafteren Konkurrenten, wird sich also wahrscheinlich vermehren und ausbreiten. Damit stellt sie eine große Ressource dar, die aber niemand anzapft; es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sich ein Pflanzenfresser entwickelt, der dank einer Mutation das neue Toxin wegstecken kann. Vielleicht kann er den Giftstoff zerlegen oder ihn im eigenen Gewebe abkapseln. Einige Gifte wirken auch durch eine Blockade wichtiger biochemischer Prozesse, aber wenn Insekten einen alternativen Reaktionsweg für dasselbe Ergebnis entwickeln, ist ihnen das egal. Die Nachkommen dieses Pflanzenfressers können sich dann ausbreiten und vermehren, und sie werden sich genau auf diese Pflanze spezialisieren, da sie viel Futter bietet und es keine Konkurrenten gibt. Häufig nutzt dann das adulte Insekt genau den Geruch des pflanzlichen Abwehrmechanismus, der es eigentlich abschrecken sollte, als Wegweiser zur idealen Eiablagestelle. Im Ergebnis führt das zu einem endlosen Wettrüsten – die Pflanzen entwickeln unter dem Evolutionsdruck neue Verteidigungsmechanismen, und die pflanzenfressenden Insekten folgen ihnen durch die Evolutionslandschaft, entwickeln Lösungen für die Probleme, vor die die Pflanzen sie stellen. Da jede Pflanzenart andere Toxine nutzt, zahlt es sich für die Pflanzenfresser aus, sich zu spezialisieren; es ist schwer, auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen zu wollen, lieber beschränkt man sich auf eine und beherrscht die richtig. Dieser Wettlauf der Evolution führt zu dem engen Verhältnis zwischen pflanzenfressenden Insekten und ihren bevorzugten Wirtspflanzen, und man nimmt an, dass er die Evolution von ziemlich vielen Lebewesen auf der Erde befeuert hat. Bei der Evolution der Pflanzen, die dem Geknabber ihrer Pflanzenfresser entgehen wollen, entstehen irgendwann ganz neue Arten, und da die Pflanzenfresser sich adaptieren, um auch sie zu knacken, verändern auch sie sich und werden zu neuen Arten. Jede Pflanzenspezies hat am Ende ihre eigene Mannschaft von spezialisierten Pflanzenfressern, und jeder von ihnen hat wiederum seine eigenen spezialisierten Räuber und Parasiten. Einige Baumarten im tropischen Regenwald sind Recherchen zufolge Wirte für allein über 700 Käferarten, und in dem, was vom tropischen Regenwald übrig ist, gibt es über 100.000 Baumarten – leicht zu verstehen, dass die Pflanzenvielfalt die Grundlage für den märchenhaften Reichtum des Lebens darstellt.
Der Mensch nutzt die Vielfalt der pflanzlichen Abwehrchemikalien für seine Zwecke; obwohl sie eigentlich als Gifte dienen sollten, haben sie in kleinen Mengen viele wünschenswerte Eigenschaften. Einige dienen uns zum Würzen in der Küche; das Aroma einer Kräuterpflanze ist häufig Teil des Verteidigungsmechanismus. Jahrhundertelang hatten wir ausschließlich pflanzliche Medikamente; ein Beispiel dafür sind Digitalis-Glykoside, die in der Kardiologie eingesetzt werden und im Fingerhut vorkommen; in höheren Dosen sind sie tödlich. Viele modernde Medikamente beruhen auf Pflanzenextrakten, und ständig werden neue entdeckt. Auch als natürliche Insektizide nutzen wir pflanzliche Chemikalien, und manche davon sind in der biologischen Landwirtschaft zugelassen, zum Beispiel Pyrethrum (ein Chrysanthemen-Extrakt). Citral, ein Extrakt von Zitronengras, vertreibt Mücken. Freizeitdrogen wie Nikotin, Cannabis, Koffein und Opium (sowie der Malaria-Wirkstoff Chinin) sind lauter Alkaloide, die Pflanzen zur Abwehr von Pflanzenfressern produzieren. Mit Sicherheit sind in den vielen tropischen Pflanzen, die noch nicht untersucht sind, noch zahlreiche neue chemische Nutzstoffe zu entdecken; das ist einer der vielen Gründe, weshalb wir gut beraten wären, die Zerstörung der Regenwälder zu stoppen und damit die Fundgrube an potenziellen Heilmitteln zu erhalten, die sie ganz sicher bergen.
Vielleicht wundern Sie sich, dass ich so weit vom Garten abschweife, aber natürlich kann der Gärtner daraus etwas lernen. Die Entscheidung, welche Pflanzen wir anbauen, wirkt sich ganz grundlegend darauf aus, welche Insekten angelockt und bewirtet werden; und das wiederum bestimmt, welche Nahrung für Vögel, Fledermäuse, Spitzmäuse und räuberische Insekten wie Libellen zur Verfügung steht. Aller Anfang sind die Pflanzen.
Das bringt mich zu einer der größten Streitfragen der Naturgärtnerei: heimisch gegen nicht heimisch. Die meisten Pflanzen in den allermeisten Gärten sind nicht heimisch: In einer Studie von Ken Thompson und Kollegen von der Sheffield University in sechzig Stadtgärten in Sheffield zeigte sich zum Beispiel, dass ein Drittel der gefundenen Pflanzenarten in Großbritannien heimisch waren, die übrigen zwei Drittel dagegen fremde Arten überwiegend vom europäischen Festland und aus Asien. Im Vergleich zu brachliegendem Land oder halb natürlichen Lebensräumen enthielten Gärten insgesamt viel mehr unterschiedliche Pflanzenarten. Kens Team legte wiederholt Quadrate von einem Quadratmeter Fläche3 in diese verschiedenen Lebensräume und stellte fest, dass die Anzahl von Pflanzenarten pro Quadrat in allen Lebensräumen in etwa die gleiche war; in halb natürlichen Geländen allerdings stagnierte die Gesamtzahl von Arten, kumuliert aus den verschiedenen Quadraten, bei um die 120, während sie in Gärten weiter zunahm. Insgesamt wurden in Gärten im Vergleich zu halb natürlichen Geländen über doppelt so viele Pflanzenarten gezählt.
Eine Überraschung ist das natürlich nicht. Eifrige Gärtner setzen ständig neue, interessante Pflanzen ein, spontane Käufe aus dem Gartencenter oder aus dem Pflanzenkatalog oder Geschenke von Freunden. Man kann schwer widerstehen angesichts des beinahe endlosen Angebots von verlockenden Kultursorten aller möglichen Pflanzenarten aus aller Welt. Über 70.000 Sorten von 14.000 verschiedenen Pflanzenarten kann man in Großbritannien kaufen. Und welche soll man jetzt nehmen, wenn man natürliche Lebensformen fördern will? Gibt es da irgendwelche allgemeinen Faustregeln? Und vor allem: Sind heimische Wildblumen besser als exotische Fremdlinge?
Ken Thompsons Untersuchung von Gärten in Sheffield ergab, dass die Insektenvielfalt in Gärten mit mehr heimischen Pflanzenarten nicht merklich größer ist. Der beste Indikator war einfach die Anzahl an unterschiedlichen Pflanzenarten und das Pflanzenvolumen insgesamt; Gärten mit vielen Pflanzen und mehr Büschen und Bäumen hatten tendenziell mehr Insekten. Andererseits besaßen Kens Gärten in Sheffield meist ähnliche Anteile heimischer Pflanzen. Keine Gärten waren ausschließlich mit heimischen Arten oder ausschließlich mit Exoten bepflanzt; wenn sich kleine Abweichungen im Verhältnis von heimischen zu nicht heimischen Pflanzen nicht erheblich auf die Insekten auswirken, konnte er wohl kaum ein Muster erkennen. Dazu brauchen wir ein Experiment, in dem verschiedene Gärten eingerichtet werden, ein paar mit nur heimischen Pflanzen, ein paar mit nur Exoten und ein paar mit einer Mischung aus beidem. Vielleicht ließe sich das in einer neuen Wohnsiedlung planen, wo alle Gärten erst angelegt werden. Es wäre auch wirklich spannend, aber leider wüsste ich niemanden, der in nächster Zeit so eine Studie finanzieren würde. Unterdessen stammen die wohl besten Erkenntnisse, über die wir derzeit verfügen, aus einer Studie von Andrew Salisbury und Kollegen von den Gärten des britischen Gartenbauvereins, der Royal Horticultural Society (RHS) in Wisley. Sie richteten kleine Versuchsflächen ein, entweder mit heimischen Pflanzen, nahen Verwandten von heimischen Pflanzen oder Exoten von der Südhalbkugel, und zählten die Besuche von Bestäubern auf den Blumen. Insgesamt lockten heimische Pflanzen und ihre nahen Verwandten mehr Bienen und andere Insekten an als die Exoten. Besonders überraschend ist auch das nicht. Einige exotische Pflanzen haben sich in ihrer Evolution auf Bestäuber spezialisiert, die es in Wisley nicht gibt, etwa Kolibris; ihr Nektar liegt weit weg am Ende eines tiefen Schlauchs, in den nur die langen Schnäbel dieser Vögel hineinreichen. Diese Pflanzen dürften kaum viel besucht werden (wobei einige unserer einfallsreicheren Hummeln vielleicht lernen könnten, den Nektar zu stehlen, indem sie seitlich ein Loch in die Blüte beißen). Andererseits sind die meisten Blüten nicht allzu stark spezialisiert, und extrem unterscheiden sich Bienen und Schmetterlinge in Großbritannien auch wieder nicht von denen in Chile oder Südafrika. Eine Blüte, die in Australien von Schmetterlingen bestäubt wird, dürfte für britische Schmetterlinge mit großer Wahrscheinlichkeit auch attraktiv sein. Anders als ihre Blätter schützen Pflanzen ihren Nektar üblicherweise nicht mit giftigen Stoffen, schließlich »wollen« sie, dass die Bestäuber kommen; daher müssen sich die Bestäuber nicht im gleichen Ausmaß auf bestimmte Wirtspflanzen spezialisieren wie die Pflanzenfresser.4 In Tasmanien habe ich Dunkle Erdhummeln gesehen (sie wurden in den 1990er-Jahren dort eingeführt), die sich an eingeschlepptem Mohn aus Europa ernährten, an Lupinen aus Kalifornien und an heimischem Riesen-Eukalyptus; süßer Nektar schmeckt immer, egal, wo er herkommt.
Da die meisten Pflanzen ziemlich lose, flexible Verbindungen zu Gruppen von Bestäubern pflegen, wird schon irgendwer sie bestäuben, egal, wo sie stehen; und genauso sind die meisten Bestäuber in Bezug auf die Herkunft ihrer Nahrung ziemlich anpassungsfähig. Wenn Sie also vor allem so viele Bestäuber wie möglich in Ihren Garten locken wollen, dann brauchen Sie sich wahrscheinlich über die Herkunft der Pflanze nicht allzu große Gedanken zu machen. Einige nicht heimische sind wirklich prächtig. Die Rainfarn-Phazelie zum Beispiel (Phacelia tanacetifolia) stammt aus dem Südwesten der USA und aus Mexiko, aber als Hummelpflanze für einen britischen Garten hat sie nur wenig Konkurrenz; alle Bienen sind verrückt nach ihr. Duftnesseln (Agastache foeniculum), ebenfalls aus Nordamerika, können der Phazelie den Rang ablaufen (allerdings gehen sie auf meinem schweren Lehmboden über den Winter leicht ein). Die meisten von uns würden sich ziemlich eingeschränkt fühlen, wenn wir nur heimische Pflanzen anbauen dürften, aber natürlich verdienen auch viele sehr hübsche heimische Arten einen Platz im Garten. In keinem Garten sollte Fingerhut mit seinen majestätischen lila Blütenständen fehlen, zumal er bereitwillig Sonne oder Schatten akzeptiert. Auch Blauer Natternkopf ist herrlich und ganz pflegeleicht, wenn er einen sonnigen, durchlässigen Standort hat. Seine blau-lila Blüten triefen von Nektar und sind beliebt bei vielen verschiedenen Bienenarten. Oregano und Thymian lassen Ihren Garten nach Sommerwiesen duften und ziehen gleichzeitig summende Schwärme von Bienen, Schmetterlingen und Schwebfliegen an.
Einem verbreiteten Irrglauben zufolge sind etliche heimische Blumen »Unkraut«, aber Unkraut ist ja nur eine Pflanze, die da wächst, wo der Gärtner sie nicht haben will. Alle Blumen sind irgendwo heimisch, es gibt also keinen grundlegenden Unterschied zwischen heimischen und nicht heimischen Pflanzen, Unkraut und Nicht-Unkraut. Sie können auf einen Schlag alles Unkraut in Ihrem Garten loswerden, indem Sie es einfach zu Wildblumen umdefinieren. Allerdings gibt es durchaus einige Blumen – sowohl heimische als auch exotische –, die vielleicht mehr zur Selbstaussaat neigen, als es Ihnen recht ist. Löwenzahn setzt im April und Mai einen großartigen Farbakzent und ist sehr beliebt bei einigen unserer frühen Solitärbienen, aber seine Samen breiten sich ungebremst aus, wenn in der Nähe offene Stellen sind, die sie besiedeln können. Meine Wiese ist voll von Löwenzahn, und ich lasse sie auch blühen, aber dafür bezahle ich mit der kleinen Mühe, dass ich später im Jahr seine vielen Sämlinge aus den Beeten hacken muss. Ein wirklich freigeistiger Gärtner kennt kein Unkraut, aber diesen Zen-artigen Zustand der gleichmütigen Akzeptanz habe ich leider noch nicht erreicht, meine Hacke kommt also regelmäßig zum Einsatz. Aber statt meinen Willen mit schierer Kraft durchzusetzen, versuche ich meinen Garten sanft zu steuern, jäte rund um die Pflanzen, die ich fördern möchte, zupfe und schneide an denen, die ich zurückdrängen will. Wenn Sie nicht einen sehr kleinen Garten und sehr viel Zeit haben, endet das Streben nach vollständiger Kontrolle mit großer Wahrscheinlichkeit in schrundigen Händen, Enttäuschung und Frust.
Aus ökologischer Perspektive sind die gefährlichsten Unkräuter nicht unsere heimischen Pflanzen, sondern die exotischen Blumen, die wir anbauen. Von den Tausenden Pflanzenarten, die wir importiert haben, um unsere Gärten zu verschönern, sind eine Handvoll zu riesigen invasiven Schädlingen geworden, die in unserer Landschaft ihr Unwesen treiben. Am bekanntesten und schlimmsten sind wohl Pontischer Rhododendron,5 Japanischer Staudenknöterich, Drüsiges Springkraut und Riesen-Bärenklau, denn mit ihren dichten Ständen können sie die heimische Vegetation völlig verdrängen. Dabei waren sie einst alle scheinbar harmlose Gartenpflanzen, eingeführt und sorgsam umhegt wegen ihrer exotischen Blüten und ihres attraktiven Laubs. Aus praktischer Sicht sollte ein Gärtner am besten dafür sorgen, dass diese Invasoren im Garten gar nicht erst Fuß fassen und ihn dann als Sprungbrett in die Nachbarschaft nutzen. Natürlich ist die Gefahr, dass egal welche exotische Pflanze, die wir anbauen, vielleicht eines Tages zum Invasor wird, ein weiteres Argument dafür, wo immer möglich auf heimische Pflanzen zu setzen.
Bestäubern ist es vielleicht egal, wo eine Pflanze herkommt; anders ist das bei vielen pflanzenfressenden Insekten. Wie gesagt durchziehen Pflanzen ihre Blätter zur Abwehr mit chemischen Stoffen, und in ihrer Heimat gibt es wahrscheinlich Pflanzenfresser, die so adaptiert sind, dass sie diesen Verteidigungsmechanismus umgehen können. In einen britischen Garten versetzt, bleiben diese heimischen Insekten in der Regel aus. Daher haben exotische Pflanzen häufig wenige Fressfeinde außer Allesfressern wie Nacktschnecken und Kaninchen. Vielleicht finden Sie das vorteilhaft, schließlich gedeihen sie so ungestört; aber wenn Sie in Ihrem Garten möglichst viele wilde Tierarten fördern möchten, sollten Sie sich nicht allzu sehr über ein paar Blattläuse, Spitzkopfzikaden oder Raupen ärgern, die an den Blatträndern nagen. Wenn Sie heimische Königskerzen (Verbascum) pflanzen, haben Sie vielleicht Glück und bekommen die hübschen gelb-weiß gepunkteten Raupen des Königskerzen-Mönchs. Wenn Sie Lichtnelken pflanzen, sehen Sie höchstwahrscheinlich Raupen der Lichtnelken-Eule auf ihren Samen. Wenn Sie Wiesen-Storchschnabel pflanzen, könnten Sie vielleicht Storchschnabelrüssler bekommen. Diese Insekten sind selbst wiederum Beute für andere Insekten, Vögel, Fledermäuse und Amphibien, lauter Maschen im komplexen Netz des Lebens. Intuitiv erscheint es mir besser, heimische Pflanzen zu verwenden als nicht heimische, aber meines Erachtens braucht man sich an dieser Problematik nicht aufzuhängen.
Kritischer als die Frage, ob eine Pflanze heimisch ist oder nicht, dürfte die nach der besten Varietät sein. Pflanzenzüchter haben über Jahrhunderte die 70.000 Blumensorten hervorgebracht, die über Pflanzen- und Saatkataloge oder in Gartencentern verkauft werden. Ihr Ziel waren dabei ungewöhnliche Farben; zum Beispiel versuchen Tulpenzüchter seit fast 500 Jahren – und bisher ohne echten Erfolg –, eine vollkommen schwarze Tulpe zu züchten (die Sorte »Paul Scherer« ist nah dran, aber bei ganz genauem Hinsehen ist sie doch nur sehr dunkellila). Ziel sind auch größere Blüten, längere Blütezeiten, mehr Blütenblätter und alle möglichen Vorlieben, von denen man sich Käufer verspricht. Leider haben die Pflanzenzüchter bei diesem ganzen Prozess nie besonders die Bestäuber im Blick; Bienen sind nicht ihr Zielpublikum. Doch natürlich sind Bienen und andere Bestäuber ganz ausdrücklich das Zielpublikum der Wildblumen, von denen unsere Garten-Kulturpflanzen abstammen. Blumen und Bienen koevolvieren seit etwa 120 Millionen Jahren, und die heutigen Blüten sind raffiniert ausgetüftelte und häufig höchst komplexe Mechanismen, die eine effiziente Bestäubung garantieren sollen. Wenn wir anfangen, mit Blumen herumzuexperimentieren, sie für unsere eigenen Zwecke zu verändern, muss dabei mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Funktion dran glauben. Schnelle künstliche Selektion nach bestimmten Merkmalen bringt oft ungewollte Folgen mit sich, sodass viele der bunten Beetpflanzen, die wir vielleicht kaufen, keinen Duft haben oder keinen Nektar, oder es sind sterile Hybride ohne Pollen, oder ihr Blütenaufbau macht sie für Bestäuber unzugänglich. In meinem eigenen Garten habe ich zwei Zwergkirschen mit gefüllten Blüten geerbt. Eine normale Kirschblüte hat fünf Kronblätter, die als breite Schale rund um die Pollen tragenden Staubblätter und um das zentrale Nektarium angeordnet sind – sie bietet also Essen und Trinken für vorbeikommende Insekten. Die gefüllten Blüten an meinen Bäumen dagegen haben ein Wirrwarr aus zwanzig Kronblättern und keine Staubblätter. Mit all diesen zusätzlichen Blütenblättern sehen sie von Weitem ziemlich hübsch aus, aber ohne Staubblätter haben sie keinen Pollen, und an die Nektarien kommen die Bienen nicht heran – für Insekten sind sie also uninteressant. Daneben wächst ein normaler Kirschbaum, der Ende April von Insekten summt und brummt, während bei den beiden Bäumen mit gefüllten Blüten großes Schweigen herrscht. Sie stören mich, sie sind eine Karikatur, Mutanten, deren Verbindung zum natürlichen Bestäubungsprozess mutwillig gekappt wurde. Seit mehreren Jahren juckt mich mein Kettensägenfinger, aber ich bringe es auch nicht über mich, sie zu fällen, schließlich ist ein Baum ein Baum, und davon gibt es auf der Welt ohnehin nicht genug.
Gefüllte Blüten sind gar nichts Neues. Sie kommen natürlich als Mutanten vor, die in der Selektion normalerweise rasch aus der Population ausgesondert würden, denn Unattraktivität für Bestäuber ist in der Natur natürlich ein riesiger Nachteil. Gefüllte Rosen beschrieb schon der griechische Philosoph Theophrast im Jahr 286 vor Christus, seit jeher werden sie gezüchtet und über Stecklinge vermehrt. Die meisten Gartenrosen haben gefüllte Blüten, auch die klassischen Edelrosen, die man vielleicht zum Valentinstag verschenkt oder geschenkt bekommt. Eine Bienenkönigin wäre freilich nicht besonders beeindruckt, wenn eine Drohne ihr damit käme. Zum Glück verkaufen Gartencenter in der Regel auch einblütige Rosen, die mehr den natürlichen Vorfahren ähneln und für Bestäuber Leckerbissen sind.
Auch viele andere Zierpflanzen werden häufig als gefüllte Sorten verkauft; unter vielen anderen Nelken, Kamelien, Pfingstrosen und Akeleien. Mein lokaler Supermarkt bietet zurzeit gefüllte Stockrosen an; die einblütigen Sorten sind für Bienen großartig, aber diese bringen gar nichts. Am liebsten würde ich in den Laden gehen und mich beschweren, aber mir ist klar, dass das unvernünftig und sinnlos wäre, wahrscheinlich würden sie mich rauswerfen und mir den Gratiskaffee streichen, ich habe mich also bisher zusammengerissen. Schließlich leben wir in einem freien Land, und wenn die Leute solche Abscheulichkeiten in ihrem Garten haben wollen, viel Glück; nur sollen sie wenigstens wissen, was sie da tun.
Auch ohne größere Mutationen wie gefüllte Blüten sind Blumensorten für Bestäuber sehr unterschiedlich attraktiv. Internet, Bücher und Zeitschriften strotzen von Ratschlägen, welche Pflanzen man setzen soll, um Insekten anzulocken. Eine solche Liste wurde vom britischen Gartenbauverein (RHS) veröffentlicht, sie ist sehr lang, 198 Pflanzengattungen stehen darauf. Die RHS verleiht auch ein »Bienenfreundlich«-Label, das Gartencenter auf die Etiketten kleben können, um den Käufern zu signalisieren, welche Pflanzen auf dieser Liste stehen – »Perfect for Pollinators«, prangt dann da. Auch die britische Umweltbehörde Natural England hat so eine Liste publiziert.6 Um mithalten zu können, habe ich eine auf meine Uni-Website gestellt. Aber wie gut sind diese Listen überhaupt? Ken Thompson sagt von der von Natural England, sie sehe sehr so aus, »als wäre sie am späten Freitagnachmittag zusammengebastelt« worden. Mihail Garbuzov, Doktorand bei meinem Kollegen Francis Ratnieks an der Sussex University, hat einen Vergleich von 15 solchen Listen veröffentlicht und verweist auf mehrere gemeinsame Schwächen. Erstens decken sich die Listen erstaunlich wenig, keine Pflanze steht auf allen Listen und sehr viele nur auf einer oder zwei. Das lässt vermuten, dass man sich nicht ganz auf sie verlassen kann, und einen angehenden Naturgärtner, der die Sache so ernst nimmt, dass er mehrere Listen zur Hand nimmt und vergleicht, dürften sie jedenfalls verwirren. Zweitens beruht keine der Listen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Idealerweise würde man die ganzen verschiedenen Sorten nebeneinander in identischen Versuchsbeeten anpflanzen und dann erfassen, wie viele Insekten sie jeweils das Jahr über besuchen. Da verschiedene Pflanzen auf verschiedenen Böden und in unterschiedlichen Mikroklimata gedeihen, sollte man das an mehreren Standorten überall im Land wiederholen. Bei einer Auswahl von 70.000 Pflanzensorten wäre das schon ein ordentliches Experiment – wie beim Heimisch-gegen-nicht-heimisch-Experiment ist es also unwahrscheinlich, dass irgendjemand das jemals machen wird. Natürlich hätten auch kleiner angelegte Studien ihren Wert, und Mihail hat es auch alleine versucht.
Da diese Listen weitgehend auf den persönlichen Erfahrungen ihrer Autoren beruhen, von denen manche vielleicht kein besonders großes Fachwissen mitbringen (und manchmal vielleicht aus Faulheit einfach ältere Listen recyceln), enthalten sie zum Teil schlicht und ergreifend Fehler. Auf einer Liste standen zum Beispiel Petunien, die kaum bis nie von Insekten besucht werden und sich auf einer Shortlist für die besten Bienenpflanzen sehr merkwürdig machen. Andere, sehr attraktive Pflanzen fehlten auf den meisten Listen; so ergaben etwa Mihails Feldversuche, dass einige Dahliensorten wie »Bishop of Llandaff« und »Bishop of York« ein Paradies für Hummeln sind (seit ich das in meinem Garten ausprobiert habe, kann ich es begeistert bestätigen), doch auf den meisten Listen kamen Dahlien überhaupt nicht vor. Auch Duftnesseln werden selten genannt, obwohl sie für Bienen hochattraktiv sind. Es steht zu befürchten, dass Gärtner Pflanzen, die nicht auf diesen Listen stehen, für Bestäuber für ungeeignet halten, dabei ist das wirklich nicht zwangsläufig der Fall.
Ein letzter Schwachpunkt dieser Listen ist, dass sie normalerweise nicht eine bestimmte Pflanzensorte nennen, sondern einen Trivialnamen wie Lavendel oder eine Gattung wie Allium. In der Gattung Lavandula gibt es 47 Lavendel-Arten, und manche von ihnen existieren in einem Dutzend oder mehr verschiedenen Sorten für den Garten – Zwergsorten, weißblütige statt der üblichen violetten, Sorten mit mehrfarbigen Blättern und so weiter. Die Gattung Allium umfasst an die 800 wilde Arten, dazu Hunderte Kulturpflanzensorten einschließlich Schnittlauch und Zwiebeln – die Empfehlung ist also ziemlich vage. Welche Sorten eignen sich am besten? Wieder lässt sich das eigentlich nur herausfinden, indem man sie nebeneinander anpflanzt. Mihail hat das mit 13 verbreiteten Lavendelsorten aus drei verschiedenen Arten getan und herausgefunden, dass es enorme Unterschiede gibt. Insgesamt erwies sich Englischer Lavendel, Lavandula x intermedia (eine Kreuzung aus Lavandula angustifolia und Lavandula latifolia), als viermal so gut wie der verbreitete Schmalblättrige Lavendel, gemessen an der Anzahl von Insekten pro Quadratmeter Pflanze. Und noch innerhalb des Englischen Lavendels variierten die beste und die schlechteste Sorte vom Einfachen zum Doppelten: »Gros Bleu« war am besten und »Old English« am schlechtesten. Zwar kann man durchaus sagen, dass Lavendel grundsätzlich bienenfreundlich ist, aber noch hilfreicher wäre eine genaue Angabe, welchen Lavendel man pflanzen soll – und das steht auf den meisten Listen nicht.
Wenn Sie jetzt ein bisschen verwirrt sind, ist das ganz in Ordnung. Wer hätte schon gedacht, dass es so kompliziert ist, Pflanzen für den Garten auszusuchen? Nur wenige Menschen dürften genügend Zeit und Begeisterung mitbringen, um detailliert nachzuforschen, welche Pflanzen und welche Sorten sich am besten eignen. Um es etwas einfacher zu machen, habe ich hinten im Buch eine kurze Liste getesteter und bewährter Lieblinge zusammengestellt; sie wurden nicht alle in einem ordentlichen Experiment getestet, sondern die Auswahl beruht auf einer Mischung aus Mihails Arbeit, wiederholten Empfehlungen anderer und meinen eigenen formlosen Versuchen; mit Gewissheit kann ich sagen, dass sie in meinem Garten alle sehr viele Insekten anlocken.
Eine Alternative zum Listenlesen besteht darin, einfach im Frühling oder Sommer ins Gartencenter zu gehen und die Insekten sagen zu lassen, was Sie kaufen sollen. Die meisten Pflanzen in der Auslage von Gartencentern stehen in voller Blüte, und das wirkt auf potenzielle Kunden genauso verlockend wie auf potenzielle Bestäuber. Gehen Sie an einem ruhigen Tag hin, am besten außerhalb der Stoßzeiten am Wochenende, und bleiben Sie eine Weile ganz ruhig stehen. Lassen Sie Ihren Blick über die ordentlichen, alphabetisch sortierten Reihen von Grünzeug schweifen, und dann sehen Sie schon, wie es sich bewegt; Bienen, Schmetterlinge und Schwebfliegen umkreisen ihre Lieblingsblumen und meiden den Schund. Bei so viel Auswahl können Sie sicher sein, dass eine Pflanze, die von mehr als einem Insekt oder wiederholt besucht wird, wirklich gut ist. Das ist viel verlässlicher als Logos mit Bienenporträts. Wenn Sie genug Geld haben, kaufen Sie einfach die Pflanzen, auf denen die Bienen sitzen. Und wenn Sie arm, aber mit Geduld gesegnet sind, merken Sie sich die Sorte und kaufen Sie Samen, die Sie zu Hause großziehen. So können Sie auch sicher sein, dass Ihre Pflanzen pestizidfrei sind, und mit ein bisschen Glück haben Sie am Ende so viele Setzlinge, dass Sie sie mit Ihren Freunden und Nachbarn teilen können.
Es gibt wirklich keinen Grund, sich wegen der Pflanzenauswahl für den Garten verrückt zu machen. Jede Pflanze ist besser als Beton oder Pflaster, und je mehr Pflanzen und je unterschiedlichere Sie haben, desto besser. Wenn ein paar davon wirkliche Bienenweiden sind und vielleicht ein paar heimische Wildblumen und blühende Büsche, dann summt Ihr Garten bald von Insekten. Wenn Sie dann noch Ihre Nachbarn überzeugen, es Ihnen nachzutun, dann könnte Ihre Straße demnächst ein Tempel für diese kleinen, aber unverzichtbaren Biester werden.
Die Gartenwiese
Rezept für Quitten-Crumble
ZUTATEN: 400 g geschälte, gewürfelte Quitten, 400 g geschälte, gewürfelte Äpfel, 2 TL Honig, 100 g Butter, 100 g Haferflocken, 100 g Weizenvollkornmehl, 100 g brauner Zucker, gemahlener Zimt
Obst und Honig in eine große, flache Form geben, mit Zimt bestäuben.
Butter, Haferflocken, Mehl und Zucker vermengen und zu Streuseln verkneten. Auf dem Obst verteilen.
30 Minuten bei 160°C backen, bis die Streusel hellbraun sind und der Saft kocht.
Quitten sind herrlich aromatisch, ich verstehe nicht, warum sie nicht verbreiteter angebaut und verwendet werden. Dieser Crumble schmeckt köstlich mit Vanillesoße (mein Favorit) oder mit Vanilleeis.
Mittelpunkt der meisten Gärten ist der Rasen. Er ist natürlich nicht der größte Blickfang, aber üblicherweise liegt er in der Mitte des Gartens, nimmt viel Platz ein und soll andere Elemente wie Beete gut zur Geltung bringen. Wir Briten lieben unseren Rasen. Wir hegen und pflegen ihn, mähen ihn in ordentlichen Streifen und trimmen die Kanten mit halbkreisförmigen Werkzeugen, die eigens zu diesem Zweck erfunden wurden. Wir spielen darauf Crocket, Cricket und Tennis, und dann sitzen wir zur Entspannung darauf und nippen Gin Tonic oder Pimm’s. Was wären Wimbledon, der britische Sommer oder Cream Tea ohne Rasen?
Nirgends passt das Sprichwort »Über Geschmack lässt sich nicht streiten« besser als in Sachen Rasen. Mein Vater liebt seinen Rasen, und für ihn muss ein Rasen gepflegt, grün und streifig sein. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er in meiner Kindheit alle paar Monate mit einem merkwürdigen elektrischen Apparat darüber fuhr, der Berge von Moos herausriss. Mir war nie klar, was er eigentlich gegen das Moos hatte, außerdem schien es mir sinnlos, weil es immer wiederkam, aber er blieb hartnäckig. Er hatte einen benzingetriebenen Zylinder-Rasenmäher, mit dem er alle ein oder zwei Wochen ordentlich gerade Streifen schnitt. Heute ist er 84, und den Rasen in seinem kleinen Garten mäht er immer noch selbst, mit einem Leichtbau-Elektromäher, den ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe. Außerdem bezahlt er heute eine Firma, die im Frühling und Sommer ungefähr einmal im Monat vorbeikommt und selektive Unkrautvernichter sowie Dünger auf seinen Rasen kippt. Daher gibt es kein Moos, und sein Rasen ist eine ganz hellgrüne grasige Monokultur; er ist glücklich.
Als Dad mir von seiner Rasenpflegefirma erzählte, wurde ich neugierig. Bei einer kleinen Online-Recherche stieß ich auf eine ganze Rasenpflegeindustrie, deren Existenz mir bisher entgangen war. Dutzende überregionale Unternehmen übernehmen gegen Bezahlung die Rasenpflege wie bei meinem Vater. Sie bieten eine Analyse des Rasens und diagnostizieren die passende Behandlung, wenn er irgendwie verfärbt oder ungesund wirkt. Ihre ausgebildeten Mitarbeiter vertikutieren nicht nur, sie bieten auch eine Lüftung mit Aerifizierstechern (was immer das sein mag), Unkrautvernichtung, Spitzenpflege, Flechtenentfernung, Nachsaat und sogar ein komplettes Rasen-Erneuerungsprogramm, wenn Sie Ihren armen Rasen wirklich vor die Hunde haben gehen lassen. Selbstverständlich entfernen sie schnell und fachmännisch lästigen Rasenfilz (eine Schicht aus totem Gras), Engerling-Befall, Rotspitzigkeit (eine Pilzerkrankung des Rasens), Wiesenschnakenlarven, Maulwürfe oder jede der unfassbar vielen anderen Widrigkeiten bei Anlage und Erhalt des perfekten Rasens. Eine der Websites schreibt: »Es kostet Zeit und Mühe, das Beste aus Ihrem Gras zu holen.« Nun denn.
Natürlich gibt es eine Alternative zum makellosen Wimbledon-Rasen, die obendrein sehr viel billiger ist. Sie können sich entscheiden, auf das Sondereinsatzkommando spezialisierter Facharbeiter zu verzichten, die ganzen chemischen Präparate, das Vertikutieren und das Nachsäen bleiben zu lassen und bis auf gelegentliches Mähen mehr oder weniger gar nichts zu tun. Dann könnten Sie einfach sehen, was passiert; es wäre Ihr ganz privates Mini-»Rewilding«-Projekt.7 Für manche von uns ist das Ergebnis weitaus hübscher als der klassische streifige Rasen, den mein Vater so liebt, obwohl das natürlich vor allem Ansichtssache ist. Auch hängt es, glaube ich, sehr stark davon ab, was Sie gewohnt sind. Wir Menschen mögen grundsätzlich keine Veränderungen; die meisten von uns sind Langweiler, die sich schnell an die bestehende Welt gewöhnen und der Meinung sind, dass sie für immer und ewig so bleiben soll. Wenn wir nun einmal daran gewöhnt sind, dass der Stadtpark alle vierzehn Tage gemäht wird oder dass die Kreisverkehre auf dem Weg zur Arbeit von den Stadtgärtnern mit dem Rasentrimmer kurz gehalten werden, dann neigen wir zum Protest, wenn das Mähen und Trimmen aufhört. Für viele Menschen muss Gras kurz geschnitten sein. Alles andere ist ungepflegt oder zeugt von Faulheit oder Budgetengpässen. In den USA ist in vielen Städten regelmäßiges Rasenmähen vorgeschrieben. Die Kommunen definieren eine maximale Rasenhöhe, und wenn man die überschreitet, bekommt man ein Bußgeld – amerikanische Umweltschützer und Naturgartenfreunde frustriert das ohne Ende. Es ist schon ziemlich bitter, dass man im »Land der Freiheit«, wo man legal eine Maschinenpistole kaufen kann, nicht die Freiheit hat, sein Gras wachsen zu lassen.
Zum Glück haben wir solche Gesetze hier nicht, aber wenn man sich dafür einsetzt, weniger zu mähen, kann man sich zumindest am Anfang doch ziemlich viele Beschwerden einfangen. 2014 beschloss der Stadtrat von Peterborough, in sieben Stadtparks Wildblumenwiesen stehen zu lassen, die nur einmal im Jahr geschnitten werden; ein paar weitere Areale sollten nur dreimal im Jahr geschnitten werden. Damit sparte man jährlich 24.000 Pfund an Arbeits- und Benzinkosten, aber sie ertranken in Beschwerdebriefen und -Mails. »Der Park ist ja scheußlich mit diesem hohen Gras, wie sollen unsere Kinder darin spielen?«, schrieb die Anwohnerin Stella, und Tariq ergänzte: »Wie kann man überhaupt noch von einer schönen Stadt reden, wenn die Parks derart vernachlässigt werden?« Außerdem stehen Gärtner unter sozialem Druck, sich der Norm zu fügen und den kurz geschnittenen Status quo einzuhalten. Eine Studie von Mark Goddard an der Leeds University zeigte, dass die meisten Freizeitgärtner meinen, ihre Nachbarn wären misstrauisch oder ganz dagegen, wenn sie ihren Rasen zu hoch wachsen ließen, und viele fürchten Beschwerden. Andererseits zeigt Marks Arbeit auch, dass dieser Austausch über den Gartenzaun auch in die richtige Richtung gehen kann; viele ahmen die Nachbarn nach, und persönliche Tipps von Freunden, Verwandten und Nachbarn haben am meisten Einfluss darauf, wie die Leute ihren Garten bewirtschaften. Die meisten Befragten waren auch der Meinung, ihre Nachbarn würden ihre Gartenpraxis bewundern oder imitieren, und das auch, wenn sie sich bemühen, natürlichen Lebensraum zu schaffen. Vielleicht könnten wir mit ein bisschen Nudging ganze Nachbarschaften dazu bringen, sich über die besten Methoden zur Förderung natürlicher Lebensräume auszutauschen und miteinander um die größte Artenvielfalt zu wetteifern, statt sich wegen der Rasenlänge in die Haare zu geraten.
Natürlich gibt es gute Gründe, warum wir der Umwelt zuliebe weniger häufig mähen sollten. Mähen kostet schon einmal Energie – Benzin oder Strom –, das ist teuer und steigert den CO2-Ausstoß. Auch bei den Lohnkosten lassen sich, wie der Stadtrat von Peterborough merkte, erhebliche Einsparungen erzielen. Für den privaten Gartenbesitzer heißt weniger Mähen auch, weniger Stunden schwitzend hinter einem staubigen Rasenmäher herzulaufen, und damit mehr Zeit, um Pimm’s zu nippen oder auf dem Bauch zu liegen und Asseln zu beobachten. Höheres Gras verträgt Trockenheit besser, Sie müssen es also nicht gießen und sparen schon wieder eine wertvolle Ressource.8 Auch für das natürliche Tier- und Pflanzenleben bedeutet selteneres Mähen einen enormen Nutzen. In einem kurz geschnittenen Rasen können sich nur sehr wenige Lebewesen halten, höchstens die hässliche Wiesenschnakenlarve unter der Erdoberfläche (wenn Sie nicht dafür bezahlt haben, dass sie ausgerottet wird). Das Mähen verhindert die Blüte, es gibt also keine Farbe und keinen Nektar oder Pollen für Insekten. Vielleicht ist für Sie ein Rasen einfach nur Gras, was sollte da schon blühen (außer dem Gras selbst, das als Windbestäuber natürlich unansehnliche grüne Blüten hat). Aber wenn Ihr Rasen nicht sehr jung ist, enthält er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sehr viele Stauden in Wartehaltung – in der Hoffnung, dass irgendwann der Tag kommt, an dem sie blühen können. Ken Thompson untersuchte bei seiner Studie in den Gärten von Sheffield auch die Rasenflächen; eine Zählung in 52 Rasen ergab 159 unterschiedliche Blütenpflanzen, und auf einem Quadratmeter gab es durchschnittlich ähnlich viele Arten wie in einer halb natürlichen Wildblumenwiese. In einem regelmäßig gemähten Rasen überleben diese Pflanzen, indem sie sich an die Erdoberfläche schmiegen und horizontal wachsen; sie reproduzieren sich vegetativ über Ausläufer oder Rhizome. Sobald Sie aufhören zu mähen, werden sie geradezu explodieren.
Mein Rasen ist mindestens zwölf Jahre alt, und obwohl er bestimmt aus einer einfachen Rasensaatmischung stammt, enthält er jetzt Gänseblümchen, Löwenzahn, Hahnenfuß, Kleine Braunelle, Veilchen, Ehrenpreis, Falschen Löwenzahn, Rot- und Weißklee, Gundermann, Jakobsgreiskraut, Gewöhnlichen Hornklee und jede Menge Moos. Eine genauere Untersuchung würde sicher noch viele weitere Arten zum Vorschein bringen. Schon nach etwa einer Woche ohne Rasenmäher blühen die ersten Blüten auf; aber im Jahresverlauf sind es ganz unterschiedliche Arten: Löwenzahn, Veilchen und Gänseblümchen blühen im Frühling als Erste, gefolgt von Hahnenfuß und Klee und im Sommer von Falschem Löwenzahn und Kleiner Braunelle. Durch den gesamten Frühling und Sommer folgen einander die hübschesten weißen, gelben und lila Blüten, die natürlich alle Insekten anlocken; Honigbienen, Hummeln, Mauerbienen, Hainschwebfliegen und viele mehr. Es ist eine Schande, das alles niederzumähen, wennglich meine Frau und ich uns in Sachen optimaler Mähfrequenz etwas uneinig sind; ich würde über Monate hinweg alles wachsen und blühen lassen, aber Lara mag es etwas ordentlicher und holt den Rasenmäher heraus, wenn ich nicht da bin. Trotzdem ist die Wiese im Frühling und Sommer lange bunt gesprenkelt und schwirrt und summt von Bienen.
Natürlich braucht ein Rasen auch weder Dünger noch Pestizide. Gras kommt seit Millionen Jahren ohne unsere Hilfe zurecht. In einem gesunden Garten sollte es eine vielfältige Gemeinschaft von Insekten geben, Tausendfüßer, Hundertfüßer, Nacktschnecken, Regenwürmer, und gar nicht zu reden von zahllosen Mikroorganismen, die unter der Grasnarbe im Boden leben. Wenn man genau hinschaut, findet man vielleicht auch ein paar bodennistende Bienen, etwa die hübsche Rotpelzige Sandbiene. Ein paar dieser Tierchen, etwa Maikäfer-Engerlinge, Erdraupen (die Raupen bodenbewohnender Eulenfalter) und Wiesenschnakenlarven, ernähren sich vielleicht von den Graswurzeln, da entsteht also hin und wieder ein kleiner brauner Fleck, weil deshalb das Gras verdorrt ist. Jetzt könnten Sie ins Gartencenter fahren, Pestizide kaufen und auf den Rasen kippen, oder Sie könnten die Experten zu Hilfe rufen, aber müssen Sie das wirklich? Für mich sind ein paar kleine, zeitweilig braune Flecken kein besonders hoher Preis für ein gesundes Ökosystem. Diese Bodeninsekten sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Wiesenschnakenlarven sind ein Lieblingsessen des Stars, und Stare sind in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen, seit Mitte der 1970er-Jahre ist ihre Population um zwei Drittel geschrumpft. Wenn die weniger werdenden Stare die Larven nicht erwischen, schlüpfen Wiesenschnaken, und die adulten Eulenfalter aus den Erdraupen holen sich einige unserer größeren Fledermäuse. Ausgewachsene Maikäfer sind spektakuläre, hübsche Käfer, kastanienbraun, weiß und schwarz mit prächtigen gefächerten Fühlern, mit denen sie durch die Luft schnuppern. Mein jüngster Sohn hat einen Maikäfer als Haustier, er heißt Colin und wohnt, während ich dieses Buch schreibe, in einer Tupperdose in seinem Zimmer. Warum diese Tierchen gejagt werden, ist mir völlig schleierhaft. Abgesehen davon bringt jedes Pestizid, das man verwendet, sowohl das unerwünschte Insekt um als auch mehr oder weniger alles andere, und Ihr Boden wird in seiner Gesundheit nachhaltig geschädigt. Getroffen werden auch die räuberischen Insekten wie Laufkäfer und Käfer aus der Familie der Kurzflügler, die helfen, Schädlinge wie Nacktschnecken in Schach zu halten, sodass Sie am Ende sogar mit schlimmeren Schädlingen dasitzen als vorher. In Sachen Rasenpflege gilt definitiv: Weniger ist mehr.9
Die meisten von uns wollen einen Rasen, auf dem sie sitzen, spielen oder trinken können, aber wenn Sie Platz haben, könnten Sie versuchen, außerdem noch eine Blumenwiese unterzubringen. Bei einer Wiese gehen Sie mit dem Konzept »weniger mähen« einen Schritt weiter und mähen nur einmal (oder vielleicht zweimal) im Jahr, wie es bei einer traditionellen Heuwiese üblich war. Ich finde es nicht wahnsinnig schlimm, wenn Lara gelegentlich allzu eifrig unseren Rasen mäht, denn der Großteil unseres Gartens ist sowieso Wiese und Obstgarten; wenn sie also den Klee im Rasen niedermäht, brauchen die Bienen nur ein paar Meter weiterzufliegen und haben in der Wiese Alternativen zur Verfügung. In sehr viel größerem Maßstab habe ich schon einmal eine Wildblumenwiese angelegt, und zwar in Mittelfrankreich – das beschreibe ich in Wenn der Nagekäfer zweimal klopft –, aber eine Wiese braucht überhaupt nicht groß zu sein. Früher waren im britischen Flachland überall Wiesen; in den 1930er-Jahren gab es wahrscheinlich noch 2,8 Millionen Hektar Wiesen, heute sind nur noch etwa zwei Prozent davon übrig; den Rest hat die Industrialisierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert weggefegt. Dieser gigantische Verlust an blütenreichen Lebensräumen ist einer der Hauptgründe für den Niedergang der unterschiedlichsten Tiere von der Deichhummel bis zur Wiesenralle. Heute besteht ein großes Interesse, diese Wiesen zu restaurieren und neu anzulegen, und jeder von uns kann dazu beitragen, indem wir in unseren Gärten Mini-Wiesen anlegen.
Schon ein Quadratmeter ist ein guter Anfang, wenn Sie mehr nicht abgeben können. Methoden, eine Blumenwiese anzulegen, gibt es viele, aber am einfachsten ist es, einfach nicht mehr zu mähen (bis auf eine Mahd im Spätsommer; das Schnittgut entfernen) und abzuwarten, was passiert. Die Vegetation wird hochschießen, und die vorhandenen Stauden werden sehr schnell sichtbar, wenn sie blühen und über den Sommer Samen ansetzen. Wenn Sie rund um Ihre Wiese gelegentlich mähen, sieht es sogar auffallend ordentlich aus; der Gegensatz zwischen kurzem und hohem Gras lässt die Stelle eher gepflegt aussehen als vernachlässigt. In meiner Wiese schaffe ich diesen Effekt, indem ich ein paar gewundene Pfade mähe. Wenn man da durch den Garten spaziert, fühlt man sich wie bei einem kleinen Abenteuer; im Frühsommer ist das hohe Gras neben dem Pfad hüfthoch.
Wenn Sie finden, dass es auf Ihrer neu angelegten Wiese wenige oder gar keine Blumen gibt, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kaufen Sie in einer Baumschule ein paar Wildblumen – Acker-Witwenblumen, Flockenblumen oder Magerwiesen-Margeriten bieten sich gut an – und pflanzen sie; etwa ein Jahr lang sollten Sie rundherum per Hand das Gras zurückschneiden, bis sie gut angewachsen sind. Viel billiger ist es, Wiesenpflanzen in Pflanzschalen aus dem Samen zu ziehen, sie in Töpfe umzusetzen und schließlich ins Freie zu setzen. Oder Sie graben die Stelle im Frühling oder im Frühherbst um und säen eine Samenmischung für Wildblumenwiesen. In Stirling in Zentralschottland gibt es eine tolle kleine Gruppe Freiwillige, die ihre Wochenenden mit nichts anderem verbringen. Sie haben mich im Lokalradio über ein paar Hummelsorten reden hören, die »drauf und dran sind auszusterben«, und es ehrt mich, dass sie sich den Namen On The Verge gegeben haben (»drauf und dran«). Sie bequatschen alle Besitzer oder Pächter von sogenanntem »Freizeitrasen« (also langweiligem, kurz geschorenem Gras) und überreden sie, die Gruppe Wildblumen säen zu lassen. Beim letzten Stand gab es rund um Stirling 52 Wildblumenstreifen, an Straßenrändern, Kreisverkehren, in öffentlichen Parks, Schulhöfen und Wiesen eines Rugby-Clubs. Ich schickte eine fleißige Studentin, Lorna Blackmore, um dort Insekten zu zählen, und sie stellte fest, dass die Wildblumen 15 Mal so viele Schwebfliegen und 50 Mal so viele Bienen anlockten wie die benachbarten unveränderten Rasenflächen.
Ähnliche lokale Initiativen gibt es auch andernorts, von Brighton über Liverpool bis Newcastle, aber wäre es nicht wunderbar, wenn wir das überall machen würden? Vielleicht sollte die Grundausbildung für jeden, der in der Park- und Straßenpflege tätig ist, eine Schulung über die Einrichtung von Wildblumenhabitaten