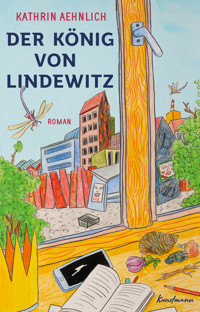9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Roswitha Sonntag reist nach New York. Sie ist gerade geschieden worden, und es war die Frage ihres Mannes, die den Ausschlag für die Reise gegeben hat: "Warum hast du eigentlich Mick nie besucht?" Mick war im Studium ihr bester Freund und der Mittelpunkt ihrer Clique, die damals in den 80er-Jahren in Leipzig unzertrennlich war und unbesiegbar. Gemeinsam nutzten sie die kulturellen Freiräume, die sich in einem Land öffneten, das langsam in Agonie versank. Sie fotografierten, drehten Filme mit einer russischen Super-8-Kamera, führten eine Rock-Oper auf, und die Musik aus dem Feindesland Amerika lieferte den Soundtrack dazu. Als sie am Ende des Studiums in einen Alltag zurückgeworfen werden, den sie so nie leben wollten, tauchen merkwürdige Leute bei ihnen auf. Zuerst lachen sie darüber und geben den Genossen den Namen "Handwerker". Aber die Handwerker verstehen ihr Handwerk, und nicht jeder kann ihnen standhalten. Kathrin Aehnlich erzählt von den letzten Jahren der DDR so lakonisch, heiter und atmosphärisch, dass man den Putz an der Wand bröckeln sieht. "Wenn die Wale an Land gehen" ist ein wunderbarer Roman über Träume, Zusammenhalt, große und kleine Fluchten und über die Sehnsucht nach einem anderen Leben, die bis heute nachwirkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kathrin Aehnlich
WENNDIE WALEAN LANDGEHEN
Roman
Verlag Antje Kunstmann
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
»There are more love songs than anything else. If songs could make you do something, we’d all love one another.«
Frank Zappa, Playboy 1993
1
SIE BETRAT DAS LAND der unbegrenzten Möglichkeiten durch einen schlecht beleuchteten Tunnel. Es gab keine Marmorböden, kein spiegelndes Glas, keine großzügigen Stahlkonstruktionen. Enttäuscht lief sie unter flackernden Neonröhren durch ein Labyrinth aus schmutzig weißen Gipswänden, an denen selbst Werbeplakate ein Trost gewesen wären. Jeder Schritt schmerzte, als müssten sich die Füße erst wieder an die ungewohnte Tätigkeit des Laufens erinnern. Sie hatte Mühe, im Rhythmus zu bleiben und ihrem Vordermann nicht in die Hacken zu treten. Eingekeilt zwischen Rucksäcken und Rollkoffern trottete sie einem unbekannten Ziel entgegen und war plötzlich gar nicht mehr sicher, ob sie es überhaupt erreichen wollte. Doch es gab kein Entrinnen. An Weggabelungen standen bewaffnete Polizisten und achteten darauf, dass sie in der Herde blieb. Klaglos folgte einer dem anderen. Selbst die Kinder liefen gehorsam an der Hand ihrer Eltern. Wie die Lemminge, dachte sie.
Ach, die Lemminge.
Schon hoch über den Wolken hatte sich ihr, im Dämmerzustand zwischen Wachheit und Schlaf, die Erinnerung aufgedrängt. Auch nach so vielen Jahren war alles überraschend präsent. Die Lemminge waren ihr Schicksal gewesen. »Damals«, als sie im Land der Lemminge lebte und an einer Ingenieurschule studierte.
Es war Anfang der 1980er-Jahre gewesen. Sie erinnerte sich genau. Die ersten Semesterferien standen kurz bevor. Sie wollten über den Innenhof in die Mensa laufen, als sich ihr ein Student in den Weg stellte und in einem Ton, der keine Verweigerung zuließ, nach ihrem Namen fragte.
»Roswitha«, stammelte sie verunsichert.
Und er sah sie eine Zeit lang mitleidig über seinen Brillenrand hinweg an und rieb sich dann mit dem Finger das linke Auge. Ein Vorgang, der unspektakulär gewesen wäre, hätte er nicht direkt durch die Fassung gegriffen. Seine Brille hatte nur ein Glas, und beide Bügel waren mit Heftpflaster angeklebt.
»Hi, Rose«, sagte er nach einer langen Pause und nahm seine Brille ab. Die Bügel klappten wie gebrochene Flügel nach außen, doch er achtete nicht darauf.
»Mick«, sagte er und sah sie an. »Mick wie … du weißt schon.«
Er hatte hellgraue Augen mit einem Hauch Grün.
»Hast du morgen Nachmittag Zeit?« In seinen Pupillen tanzten helle Punkte. »Für mich?«
Sie fühlte, wie sie rot wurde, und hoffte, dass er es nicht bemerkte.
»Ich brauche Lemminge«, sagte er.
Sie sah ihm verwirrt dabei zu, wie er seine Brille wieder aufsetzte und umständlich das Heftpflaster an den Bügeln festdrückte. »Morgen, vier Uhr«, sagte er und sah ihr noch einmal in die Augen. »Und vergiss deine FDJ-Bluse nicht!« Er ging, ohne sich umzudrehen.
Sie blieb in einem Zustand zurück, für den sie im Nachhinein nur das Wort »verdattert« fand, denn es schloss, neben der Verunsicherung, den Zweifel an der eigenen Zurechnungsfähigkeit ein. Was waren Lemminge? Und wozu sollte sie ihre ungeliebte Jugendverbandsbluse anziehen? War er ein Tierfreund, der Sex in Verkleidungen liebte? Oder hatten ihn die Genossen geschickt und alles war nur ein Anwerbeversuch der Partei?
Zu Hause hatte sie sofort im Lexikon nachgeschlagen und mit Entsetzen gelesen, dass Lemminge stummelschwänzige Wühlmäuse waren, die kollektiv in den Tod sprangen.
Auch den Lemmingen, in deren Mitte sie stoisch durch die Flughafengänge taumelte, traute sie einen gemeinsamen Selbstmord zu, und sie war erleichtert, als sie endlich eine Halle erreichten. Doch auch hier durfte niemand den Tross verlassen. Vor ihnen lag eine mit schwarzen Seilen markierte Slalomstrecke. Brav formierten sich alle zu einer ordentlichen Reihe und durchliefen den Parcours im Gänsemarsch. Unter der Decke hingen große Bildschirme, die ihnen zeigten, was am Ende auf sie zukommen würde. In einem Werbefilm prüfte ein freundlicher Offizier den Pass einer Chinesin. Es folgte eine Spanierin, dann ein Afrikaner. Deutsche schienen für die Einreise nicht vorgesehen zu sein.
In den Nächten vor ihrem Abflug hatte sie wach gelegen und Zwiegespräche mit Migrationsoffzieren geführt. Es war ihre erste Amerikareise, und wenn sie den Schilderungen ihrer Freunde Glauben schenkte, dann stand ihr in wenigen Minuten ein Martyrium bevor. »Eine falsche Antwort, und sie schicken dich zurück!«
Ihre Angst speiste sich aus der Einsicht, dass ihr englischer Wortschatz nur aus Textzeilen alter Rocksongs bestand. Sie war nicht sicher, ob es klug wäre, auf die Frage nach dem Grund ihrer Reise mit »I can’t get no satisfaction« zu antworten. Wobei es durchaus den Kern getroffen hätte. Oder was brachte eine fünfzigjährige Frau dazu, nach ihrer Jugendliebe zu suchen? Wie sollte sie einem Grenzbeamten erklären, was sie sich selbst nicht erklären konnte? Ich befinde mich auf einer Scheidungsreise? Was war eigentlich das Gegenteil von Honeymoon? »The dark side of the moon«?
Eigentlich war diese Reise Wladimirs Idee gewesen. Nach dem Scheidungstermin hatten sie noch einige Minuten vor dem Gerichtsgebäude gestanden, unschlüssig, ob sie sich nach fünfundzwanzig Jahren Ehe zur Verabschiedung nur die Hand geben oder sich umarmen sollten. Bevor sie sich für eine Variante entscheiden konnte, hatte es plötzlich zu regnen begonnen, und sie hatte gezögert und gedacht, dass sie es mit einem Sprint noch zu ihrem Auto schaffen würde. Doch das hätte diesem Abschied den Anschein einer Flucht gegeben, und warum sollte sie vor einer Ehe wegrennen, die gerade im Namen des Volkes geschieden worden war? So war sie Wladimir in das gegenüberliegende Café gefolgt. In der »Letzten Instanz« war alles auf die Laufkundschaft von der anderen Straßenseite abgestimmt. Als Mittagstisch gab es »Kurzen Prozess« und »Schuld und Sühne«, und die Getränke hießen »Einspruch«, »Meineid« und »Hauptzeuge«.
Wladimir bestellte sich »Schuld und Sühne«, was sich als Kartoffelbrei mit Grützwurst herausstellte. Wie immer lud er die Gabel zu voll, und sie sah zu, wie er auf dem Weg zum Mund den Kartoffelbrei wieder auf den Teller verlor.
»Bereust du eigentlich, dass du mich geheiratet hast?«, fragte sie.
Er ließ die Gabel abrupt sinken, überlegte eine Weile und sagte dann: »Nein.«
»Auch wenn du gewusst hättest, was alles geschehen würde?«
»Auch dann nicht.«
Er schob einen neuen Berg Kartoffelmus auf seine Gabel, hielt aber noch einmal inne und sah sie an. Er war hager geworden. Die Haare hatten sich auf den hinteren Teil des Kopfes zurückgezogen, und sein kurzer Bart war grau. »Ich habe oft darüber nachgedacht«, sagte er, »aber wem hätte ich die Schuld geben sollen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Vielleicht mir?«
»Es war Schicksal«, sagte er mit der Ehrlichkeit, für die sie ihn einmal geliebt hatte, und widmete sich wieder seinem Kartoffelbrei.
Sie hörte, wie die Regentropfen gegen die Scheiben schlugen, und bestellte sich resigniert einen »Hauptzeugen«, der nach Farbverdünnung roch, aber laut Karte vorgab, ein Wodka zu sein. Wladimir sah interessiert zu, wie sie angewidert das Glas leerte und der Kellnerin erneut ein Zeichen gab.
»Ich übe Zeugenaufruf!«
Doch Wladimir lachte nicht. »Egal, wie viele Zeugen du noch aufrufst« sagte er, »dein Hauptzeuge wohnt in Amerika.«
Sie sah ihn überrascht an.
»Warum hast du Mick niemals besucht?«, fragte Wladimir.
Wie eine alte Frau schlurfte sie an dem Seil entlang über den geriffelten Gummiboden. Ich bin fast dreißig Jahre zu spät, dachte sie. Wahrscheinlich gab es Träume, die man sich nie erfüllen sollte. Eine Beamtin in Uniform verteilte die Bittsteller an die Befragungsschalter. Sie trug weiße Handschuhe wie eine Verkehrspolizistin und dirigierte mit grazilen Bewegungen ein Ehepaar an die Nummer fünf, eine Mutter mit Kind an die Nummer acht. Trotz der Handschuhe gab es nie eine Berührung. Wer der Aufforderung nicht sofort Folge leistete, bekam einen strafenden Blick, und wehe dem, der eine Zahl falsch verstand.
Welchen Schalter sollte sie sich wünschen? Wer würde nachsichtiger sein? Eine Frau oder ein Mann? Sie beobachtete einen Chinesen, der schon seit vielen Minuten von einem dünnen Afrikaner befragt wurde.
Für die ersten beiden Nächte hatte sie sich ein Zimmer in einer Pension gebucht und konnte eine Adresse nachweisen. Und dann? Was sollte sie antworten, wenn sie danach gefragt würde? Ich besuche einen Freund? Einen Freund, den ich vor fünfundzwanzig Jahren das letzte Mal gesehen und mit dem ich nur hin und wieder eine Weihnachtskarte getauscht habe? Merry xmas. Was bedeutete eigentlich das »x«? Sollte sie ihnen von Micks Flucht erzählen, von seiner jahrelangen Sehnsucht nach diesem Land, die er sich, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Sprung ins kalte Wasser erfüllt hatte? Sie war im Zweifel, dass sich amerikanische Grenzbeamte für die Teilung Deutschlands interessierten. Und wahrscheinlich war es sogar ein Nachteil, aus einem ehemals kommunistischen Land zu kommen. Waren Sacco und Vanzetti nicht wegen ihrer Gesinnung auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden? Einen Tod, den sie inbrünstig im Musikunterricht besungen hatte. »Maintenant Nicola e Bart …«
Und vor allem, wie sollte sie einem Grenzbeamten erklären, dass sie ihren Besuch nach so vielen Jahren nicht einmal angekündigt hatte?
Wladimirs Frage am Scheidungstag war ein Saatkorn gewesen. Die keimende Hoffnung, mit einem Besuch bei Mick könne sie sowohl mit ihrem alten Leben abschließen, als auch ein neues beginnen.
Ende und Anfang. Von diesem Gedanken beseelt war sie, ohne zu überlegen, einfach losgerannt. Einem Kind hätte man Unbedachtheit vorgeworfen und es belehrt, seine Entscheidungen besser zu überdenken. Sie hatte sich, im Alter einer Großmutter, bar jeder Vernunft, ohne jegliche Vorbereitung auf diese Reise gemacht.
Auch damals, nach jener merkwürdigen Begegnung auf dem Hochschulhof, hatte sie das Gefühl gehabt, etwas zu tun, das alles verändern würde. Obwohl sie sich vorgenommen hatte, nicht zu dem Treffen zu gehen, hatte sie am nächsten Tag brav ihre FDJ-Bluse in die Tasche zwischen die Hefter gestopft. Zwar widerwillig, aber sie war der Aufforderung gefolgt.
»Mick wie … du weißt schon« lehnte an der Eingangstür zum Seminargebäude. Er zog sie an einer Hand die Treppe nach oben in ein Zimmer in der letzten Etage. »Unser Probenraum«, sagte er und öffnete die Tür.
Auf den an den Rand geschobenen Bänken saßen junge Frauen und sahen ihm erwartungsvoll entgegen.
»Mein Ensemble«, sagte er mit einer generösen Handbewegung. Und sie brauchte nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, auf welche Weise er die Frauen angeworben hatte.
Auf einer Wäscheleine hingen handgemalte Plakate zum Trocknen:
»Freiheit auf Befehl ist wie Kuchen ohne Mehl«, »Dummheit auf der Leiter klettert immer weiter«, »Wird ein Wort aus Angst vermieden, braucht’s kein Gesetz, es zu verbieten«. Parolen, die nicht unbedingt von kommunistischer Gesinnung zeugten. War sie in eine Dissidentenzelle geraten? Plante er eine staatsfeindliche Aktion, oder wollte er sie auf die Probe stellen?
»Wir führen heute Abend Tierfabeln auf!«, sagte Mick, zog ein schmales Buch aus seiner Hosentasche und zeigte auf den Titel: »Der Esel als Amtmann«.
»Alles ostzonal«, sagte Mick und grinste.
»Ostzonal«, fast hatte sie dieses Wort vergessen. Es war eines seiner Lieblingswörter gewesen. Jazzhaft, Bluesbrüder, ostzonal. Mick kokettierte mit dem Leben im deutschen Osten. Er trug nicht Jeans wie alle anderen, sondern blaue Stoffhosen mit Bügelfalte, die er »Busfahrerhosen« nannte, dazu graue Feinrippunterhemden »halber Arm« und darüber die zu große »Präsent-20«-Jacke seines Vaters, an deren Revers eine Mainelke vom »VEB Kunstblume« steckte.
Die ostzonale Verkleidung hob ihn aus der Masse der anderen Studenten, die sich mühten, mit ihren oft selbst genähten Jeans möglichst »westlich« zu wirken. Was bei jedem anderen die Anmutung eines Parteifunktionärs gehabt hätte, wirkte bei Mick, als wäre er der Modewelt Jahrzehnte voraus.
Und tatsächlich würde er heutzutage große Chancen haben mit seinen Sachen von »damals«. Schon allein unter den Lemmingen in der Warteschlange fanden sich mehrere Kandidaten für einen ostzonalen Modewettbewerb. Es gab einen jungen Mann mit einem Lederhütchen à la Honecker und ein Mädchen, das in seinem bonbonfarbenen Rundstrickkleid aussah, als wäre es auf dem Weg zur Jugendweihe. Niemand litt mehr beim Optiker unter einem dicken schwarzen Kassengestell, sondern kaufte es sich freiwillig als Designerbrille. In den Gebrauchtwarenläden standen Schalensessel und Nierentische, und wahrscheinlich würde der Tag kommen, an dem sich alle erneut nach »Doppelliege Dagmar« und »Schrankwand Kompliment« verzehrten. Auch FDJ-Blusen waren wieder im Angebot und wurden von Touristen aus aller Welt als Souvenir mit nach Hause genommen, um den Schrecken des Ostblocks zu zeigen. Wahrscheinlich stellten sie sich dabei peitschenschwingende Monster vor, die ihre einheitlich gekleidete Jugend in Schach hielten.
Was sie nicht ahnten: Das Grauen im Sozialismus war die Langeweile gewesen, die Berechenbarkeit des bevorstehenden Lebens. Schon bei der Immatrikulation stand für Roswitha fest, dass für sie nach dem Studium eine Arbeitsstelle in einem volkseigenen Kombinat bereitstand, die sie bis an ihr Lebensende behalten würde. Dazu kamen ein kleinbürgerliches Familienleben und Urlaubsreisen, die sich in einem vorgegebenen Radius abspielten. Der Alltag im Land der Lemminge war überschaubar. Umso gewaltiger waren die Worte, die wie eine Wolke über dem Land schwebten. »Höher, schneller, weiter!« Als »Sieger der Geschichte« waren sie angetreten, die Besten der ganzen Welt zu werden, und bewiesen sich ihre Überlegenheit in Wettbewerben, die eigens geschaffen worden waren, um die Langeweile erträglich zu machen. Einmal abgesehen von den Wettspielen im Kindergarten, den Schulsportfesten, der Prämierung des schönsten Faschingskostüms und den Mathematikolympiaden, befanden sich alle im ständigen Kampf um Auszeichnungen und Prämien. Schüler kämpften um das »Abzeichen für gutes Wissen« und um eine »Staatsratsurkunde« für den besten Zensurendurchschnitt. Hausgemeinschaften kämpften um eine »Goldene Hausnummer«, die anzeigte, in welchen Häusern Menschen lebten, die ihre Gehwege sauber hielten und zum Republikgeburtstag Wimpelketten aufhingen. »Schöner unsere Städte und Gemeinden – Macht mit!«. Betriebskollektive kämpften um den Titel »Kollektiv der sozialistischen Arbeit«. Wer sich besonders hervortat, wurde »Aktivist« und als Steigerung »Held der Arbeit«. Es gab »Verdiente Lehrer des Volkes«, »Verdiente Metallurgen des Volkes«, »Verdiente Erfinder des Volkes«, »Verdiente Militärflieger des Volkes«, »Hervorragende Genossenschaftler des Volkes«. Und es gab die »Medaille für Verdienste im künstlerischen Volksschaffen«. Und so war es eine logische Folge, dass die künstlerischen Darbietungen an der Hochschule nicht einfach so »über die Bühne gehen« konnten, sondern nur als Wettbewerb. Der Direktor höchstpersönlich eröffnete den »Kulturellen Wettstreit« im Hörsaal. Er war ein kleiner, schwitzender Mann mit hängenden Schultern, bei dem selbst eine bügelfreie Polyesterjacke aussah, als hätte er damit eine Woche lang unter einer Brücke geschlafen. Stoisch las er seine aus den üblichen Floskeln bestehende Eröffnungsrede vor. Der Hörsaal war überfüllt, denn hier galt das Motto »Sehen und gesehen werden«. Man wusste nie, wozu es gut war.
»Kunst als Waffe« stand in angehefteten Pappbuchstaben auf dem Vorhang hinter der Bühne, und Mick hatte beschlossen, diese Losung in die Tat umzusetzen.
Zuerst trat die Singegruppe auf, dann der Literaturzirkel, dann die Tanzgruppe. Das Publikum gab schläfrigen Applaus und war in Gedanken schon bei der anschließenden Feier im Studentenklub. Dann kam Mick. Er betrat lässig die Bühne, zupfte an seiner Jacke, die, bis auf die Knitter, der des Direktors glich, blies imaginären Staub von der Mainelke in seinem Knopfloch und kündigte sein Programm an: »Fabelhaft«.
Ein Mädchen im Minikleid lief als Nummerngirl vor jeder Szene am Bühnenrand entlang und zeigte den Titel der Fabel an. »Wer sich hinter der Zeit versteckt, wird auf unsanfte Art geweckt«.
Mick stand kerzengerade wie ein Soldat hinter dem Rednerpult und las mit ernster Stimme die Fabeln aus dem Buch vor, während Mädchen mit Pantomime die jeweiligen Tiere darstellten. Es hätte einen Hauch Kindergeburtstag gehabt, hätten sie dabei nicht FDJ-Blusen getragen. Im Zeichen der aufgehenden Sonne stellten sie die mit Macht gepaarte Dummheit im Tierreich dar. »Auch hohe Tiere müssen mal aufs Örtchen, nur tun sie oft, als schissen sie ein Törtchen«.
Zum Schluss kamen die Lemminge. Sie irrten im Gänsemarsch über die Bühne und versicherten sich gegenseitig, dass sie auf dem richtigen Weg seien. Und auch als der erste Lemming über den Rand in einen imaginären Tod stürzte, folgten die anderen weiter dem vorgegebenen Pfad, bis sie an der Reihe waren, in den Abgrund zu fallen. Mit flatternden FDJ-Hemden sprangen sie vor die Füße des schwitzenden Direktors und seines Kollegiums und riefen auf den Weg ins Verderben voller Inbrunst: »Wir fliegen! Wir fliegen!«
Zusammen mit einem fremden Mann trat Roswitha an die Demarkationslinie, bereit für die Aufteilung.
»Sie gehören zusammen?«
»I’m alone now.«
Die Beamtin schien keine Musikfreundin zu sein. Sie guckte irritiert, als erwartete sie eine weitere Erklärung.
Roswitha wurde Schalter 11 zugeteilt. Sie wusste nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Zwei aufeinanderfolgende Spazierstöcke, die kleinste zweistellige Primzahl, die Zahl 11, die für diese Stadt zum Verhängnis geworden war. Aber immerhin hatte New York City 11 Buchstaben.
Mit gespielter Gleichgültigkeit reichte sie ihren aufgeklappten Pass über den Schaltertisch. Der Beamte, ein kleiner, mürrischer Mann – waren nicht kleine Männer am gefährlichsten? –, nahm ihn mit einer abrupten Bewegung, starrte eine Ewigkeit auf den Namen und wies dann auf eine Vorrichtung. Stumm, als wäre sie eine Idiotin, streckte er ihr in Augenhöhe Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand entgegen und simulierte das Nehmen der Fingerabdrücke. Sie presste, wie verlangt, zuerst den Daumen und dann den Zeigefinger auf das Pad. Zu ihrer Überraschung hinterließ die digitale Verbrecherjagd keine Spuren, und ihre Fingerkuppen blieben sauber. Der Beamte wiederholte die Pantomime für die linke Hand. Dann las er wieder mit regungslosem Gesicht in ihrem Pass. Endlich griff er nach dem Stempel. Er ließ ihn wie eine Guillotine auf das Papier sausen und schob ihr, immer noch wortlos, den Pass über den Tresen, als wäre er ein Almosen. Eine unmissverständliche Handbewegung in Richtung Ausgang, und sie war entlassen. Einerseits war sie erleichtert, andererseits fand sie es eine Unverschämtheit, dass sie nicht einmal eine Frage wert gewesen war.
Nachdem sich der letzte Lemming in den Abgrund gestürzt hatte, war Mick an den Bühnenrand getreten und hatte sich verbeugt.
Genau in dem Moment, in dem die Studenten ihre Hände zum Klatschen hoben, standen der Direktor und alle Dozenten gleichzeitig auf. Die Hände der Zuschauer verharrten einige Sekunden in der Luft und sanken dann wieder zurück. Schweigend, ohne noch einmal zur Bühne zu sehen, liefen die Dozenten im Mittelgang zur Tür. Kurz bevor sie den Saal verließen, stand ein rothaariger Junge in der dritten Reihe auf und rief in die eisige Stille: »Bravo!«
In den folgenden Wochen warteten sie auf ihre Bestrafung. Doch vonseiten der Direktion herrschte Schweigen. Sie hatten mit einer Vorladung gerechnet, mit einem Verweis, im schlimmsten Fall mit einer Exmatrikulation, doch stattdessen geschah – nichts. Sie hatten in Drachenblut gebadet und wussten nicht, an welcher Stelle ihnen das Blatt auf den Rücken gefallen war.
Die Lemminge aus dem Flugzeug waren plötzlich verschwunden. Sich selbst überlassen, suchte Roswitha zwischen den abgestellten Koffern nach ihrem Gepäck. Warum war eigentlich Schwarz die Farbe des Reisens? Wie einen störrischen Hund zog sie den Koffer zum Ausgang. Wenigstens ein Lebewesen, dachte sie. Und während sie überlegte, welche Hunderasse ihr Koffer haben könnte, wurde ihr bewusst, dass sie das erste Mal in ihrem Leben allein reiste. Immer war jemand dabei gewesen. Und nun? Nun war sie, von allen guten Geistern, Freunden, Kindern und Männern verlassen, allein auf Reisen gegangen. Vergeblich suchte sie nach einer Hinweistafel, die anzeigte, auf welchem Weg sie in die Stadt kommen würde.
Am Ende des Glastunnels saß eine ältere Frau hinter einem kleinen Pult. Sie wirkte wie die Etagenverantwortliche in einem russischen Hotel, und Roswitha war nicht sicher, ob sie sich herablassen würde, eine Wegbeschreibung zu geben. Eingeschüchtert zeigte sie ihr die Adresse ihrer Pension. Die Reaktion war überraschend. »How are you?«, rief die Frau überschwänglich, als wäre Roswitha eine seit Langem erwartete Bekannte. Glücklich darüber, dass sich endlich jemand für sie interessierte, spulte Roswitha alle über ihr Befinden angelernten Sätze ab.
»Sie sind das erste Mal in Amerika?«, fragte die Frau und lächelte. Dann zeichnete sie den Weg zur Pension in einen Stadtplan ein. Zuerst sollte sie mit dem »Airtrain« zum »A Train« fahren. Die Frau reichte Roswitha den Plan. Die Station heißt »Howard Beach«, sagte die Frau. »Wer auch immer Howard war.«
Roswitha war die Einzige auf dem Bahnsteig: Ein Papierkorb, ein Nichtraucherschild, eine Sitzbank. Vielleicht war die Stadt gar nicht so groß, wie alle immer behaupteten. Sie stellte ihren Koffer neben die Bank. Es war so warm, dass sie ihre Jacke ausziehen konnte. Ein Spätsommertag mitten im Oktober. Sie lief auf und ab, behielt aber, im Wissen um die Gefährlichkeit der Stadt, den Koffer im Blick. Der Angriff kam aus der Luft. Unversehens ließen sich zwei Sperlinge nieder und pickten gegen den Koffergriff. Das Klopfen mischte sich mit dem Summen der Schienen, und sie bekam plötzlich Angst, dass in wenigen Augenblicken der Regionalzug nach Eilenburg einfahren würde. Sie war erleichtert als sie das A an der Frontscheibe erkannte. »Take the A Train.«
»Hurry, get on, now, it’s coming«. Es gab für jede Lebenssituation einen Song. An dem Abend nach der Aufführung war sie wie selbstverständlich zusammen mit Mick nach Hause gegangen. Er wohnte in einem maroden Hinterhaus über einer Polsterwerkstatt. Es war ein einziges Zimmer mit großen, mehrfach unterteilten Fenstern, das über eine rostige Außentreppe zu erreichen war. »Wie in Amerika«, sagte Mick. Überall im Raum stapelten sich Bücher, Schallplatten und Tonbänder. Selbst in der Badewanne, die in einer Ecke stand, lagen Kartons mit Tonbandkassetten. Mick räumte einige Bücher beiseite, sodass sie Platz zum Liegen hatten, legte eine Platte auf und löschte das Licht. Er könne diese Musik nur nachts hören, sagte er, schließlich seien die Sänger ja schwarz. Und dann lagen sie im Dunkeln nebeneinander auf den Dielenbrettern und hörten Blues. Besser: Sie fühlten den Blues. Die tiefen Töne strichen über ihre Haut und bestimmten den Herzschlag. Sie hatte das Gefühl zu schweben. Der Mond schien durch die Fenster, und die Metallstreben warfen ein Muster. Es sah aus wie die Takelage eines großen Segelschiffs. Im Mondschein fuhren sie über den Ozean, die Wellen schlugen im Rhythmus gegen den Bug. Befreit von allen Ufern trieben sie durch die Nacht.
Sofort wenn eine Plattenseite abgelaufen war, stand Mick auf. Er sprach nicht und schien gar nicht zu bemerken, dass Roswitha im Raum war. Sie begann zu ahnen, was ihr später zur Gewissheit wurde, nicht die anderen Lemming-Frauen waren eine Konkurrenz für sie, sondern die unzähligen Schallplatten, die sich in seinem Zimmer stapelten, immer nur zwanzig Stück übereinander, so wie es auf der Hülle empfohlen wurde. War Mick ansonsten in allen Dingen nachlässig, behandelte er seine Schallplatten wie Schätze. Vorsichtig zog er sie in der Schutzhülle aus dem Cover, ließ sie aus dem Papier gleiten und hielt sie mit gespreizten Fingern zwischen seinen Händen, als wäre es bei Todesstrafe verboten, einen Fingerabdruck auf dem Vinyl zu hinterlassen. Sanft streichelte er mit einem Tuch die Stäubchen von der sich drehenden Platte, balancierte den Tonarm auf einem Finger und setzte ihn behutsam an den Anfang. Nicht ein einziges Mal rutschte die Plattennadel ab, und nicht ein einziges Mal begann ein Titel zu spät.
Eingehüllt in die Musik lagen sie bis zum Morgengrauen nebeneinander, ohne sich berühren, und doch hatte sie sich selten einem Mann so nah gefühlt wie in dieser Nacht.
Sie schloss die Augen und versuchte sich an die Musik zu erinnern. Das Licht blendete, und sie zog ihre Sonnenbrille aus der Tasche. Was war das für eine verdammte Untergrundbahn, die über Tage fuhr? Sie blickte auf Hausdächer und Mauern, die von Stacheldraht begrenzt waren. Auf einem Vordach stand ein Mann und rauchte. Endlich fuhr der Zug in einen Tunnel.
Sie lehnte sich zurück. Die Namen der Stationen kamen ihr unwirklich vor: Utica, Lafayette, Nassau. Befand sie sich wirklich in der richtigen Stadt? Sie war überrascht, als, wie angekündigt, pünktlich nach einer halben Stunde der eingezeichnete Umsteigebahnhof erschien. Sie schleppte ihren Koffer von einem Tunnel in den anderen, stieg in den nächsten Zug und war kurz darauf wieder an der Station Lafayette. Doch bevor sie in Panik geraten konnte, hielt der Zug an der Second Avenue. Mit dem Gefühl, von fremden Mächten gelenkt zu werden, stieg sie aus, wartete vorsichtshalber, bis alle durch das Drehkreuz gegangen waren, und hievte dann ihren Koffer unter die Schranke. In dem Moment, in dem sie mit ihren Körper gegen die Metallstange drückte, wusste sie, dass es ein Fehler war. Das Drehkreuz wurde seinem Namen gerecht, kippte mit seinen Metallarmen nach vorn und nahm den Koffer in Gewahrsam. Die Lage war prekär. Es fehlten wenige Millimeter. Sie nahm den Nachbarausgang und versuchte an dem Koffer zu ziehen. Vergeblich. Der Koffer stand auf der einen und sie auf der anderen Seite, und da sie kein neues Ticket hatte, war eine Rückkehr unmöglich. Sie verwarf den Gedanken, über die Schranke zu steigen. Sie hatte Angst, einen Alarm auszulösen oder in das Visier einer Selbstschussanlage zu geraten, und musste warten, bis der nächste Zug einfuhr und Passanten kamen und ihr halfen.
Befreit schleifte sie ihren Koffer die Treppe nach oben und entstieg, eingehüllt in die Abgaswolke eines Trucks, der Erde. Sie nahm es als Kunstnebel und dachte: Das ist also New York!
Es war immer noch ein warmer Spätsommertag. Die Blätter der Bäume leuchteten in hellem Gelb. Kleine Sonnen, unter denen neben einer Imbissbude Leute auf Gartenstühlen saßen, Kaffee tranken und ihr Gesicht mit geschlossenen Augen nach oben reckten, als würden sie einen Segen empfangen. Sie schlurfte mit ihrem Koffer über heruntergefallene Blätter. Die Pension lag in einer Nebenstraße. Es waren niedrige Häuser, zwei, drei Stockwerke hoch. Am Fuß der Straßenbäume wuchsen Astern und Zierkohl, und manchmal war ein buntes Band um den Stamm gebunden. Sie suchte nach ihrer Pension und stellte fest, dass es viele Türschilder mit polnischen Namen gab. Vor der »Pension Anna« stand eine Büste von Johannes Paul II. Daneben führte eine Treppe nach unten ins Souterrain.
Eine kleine Frau mit einem Dutt, der wie ein Kaffeewärmer auf ihrem Kopf thronte, öffnete die Tür. »How are you?«, fragte sie mit harten osteuropäischen Akzent und lief, ohne eine Antwort abzuwarten, durch verwinkelte Gänge voraus. Roswitha folgte ihr, bemüht, mit dem Koffer keine Schramme an der Wand zu hinterlassen. In einer Nische am Ende eines Flures stand ein Schreibtisch. Frau Annas Büro.
Sie suchte in einem Karteikasten nach der Reservierung und legte das Formular zum Unterschreiben auf den Tisch. Ungelenk wie eine Erstklässlerin setzte Roswitha ihre Unterschrift auf das Papier. Roswitha Sonntag. Der Name klang fremd und vertraut zugleich. Er gehörte zur ersten Hälfte ihres Lebens. Unsere Rosi, das Sonntagskind, dem jahrelang verschwiegen wurde, dass es an einem Montag zur Welt gekommen war. Auch Mick hatte Gefallen an ihrem Namen gefunden. Rose Sunday, mit diesem Namen werden sie dich in Amerika lieben, hatte er ihr versprochen. Und sie hatte gelacht und gesagt, dass er der Einzige bleiben würde, der sie so nannte. Sie hatte ihrem Namen keine Bedeutung beigemessen und ihn bei ihrer Hochzeit mit Wladimir Kleinschmidt widerstandslos geopfert.
Alles auf Anfang, hatte sie sich nach der Scheidung vorgenommen und als ersten Schritt mit der Rückübertragung ihres Mädchennamens begonnen. Hatte sie gehofft, sie würde auf diese Weise wieder zu einer jungen Studentin werden?
Überraschend geschah die Namensänderung im Zeitalter der elektronischen Medien per Hand. Die Standesbeamtin schlug den schweren Archivband auf, nahm ein Lineal und einen Stift und strich mit Schwung den Eintrag aus dem Buch, wie eine Lehrerin, die eine zu Unrecht gegebene Note aus dem Klassenbuch tilgte.
Frau Anna guckte nicht einmal auf die Unterschrift. Ihr war es egal, wie Roswitha hieß, Hauptsache, sie bezahlte die beiden Übernachtungen im Voraus.
Das Zimmer war nur wenig breiter als das Bett. Vor dem Wandschrank stand ein Stuhl, und auf der gegenüberliegenden Seite führte eine schmale Tür in ein winziges Badezimmer. Das einzige Fenster zog sich als schmaler Streifen unter der Decke über die Wand. Sie blickte durch Gitterstäbe direkt auf die Füße der Passanten, die in Augenhöhe neben ihrem Bett über den Gehweg schwebten. Sie musste den Koffer halb ins Bad schieben, um überhaupt die Tür schließen zu können. Sie legte sich auf das Bett und hörte auf die Schritte aus der Oberwelt. Das Licht fiel auf einen verblichenen Kunstdruck, der über dem Fußende hing. Eine breite Straße mit flanierenden Menschen, die den Blick auf einen getupften Eiffelturm frei gab. Paris im Frühling. Sie lag in einem New Yorker Souterrain und sah wie durch ein Guckloch zurück nach Europa. Warum hingen in den meisten Hotelzimmern Bilder von Städten, in denen man sich gerade nicht befand? War es eine Methode, zum Reisen zu animieren? Oder sollte es einem das Gefühl geben, nirgendwo zu Hause sein? Die Rastlosigkeit des Reisens. Galt immer noch Else Lasker-Schülers Spruch: »Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen«?
Ihre Gedanken verfingen sich in den Worten.
Als sie aufwachte und die Augen öffnete, sah sie Schatten über die Wand huschen. Sie hatte Mühe, zu begreifen, wo sie war. Die Lichtkegel der Autos kreuzten sich an der Decke, bildeten vergängliche Muster. Sie war wieder das Kind, das am Abend in seinem Bett lag, sehnsüchtig nach dem geheimnisvollen Leben, das sich auf der Straße abspielte. Die Welt außerhalb des Kinderzimmers erschien ihr voller Licht, voller Freiheit. Ein Kaleidoskop, das man nur schütteln brauchte, und schon sah man ein neues verführerisches Bild.
Über ihrem Kopf gab es ein schmatzendes Geräusch, und an der Wand liefen Monstertatzen entlang. Sie brauchte eine Zeit lang, um zu begreifen, dass nur ein Mann in Schnürschuhen an ihrem Fenster vorbeigelaufen war. Langsam kam die Erinnerung. Sie war nach New York geflogen und lag im verwinkelten Hamsterbau von Frau Anna.
Sie wusste nicht, wie lange sie geschlafen hatte, wusste weder, ob es Abend oder Morgen war, und auch die angezeigte Zeit auf ihrem Handy brachte sie nicht weiter. Waren es sechs oder acht Stunden Zeitunterschied? Und vor allem, musste sie vor oder zurück rechnen? Die Zeitzonen waren noch nie ihre Stärke gewesen. Nichts war ihre Stärke. Erstmals seit ihrer übereilten Abreise gestand sie sich ein, dass sie von Mick nichts als die Adresse auf einer alten Postkarte hatte, keine Telefonnummer, keine Mail, nur eine Ortsangabe, die wie die Zahlenkombination für ein Schließfach anmutete.
Sie stellte sich auf das Bett und versuchte nach draußen zu sehen. Die Matratze war so weich, dass sie einsank und sich, auf Zehenspitzen balancierend, am Fenstersims ein Stück nach oben ziehen musste. Sie sah durch die Gitterstäbe auf schmutzige Gehwegplatten und dachte, so viel Symbolik für ihre Unfähigkeit wäre nun auch nicht nötig gewesen.
Amerika war etwas gewesen, das es nur in Micks Kopf gab. Manchmal gelang es ihr, ihm auf seinen Gedankenreisen zu folgen. Getrieben vom Blues, fuhren sie auf breiten Highways einem unbekannten Ziel entgegen. Die Bilder, die Mick mit seinen Worten malte, kamen ihr vor wie Kreidezeichnungen auf Asphalt. Wunderschön und im nächsten Moment vergänglich.
Nach jener ersten Nacht hatte sie in der Morgendämmerung an dem großen Fenster gestanden. Mick kochte Tee. Sie hörte das Klappern der Tassen, das Summen des Tauchsieders. Sie drehte sich um, sah, wie er eine Tortenform aus dem obersten Fach seines Regals nahm, und spürte, dass sie Hunger hatte. Mick hob ein Bündel aus der Form und legte es auf den Küchentisch. Vorsichtig schlug er die Zipfel zurück. Doch statt des von Roswitha erwarteten Kuchens lag eine kleine Schallplatte auf dem Geschirrtuch.
»Aus Amerika«, sagte Mick und blickte verzückt auf die Platte, als wäre sie das Ellenbogengelenk des heiligen Petrus. Dann nahm er sie zwischen seine Hände und schritt zum Plattenspieler.
»A oder B?«, fragte er
»B!«
»Gute Wahl«, sagte Mick. »Vergiss alles, was du bisher gehört hast!«
»Something told me the game is over …« Die tiefe Stimme von Etta James traf Roswitha wie ein Schlag.
Sie sah hinaus auf den Hinterhof. Im Licht der aufgehenden Sonne begannen die Katzenkopfsteine rosa zu schimmerten. Die Mülltonnen bekamen einen goldenen Rand, und die Katze auf der Waschhaustreppe wurde ein schillerndes Fabelwesen. Es war, als würde Etta James mitten im Hof stehen und ihren Blues vom Verlassenwerden singen.
Der verblassende Mond spiegelte sich im Treppenfenster des Vorderhauses. Und Mick hob seine rechte Hand, zeigte mit dem Zeigefinger in Richtung Himmel und rief, halb Drohung, halb Schwur: »Irgendwann!«
Dann ließ er die Hand sinken und sah Roswitha an. In diesem Moment hätte sie ihm alles versprochen.
Sie zuckte zusammen, als ein Hund mit seinem Fell die Gitterstäbe streifte. War er auf seiner Morgenrunde, oder war es sein letzter Gang durch die Nacht? Sie zog sich noch ein Stück höher, legte den Kopf in den Nacken und erkannte, mit schwindender Kraft, am Himmel einen hellen Fleck. Doch sie konnte nicht unterscheiden, ob es der untergehende Mond, die aufgehende Sonne oder einfach nur das Licht einer Straßenlaterne war.
Drei Jahre nach seiner Flucht hatte Mick ihr die erste Postkarte geschickt, die schwarz-weiße Ansicht eines Hochhauses, über dem der Mond stand. Auf der Rückseite der Karte hatten nur zwei Worte gestanden: Bin da!
2
ER HATTE IMMER NUR KARTEN GESCHICKT. Ein Bild vom Empire State Building mit der Bemerkung: »An dieser Spitze können Luftschiffe anlegen«, eine nächtliche Aufnahme vom Guggenheim-Museum: »Ein Ufo am Central Park.« Ob Brücken, Parks, Häuser oder Plätze – alles wirkte gigantisch. Mick war in seinem Traumland angekommen, während es Roswitha seit vielen Jahren nicht gelungen war, sich eine neue Wohnung zu suchen.
»Wenn ich auf dem Dach stehe, kann ich die Freiheitsstatue sehen«, hatte er ihr auf seiner letzten Karte geschrieben. Und Roswitha war ein wenig neidisch gewesen und hatte ihn sich vorgestellt, wie er in romantischen Sommernächten mit einem Glas Whisky auf dem Flachdach eines Hauses stand, lässig gegen einen Schornstein gelehnt, und über den East River hinweg nach Ellis Island sah.
Sie verdrängte den Gedanken, dass die Karte mittlerweile drei Jahre alt war. Die Karten waren immer in großen Abständen gekommen. Mick hatte nie gern geschrieben.
Die Adresse auf der Karte markierte zahlengenau einen Punkt im Koordinatenkreuz der Stadt, doch das Finden war eine andere Sache. Schon allein die Fahrt mit der Subway war eine Herausforderung. Erst einmal musste sie sich dem Mysterium von Uptown und Downtown stellen und wählte, in der festen Überzeugung, der Weg vom Südosten Manhattans nach Brooklyn würde aus der Stadt herausführen, »Uptown«. Sie bemerkte den Fehler, als sie nach einigen Stationen auf der Leuchtschrift im Wagen las, dass sie in einem Zug Richtung Bronx saß. Zwei Stunden lang fuhr sie, losgelöst von dem Leben über ihr, in der Tiefe Zickzack, um am Ende, als wäre nichts geschehen, an der richtigen Stelle aus der Erde zu steigen. Die Subway erschien ihr als eine eigene Welt, und sie war sicher, dass es diese Stadt zweimal gab: einmal unter und einmal über der Erde.
Die Gegend, in die sie in Brooklyn entlassen wurde, glich beim näheren Betrachten einer deutschen Reihenhaussiedlung. Es waren schmale, aneinandergedrückte Häuser, kaum breiter als die Eingangstreppen. Auf den Fensterbänken standen von Rüschengardinen gerahmte Blumentöpfe. Vor den Haustüren fletschten Kürbisköpfe ihre Zähne und kündeten gemeinsam mit Hexen und Gespenstern vom bevorstehenden Halloween.
Es fehlte nur noch das Holzschild mit der eingebrannten Aufforderung »Haxen abkratzen!«.
War Mick dem Muster seiner Kindheit gefolgt?
Ein einziges Mal, zur Silberhochzeit seiner Eltern, als er einen Besuch nicht vermeiden konnte, hatte er Roswitha »als moralischen Beistand« mit in die Kleinstadt genommen, in der er aufgewachsen war. Hier war aus Michael nicht Mick, sondern »unser Michi« geworden, was auf Sächsisch, nach zwei Bier durch die Zähne gezischt, Unsmschi ergab. Sein Vater, der Spender der »Präsent-20«-Jacken, war ständig auf gute Stimmung bedacht gewesen. Während Micks Mutter, eine Lehrerin, nicht verhehlen konnte, dass sie ihr Erziehungsziel bei ihrem Sohn als verfehlt ansah.
Roswitha wurde sofort als zukünftige Schwiegertochter vereinnahmt: »Vielleicht wird der Junge ja doch noch vernünftig.« Sie musste bei einer Führung durch das Haus die geschnitzte Eckbank in der Küche, die Fliesenfolie im Bad, die Schrankwand »Kompliment« und natürlich auch das Zimmer von Michi bewundern. Alles war im Originalzustand. An diesem Schreibtisch hat »Unsmschi« seine Hausaufgaben gemacht, in diesem Bettchen hat er geschlafen und auf diesem Stühlchen gesessen. An der Wand zeugten Urkunden vom ersten Leben des Michael Stein. Belobigungen »Für gutes Lernen in der Schule« und Würdigungen seiner sportlichen Erfolge beim Kunstturnen. Auf einer Anrichte standen, ordentlich ausgerichtet, neben einem Kofferplattenspieler seine erste Schallplatten: Grimms Märchen, Pittiplatsch, Chris Doerk und Frank Schöbel, Mireille Matthieu.
Je weiter sie lief, desto schmuckloser wurden die Häuser, was sie einerseits beruhigte, andererseits aber auch die Wahrscheinlichkeit verringerte, dass jemand aus romantischen Gründen auf eines dieser Dächer stieg. In der Einfahrt einer Autowerkstatt stand ein verrosteter Ford, dem die Vorderräder fehlten, und an dem indischen «Take away« daneben waren die Rollläden heruntergelassen. Die Straße war menschenleer. Über die Häuser hinweg donnerten Autos über einen mehrspurigen Expressway, was das Gefühl der Abgeschiedenheit noch verstärkte. Ihr blieb noch eine Kreuzung, dann war die Straße zu Ende. Es war eine Sackgasse. Im Näherkommen bemerkte sie das drei Meter hohe Eisengitter, das den Weg zum Fluss versperrte. Auch auf der linken Seite gab es einen hohen Zaun, der zusätzlich mit Stacheldraht gesichert war. Dahinter summten Kondensatoren. Schilder mit aufgezeichneten Blitzen warnten vor Stromschlägen, aber sie