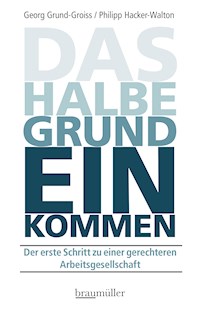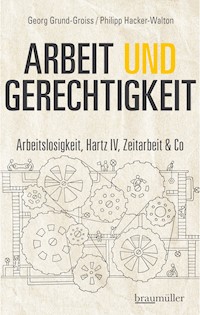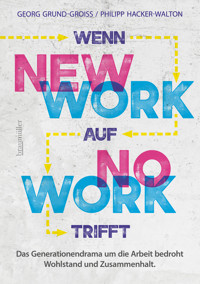
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der große Personalmangel bedroht Wohlstand und Zusammenhalt gründlicher als die Wirtschaftskrise 2009 und die Inflationskrise heute. Denn in ihm stecken ein tiefer Generationenkonflikt, aber auch ein faszinierender Drang zur Weiterentwicklung der Arbeitsgesellschaft. Nicht die schöne Vision des New Work beherrscht die Szene, es regiert der Verdruss. Klar scheint: Der Mangel an Arbeitskräften wird auf absehbare Zeit bestehen bleiben – und die Arbeitswelt nach Corona wird nicht mehr werden wie davor. Fast scheint es, als hätten die Jüngeren mit dem New Work erstmals einen Hebel gefunden, mit dem sie die Mehrheit der Älteren tatsächlich aus ihrer Selbstgerechtigkeit kippen können. Indessen scheinen viele Baby Boomer auszublenden, dass mit No Work, dem flotten Abschied in die Pension, ihre Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft nicht einfach gelöscht ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Ähnliche
Für Trixi, love of my life und einegroßartige Arbeitgeberin
Georg Grund-Groiss
Für Emily, Oscar & Benjamin
Philipp Hacker-Walton
INHALT
1 Einleitung
2 Der große Verdruss mit dem Personalmangel
Aus der Praxis: Gastro light from nine to five?
3 Träume vom Anti-Arbeitsmarkt
Aus der Praxis: Die Aussteigerin
4 Arbeitnehmer*innen – In einem Markt voller Lügeleien
Aus der Praxis: Vier Tage sind genug?
5 Arbeitgeber*innen – Aus allen Wolken gefallen in eine neue Beziehungskiste
Aus der Praxis: Gemeinsam Wirtschaften reloaded – Die „Dorfschmiede“ im niederösterreichischen Gutenstein
6 Proviant für den Ausweg: Vier Ordnungen und drei Lieben
Aus der Praxis: Erwerbstätig in der Pension – Nichts weniger als ein Widerspruch
7 Ein neuer Generationen-Arbeitsvertrag
1
Einleitung
„The fact is the sweetest dream that labor knows.“
Robert Frost1
Der Personalmangel bedroht Wohlstand und Zusammenhalt in der westlichen Welt gründlicher als die Wirtschaftskrise 2009 und die Inflationskrise heute, denn in ihm stecken ein gravierender Generationenkonflikt und ein unbändiger Drang zur Weiterentwicklung der Arbeitsgesellschaft. Die demografischen Berechnungen ergeben – bei allen plausiblen Migrationsszenarien – einen drastischen Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und in der Zahl der Erwerbstätigen. Umzukehren wäre dieser Trend nur, würde die Erwerbsbeteiligung der Migrant*innen und der Älteren ebenso deutlich ansteigen wie die Arbeitszeiten der Frauen – und die New-Work-Strömung mit ihrer neuen Arbeitszurückhaltung machte dem keinen Strich durch die Rechnung.
Davon handelt dieses Buch. Und von der Liebe. Aber was, um Himmels willen, hat die Liebe mit der Arbeitswelt zu tun?
Für Platon ist Liebe das Verlangen nach „Zeugung im Schönen, des Körpers und der Seele“.2 Nun, genau um sie geht es dem New-Work-Movement, das sich derzeit auf allen Kanälen propagiert.3 In Zukunft soll Arbeit, die manuelle wie die geistige, nur mehr Produktivsein im Schönen sein – mit einem geglückten Selbst unter rundum belebenden Bedingungen zu einem sinnvollen Zweck.
Der Weg zum Himmel ist aber durchaus mit bösen Verwerfungen gepflastert. Wieder wusste schon Platon warum: Die dritte Seelenkraft, der Thymos (Drang nach Anerkennung und Wille zur Macht), mischt immer mit, wenn Nous (Verstand/Vernunft) und Eros (Liebe) ihre ehrenwerten Ziele verfolgen. Er ist jener „Geselle, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen“4, damit bei der persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Menschen überhaupt etwas weitergeht.
Wahrlich, wir leben auch am Arbeitsmarkt in thymotischen Zeiten. Nicht die schöne Vision des New Work beherrscht die Szene. Stattdessen regiert der Verdruss über den großen Personalmangel, der wie unvermittelt aus der Corona-Massenarbeitslosigkeit entsprungen ist. Denn die Arbeitskräftenachfrage der Wirtschaft ist nach Abflauen der Pandemie unerwartet stark gestiegen, während der demografische Wandel mit dem Abgang der Babyboomer aus dem Erwerbsleben kumulierend und immer schonungsloser seine Wirkung entfaltet.5
In Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg wäre ein zwischen hoher und niedriger Arbeitslosigkeit auf und ab rasender Roller-Coaster-Arbeitsmarkt durchaus möglich. Doch auch in einem solchen Umfeld würde sich der Personalmangel nicht in Luft auflösen. In den aktuell ruhigeren Gefilden des Arbeitsmarktes sehen wir: Eine konjunkturell wieder leicht steigende Arbeitslosigkeit kann den Personalmangel kaum lindern, weil so vieles an ihm strukturell ist. Ein großer Teil der Arbeitslosen kann nicht das Richtige und müsste erst qualifiziert werden. Aber viel zu wenige wollen auch das Richtige im Sinne des Nachgefragten lernen.
Die neue kulturelle Strömung des New Work verknappt das Angebot an Arbeitskräften zusätzlich, ein Angebot, das ohnehin von der Sehnsucht vieler Babyboomer, so schnell wie möglich in Pension zu gehen, Monat um Monat weiter dezimiert wird.
Dabei ist die New-Work-Strömung keineswegs nur die Sehnsucht nach Sinn und kluger Schonung in der Arbeit, wie uns manche Schriftsteller*innen sowie Philosophinnen und Philosophen suggerieren wollen.6 Und der Rückzug der Babyboomer ist keineswegs nur die herbstliche Ernte im Verlauf verdienstvoller Erwerbsbiografien.
In unzähligen Gesprächen im Umfeld des AMS – mit Arbeitslosen, Beschäftigten, Interessensvertreter*innen und Unternehmer*innen – verfestigte sich unser Eindruck: Die Jungen treten oft arrogant gegenüber den Grunderfordernissen des Lebens auf, geben sich eitel, ungerecht und zynisch. In einem Essay führt Jens Jessen, Redakteur der Zeit, aus, die zahlenmäßig sehr kleine und daher politisch schwache Generation Z habe mit der Cancel Culture und der Fridays-for-Future-Bewegung nun erstmals ein starkes „Machtmittel“ gefunden, „mit dem die Mehrheitsgesellschaft eingeschüchtert werden kann“.7
Uns erscheint New Work als Machtmittel sogar noch bedeutender: Es taugt dazu, die geschmierten Prozesse der Wohlstandserzeugung empfindlich zu stören und stellt damit die Drohung in den Raum, dass die verbrieften Pensionen der Babyboomer ab sofort ein politischer Verhandlungsgegenstand sind.
Umgekehrt scheinen viele Babyboomer auszublenden, dass es im Gefüge des sozialen Ganzen keinen Rückzug geben kann. Der Abschied von der Erwerbsarbeit löscht nicht einfach die Verantwortung, die sie in Wirtschaft und Gesellschaft tragen.8
Mit dem New Work der Jungen und dem No more Work der Älteren – plus einer tiefen Spaltung in der Arbeitsorientierung der mittleren Generationen – betritt der bereits ökologisch und kulturell heftig schwelende Generationenkonflikt die Arbeitswelt als seine realste Arena.
Eine genauere Untersuchung verdient unsere sich immer mehr verdichtende Ahnung, dass ein erheblicher Teil der ganz Jungen vom vermeintlich anstrengungsärmeren Influencer-Dasein und vom erlösenden Erfolg auf einem Anti-Arbeitsmarkt im Internet träumt. Mit dem Begriff des Anti-Arbeitsmarkts versuchen wir das ambivalente Phänomen zu fassen, dass viele junge Leute durchaus mit Energie und Erfindungsreichtum an ihrer finanziellen und sozialen Profilierung arbeiten, dies aber in der affektiven Grundstimmung des Protests gegen eine langweilige normale Ausbildungs- und Berufskarriere.
Bei der oft stillen Verachtung der konventionellen Berufsausbildung bemerken sie gar nicht, dass diese Träume für die allermeisten nur Schäume bleiben werden, indes die restlose Kommerzialisierung des Selbst aber bereits passiert. Auch immer mehr Ältere tun sich am Anti-Arbeitsmarkt um: Sie ersehnen sich die finanzielle Freiheit durch Multi-Level-Marketing9 verbrämt mit allerhand aufgeblasenen Sinn- und Lebenskunstverheißungen.
Wir zeigen an ausgewählten Erhebungsdaten des Arbeitsmarktservice Österreich (AMS), insbesondere das Niveau der Selbstlösungen von Dienstverhältnissen betreffend, was in der Wahrnehmung vieler AMS-Mitarbeiter*innen längst als erwiesen gilt: Die Formen der Arbeitsunwilligkeit und der Missbrauch der Arbeitslosenversicherung wuchern mittlerweile als ein bunter Blütenwald. Auch viele bestens qualifizierte Menschen bedienen sich mit Findigkeit und – insbesondere was die Jungen angeht – ohne jegliches Unrechtsbewusstsein an den Leistungen der Allgemeinheit. Viele Unternehmen greifen ebenfalls zu und wollen ohne Förderungen keine Risiken mehr tragen. Individuell mag diese, durchaus legale, Zugriffskultur in aller Regel temporär sein, insgesamt konstituiert sie aber bereits eine neue amoralische Ordnung.
Viele der im Text dargestellten Erfahrungsberichte und Erfahrungswerte stammen aus dem AMS-Alltag von Georg Grund-Groiss, der seit 13 Jahren als Leiter von regionalen AMS-Geschäftsstellen tätig ist. Er spricht hier nicht offiziell für das AMS, sondern als Autor, der seine Erfahrungen im AMS teils fachlich, aber vor allem gesellschaftspolitisch und philosophisch reflektiert.
Der Leiter einer großen Regionalbank äußerte kürzlich bei einer Berufsinformationsmesse folgenden Verdacht: Aus der Generation der Erben fänden immer weniger die innere Notwendigkeit zu persönlicher und sozialer Entwicklung durch kontinuierliche Erwerbsarbeit. Die Wahrnehmung im AMS zeigt uns: Viele Nicht-Erben nehmen das mit Neid und Bitterkeit zur Kenntnis und setzen ihrerseits, gleichsam als Retourkutsche gegen die Allgemeinheit, auf Minimierung der Erwerbstätigkeit und Maximierung des Arbeitslosengeldbezugs.
Eine weitere Beobachtung: Viele Sprösslinge der Akademisierungswelle10 der vergangenen Jahre klammern sich statusverliebt oder besser gesagt statusverklemmt an ihre sog. Bullshit-Jobs11 in Controlling und Qualitätsmanagement, während immer mehr Berufe, vor allem Hand-Kopf-Berufe, zu Mangelberufen12 werden.
So taumeln wir als Gesellschaft unversehens und doch sehenden Auges in eine Lage, in der die Summe unserer Bedürfnisse die Bereitschaft und Fähigkeit, sie mittels Arbeit zu erfüllen, schon deutlich überragt. Selbst wenn wir die Keller und Dachböden unserer Bedürfnisse gründlich ausmisten: Es scheint unausweichlich, dass unsere Gesellschaft bald deutlich ärmer an Dienstleistungen, an Gütern und an Zusammenhalt sein wird.
Schlechter gelaunt ist sie bereits, so jedenfalls die Wahrnehmung in vielen Dienstleistungsbetrieben, was etwa von den jüngsten Ergebnissen des Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer Oberösterreich, vor allem für jüngere Arbeitskräfte, bestätigt scheint.13 Dahinter steckt auch, dass in all den Krisen, die uns bedrängen, viele immer gereizter zu tyrannisierenden Kunden und Kundinnen mutieren. Überspitzt formuliert: Als Arbeitskräfte wollen sie aber um keinen Preis mehr Untertanen sein.
Der bekannte deutsche Soziologe Hartmut Rosa kommt in einer Analyse des spätmodernen Weltverhältnisses zu einem ähnlich deutbaren Schluss: „Die besten Produkte zu erschwinglichen Preisen und zugeschnitten selbst auf die ausgefallensten und individuellsten Bedürfnisse, was könnte man mehr wollen? Allerdings kann der Konsumentenhimmel gar nicht anders, als Produzentenhölle zu sein.“14
Dass der große Personalmangel mit all diesen Facetten viele Länder, besonders heftig die Schweiz, Deutschland und Österreich gleichzeitig erfasst, ist zuerst als ein demografisches Schicksal zu verstehen und insofern rasch erklärt. Frappierend bleibt jedoch die Wucht der kulturellen Wende, die mit der demografischen einhergeht. Sie ist historisch zu nennen und zeigt die unglaubliche geistig-seelische Vernetzung breiter Bevölkerungsschichten, die wir mittlerweile erreicht haben.
Auf den nächsten Seiten erkunden wir die aufgewühlte Situation in der Arbeitswelt aus den Blickwinkeln der Arbeitnehmer*innen und der Arbeitgeber*innen. In den Kapiteln 2 und 3gehen wir den tieferen Ursachen der New-Work-Bewegung nach und stoßen dabei alsbald auf die Träume vieler junger Menschen vom schnellen Geld und schnellen Status am Anti-Arbeitsmarkt im Internet.
Eine Dimension der Verknappung des Angebots an Arbeitskräften von zusehends makroökonomischer Bedeutung ist der kollektive Umgang mit der Arbeitslosenversicherung. In Kapitel 4 befassen wir uns mit einer bislang unterbelichteten Form der problematischen Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen, nämlich mit der neuen Kultur des Das-war-dann-doch-nicht-soganz-meins und dem deutlich gestiegenen Niveau der Fluktuation am Arbeitsmarkt. Viele Arbeitskräfte nutzen die Arbeitslosenversicherung nicht mehr als Sicherheitsnetz, sondern als Pausenraum. Aber auch viele Arbeitgeber*innen machen heute Förderansprüche an den Staat geltend, die mit einem freien und selbstbewussten Unternehmerethos nur mehr wenig zu tun haben.
Zugleich macht ihnen das New Work immer mehr zu schaffen: Viele Unternehmer*innen fühlen sich mittlerweile „wie aus allen Wolken gefallen“, und zwar direkt „in eine neue Beziehungskiste“. Dem haben wir Kapitel 5 gewidmet.
Dann aber wagen wir die Wendung ins Hoffnungsvolle und gehen es philosophisch an: Wir wollen professionelle Arbeit und Liebe, wie oben schon angedeutet, ernstlich zusammendenken. Dies in der Überzeugung, dass Liebe in der Arbeit immer eine Rolle spielt, allein weil man seine Arbeit wirklich lieben kann – oder eben nicht.
Im Kapitel 6 entwerfen wir ein Konzept, mit dem wir die Gegenwart unserer Arbeitsgesellschaft neu deuten und zugleich neue Motivationsquellen für das künftige Arbeiten unter den Bedingungen des Personalmangels entdecken wollen.
Vielleicht wird gar der große Personalmangel – und nicht etwa die lang beschworene Massenarbeitslosigkeit infolge der Automatisierung – zum Katalysator einer neuen, gerechteren Arbeitsgesellschaft. Und der Thymos – der tief in uns eingebaute Drang nach Anerkennung zu den eigenen Gunsten – taucht wieder auf. Im besten Fall ist er „ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“.15
Ist nicht eine Wahrheit von New Work, die unsere Jungen so heftig spüren, dass alle Arbeit nun auch nach Liebe strebt?
Mit der Weisheit der Alten16 wissen wir, dass die Liebe in drei Gestalten vorkommt: Als Begehren (Eros), als Freundschaft (Philia) und als Nächstenliebe (Agape oder Caritas).17
Das gilt auch für die Arbeitswelt. In ihr wäre der Eros das Streben nach Geld, Status und Macht. Die Philia fänden wir in der Freude an der Kompetenz und dem Arbeiten in harmonischen Teams, in denen wir aufeinander achten. Und sogar die Agape oder Nächstenliebe meinen wir in der pragmatischen Arbeitswelt zu finden: in der Kollegialität, in der Orientierung an den Wünschen des nächstbesten Kunden ohne Diskriminierung der Person und auch in der Pflichterfüllung, bei der wir unsere eigenen Interessen immer wieder dem Wohl eines größeren Ganzen unterordnen.
So kommt aus unserer Sicht mit New Work eine neue Erotik der Arbeit ins Spiel, die die Arbeitsbeziehungen gehörig durcheinanderwirbelt, aber auch bereichert. Es gibt allerdings keine glückliche Liebe zur Arbeit im Sinne des Eros allein, weil er sich immer nur aus dem Begehren und dem Mangel speist und nie aus der ruhigen, gemeinsamen Erfüllung der Aufgaben.
Mit neuen kooperativen Arbeits- und Betriebsformen zwingt uns der Personalmangel, der Freundschaftsliebe einen prominenteren Platz im Wirtschaftsleben einzuräumen.
Und noch etwas scheint uns spannend und knüpft an unsere früheren Bücher an18: Mit der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens eröffnet sich die Chance, ein paar Gene mehr Nächstenliebe in die DNA unserer Institutionen einzubauen und vielleicht sogar – als Frucht einer auf den ersten Blick paradoxen Intervention – ein neues Arbeitsethos zu entfachen.
Können alte Werte in der ach so neuen Arbeitswelt eine Rolle spielen? Wir sind davon überzeugt, dass uns die Nächstenliebe und die Pflicht in der Arbeit nicht verlassen werden. Und sei es nur deshalb, weil wir uns die Welt der Pflichtbefreiten als eine recht unglückliche Welt vorstellen müssen.19 Die Pflicht bleibt der erhabenste Schmuck des Vernunfttiers Mensch, weil sie uns immer wieder aus der Verstrickung in uns selbst befreit.
1Mowing aus Poems by Robert Frost: A Boys Will and North of Boston. Signet Classic/Penguin Books, New York 2001, p. 41.
2 Platon: Symposion. Reclam 2006.
3 Siehe z. B. das Interview im österreichischen KURIER mit New-Work-SE-Chefin und Mutter der Personalplattform Xing, Petra von Strombeck. Online abrufbar unter: https://kurier.at/wirtschaft/karriere/xing-chefin-petra-von-strombeck-wir-stehen-am-anfang-eines-tsunamis/402029558.
4 Goethe: Faust 1. Verse 41 und 42. DTV, München 2015.
5 Wobei die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmer*innen in Österreich trotz des Personalmangels immer noch bei rund 375.000 Personen liegt (Daten Ende Dezember 2022).
6 Siehe Richard David Precht: Freiheit für alle. Goldmann, München 2022, S. 20.
7 Siehe den Aufsatz „Warum so ernst?“ von Jens Jessen in DIE ZEIT N°35/2022.
8 Dazu siehe Josef Pieper: Grundformen sozialer Spielregeln. Kösel, München 1987.
9 Eine Spezialform des Direktvertriebs. Bitcoin-Spekulation besitzt ähnliche Attraktivität.
10 Im Jahr 2021 lag der Anteil der Erwerbspersonen mit einem tertiären Abschluss (Universitäts-, Fachhochschul-, Akademie- oder Kollegabschluss) zwischen 15 und 65 Jahren in Österreich bei 35 Prozent (OECD-Schnitt: 41 Prozent). Im Jahr 2009 lag der Anteil noch bei 14 Prozent. Siehe https://www.studium.at/162665-bildung-zahlen-201011-akademi-kerquote-seit-1980-verdreifacht.
11 Siehe David Graeber: Bull Shit Jobs. Vom wahren Sinn der Arbeit. Klett-Cotta, Stuttgart 2020.
12 In der „Fachkräfteverordnung“ der österreichischen Regierung 2023 finden sich österreichweit bereits 98 Mangelberufe gelistet plus weitere 58 in einzelnen Bundesländern.
13 Siehe Publikation der Arbeiterkammer OÖ vom 8. September 2022: https://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/Junge_Arbeitnehmer_leiden_unter_Corona-Folgen.html.
14 Siehe Andreas Reckwitz/Hartmut Rosa: Spätmoderne in der Krise. Suhrkamp, Frankfurt 2021, S.235.
15 Goethe: Faust 1. Vers 1337. DTV, München 2015.
16 Vor allem Platon (Eros), Aristoteles (Philia), Jesus (Agape).
17 Siehe André Comte-Sponville: Glück ist das Ziel. Philosophie ist der Weg. Diogenes, Zürich 2010.
18 Siehe vor allem Georg Grund-Groiss/Philipp Hacker-Walton: Das halbe Grundeinkommen. Braumüller, Wien 2021 sowie Georg Grund-Groiss/Philipp Hacker-Walton: Arbeit und Gerechtigkeit. Braumüller, Wien 2019.
19 In Anspielung auf Albert Camus‘ Essay: Der Mythos von Sisyphos. Rowohlt, Hamburg 2000. Darin steht, wir müssten uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
2
Der große Verdruss mit dem Personalmangel
Medienberichte über einen branchenübergreifenden Arbeitskräftemangel häufen sich im deutschsprachigen Raum. Auch wird die Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten immer lauter. An dieser Stelle geben wir eine Übersicht ausgewählter Meldungen aus den Medien.
Meldungsübersicht
Klassenkampf und Sommerfrische: Das Alpenhotel Gösing im niederösterreichischen Ötscherland hält seit Juli geschlossen, weil ihm das Küchenpersonal davongelaufen ist20
Wir sitzen auf einer Zeitbombe: Stell Dir vor, es gibt Arbeit und keiner geht hin21
Polizei sucht dringend Personal. Doch die Suche nach Polizeischülern gestaltet sich schwierig22
In der Schweiz sind 250.000 Stellen offen! Wohin verschwinden unsere Fachkräfte?23
Verrückte neue Arbeitswelt: In Österreich sind so viele Menschen erwerbstätig wie nie zuvor. Trotzdem suchen zahllose Unternehmen händeringend nach Mitarbeitern.24
Vier Tage – ein Dilemma. Weniger Arbeitsstunden bei gleicher Bezahlung – ein britisches Experiment könnte die Arbeitswelt auf den Kopf stellen.25
Umfrage: In Deutschland schwindet die Lust am Arbeiten26
Personalnot am Krankenbett sorgt in Österreich und Deutschland für Aufsehen27