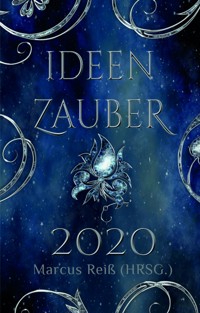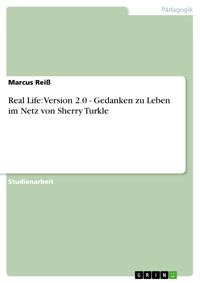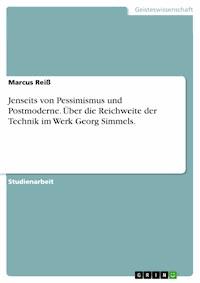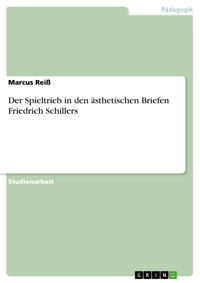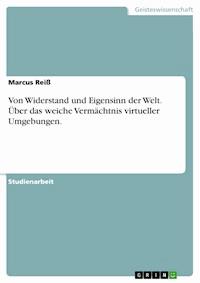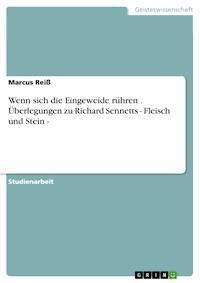
Wenn sich die Eingeweide rühren . Überlegungen zu Richard Sennetts - Fleisch und Stein - E-Book
Marcus Reiß
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Soziologie - Wohnen und Stadtsoziologie, Note: 1,0, Ruhr-Universität Bochum (FB Soziologie), Veranstaltung: Globalisierung und Identität, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit langer Zeit und in immer größerem Umfang leben Menschen in urbanen Räumen. Dort wohnen sie, verrichten alltägliche Arbeiten und sehen ihre Kinder in gewohnter Umgebung aufwachsen. Die Stadt ist aber zudem der Schauplatz, an dem das Fremde und Andersartige in seinen vielen Gestalten begegnet. Zentrales Thema in Richard Sennetts Buch „Fleisch und Stein“ ist eben dieses Fremde. Es geht um Konflikte im Rahmen von Widersprüchlichkeiten, denen Personen ausgesetzt sind, wenn sie Menschen aus anderen kulturellen Kreisen sehen, riechen, mit einem Wort: erleben. Eingebettet sind diese Problemstellungen, die zumal in der Neuzeit ihre Aktualität stets neu beweisen, in eine Stadtgeschichte, die ihr Gewicht durch Rekurs auf herrschende Körperbilder zu verschiedenen Zeiten gewinnt: Das Verhältnis des Menschen zur städtischen Architektur war und ist ein zutiefst gespaltenes und einen Überblick über Versuche, dieses zu bestimmen bzw. zu definieren, hat sich der amerikanische Soziologe zum Ziel gesetzt. Deutlich schimmern in Sennetts Buch Vorschläge durch, Sozialität in städtischen Räumen, die sich scheinbar im Banne des modernen Individualverkehrs in ihrer Vielfältigkeit eingeschränkt zeigt, wiederzubeleben, um jene Spannung im zwischenmenschlichen Geschehen, die sich auf eine konfliktbehaftete Fremderfahrung gründet, nicht als zu umgehendes, gefahrvolles „Gebilde“ zu markieren. Diese Arbeit versucht zunächst, sich in kritischer Auseinandersetzung um eine gebündelte Darstellung der „wichtigsten“ zeitlichen Geschehnisse im Ausgang sennettscher Gedanken zu bemühen, um im Anschluss den „Zustand“ beschreiben zu können, der sich zur Kennzeichnung heutiger Problemfelder im Rahmen innerstädtischer Sozialität heranziehen lässt. Danach wird der Frage nachzugehen sein, inwieweit die Merkmale des modernen Menschen im Zwischenspiel mit der Architektur von Sennett treffend und detailliert geschildert worden sind um in einem weiteren Schritt mögliche Widersprüche im Argumentationsgang aufzudecken bzw. dort zu vertiefen, wo genauere Analysen nicht angeboten werden...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
1. Einleitung
Seit langer Zeit und in immer größerem Umfang leben Menschen in urbanen Räumen. Dort wohnen sie, verrichten alltägliche Arbeiten und sehen ihre Kinder in gewohnter Umgebung aufwachsen. Die Stadt ist aber zudemderSchauplatz, an dem das Fremde und Andersartige in seinen vielen Gestalten begegnet.
Zentrales Thema in Richard Sennetts Buch „Fleisch und Stein“ ist eben dieses Fremde. Es geht um Konflikte im Rahmen von Widersprüchlichkeiten, denen Personen ausgesetzt sind, wenn sie Menschen aus anderen kulturellen Kreisen sehen, riechen, mit einem Wort: erleben. Eingebettet sind diese Problemstellungen, die zumal in der Neuzeit ihre Aktualität stets neu beweisen, in eine Stadtgeschichte, die ihr Gewicht durch Rekurs auf herrschende Körperbilder zu verschiedenen Zeiten gewinnt: Das Verhältnis des Menschen zur städtischen Architektur war und ist ein zutiefst gespaltenes und einen Überblick über Versuche, dieses zu bestimmen bzw. zu definieren, hat sich der amerikanische Soziologe zum Ziel gesetzt.
Deutlich schimmern in Sennetts Buch Vorschläge durch, Sozialität in städtischen Räumen, die sich scheinbar im Banne des modernen Individualverkehrs in ihrer Vielfältigkeit eingeschränkt zeigt, wiederzubeleben, um jene Spannung im zwischenmenschlichen Geschehen, die sich auf eine konfliktbehaftete Fremderfahrung gründet, nicht als zu umgehendes, gefahrvolles „Gebilde“ zu markieren. Diese Arbeit versucht zunächst, sich in kritischer Auseinandersetzung um eine gebündelte Darstellung der „wichtigsten“ zeitlichen Geschehnisse im Ausgang sennettscher Gedanken zu bemühen, um im Anschluss den „Zustand“ beschreiben zu können, der sich zur Kennzeichnung heutiger Problemfelder im Rahmen innerstädtischer Sozialität heranziehen lässt.
Danach wird der Frage nachzugehen sein, inwieweit die Merkmale des modernen Menschen im Zwischenspiel mit der Architektur von Sennett treffend und detailliert geschildert worden sind um in einem weiteren Schritt mögliche Widersprüche im Argumentationsgang aufzudecken bzw. dort zu vertiefen, wo genauere Analysen nicht angeboten werden. Diesem Komplex sind die letzten vier Kapitel gewidmet, in denen einzelne innerhalb des Buches aufkommende Begriffsbestimmungen auf ihre Stichhaltigkeit geprüft und, wo nötig, falsifiziert werden sollen, genauer: Geht es zunächst um die schmerzlich-subjektive Erfahrung des Menschseins, die ihre Erweiterung in intersubjektive Regionen vor dem Hintergrund des, bei Sennett Christologisch begründeten, Mitleids erfährt, so wird sich zeigen müssen, inwieweit mitleidendes erleben
Page 2
adäquaten sozialen Umgang ermöglichen kann, vor allem in Hinblick auf ihre ethische Reichweite.
Die Rolle des Ortes in Abgrenzung vom Raum zu bestimmen, ist nicht minder notwendig, ist er doch der Unter- bzw. Hintergrund, vor dem menschliches Begegnen sich abhebt, wo es geschieht. Dabei soll besonders das Verhältnis in seiner diametralen Struktur beleuchtet und hinterfragt werden.
Letztlich wird zu diskutieren sein, inwiefern sich das „blickende“ Auge in seine von Sennett angenommene Funktion als „passives“ Rezeptionsorgan restlos einfügt oder ob es Eigenschaften aufweist, die jenseits von Mechanismen der Negation des Fremden liegen und Fremdes überhaupt erst als solches verständlich machen. Zu beachten ist noch, das diese Unterteilungen keineswegs straff sind und Einflechtungen aus anderen Kontexten unterliegen. Natürlich nur dort, wo diese sich in den Gedankengang einfügen lassen. Begonnen wird jedoch mit einführenden Bemerkungen, die verdeutlichen sollen, aus welcher Perspektive der Text seine Interpretation erfährt.
2. „Corrosion of Character“
2.1 Der neue Kapitalismus
Die Überschrift dieses Kapitels stellt den Originaltitel des Buches dar, welches sowohl als Grundlage des Seminars „Globalisierungund Identität“dient, das im WS 2001/02 an der Universität Bochum veranstaltet wurde, als auch als Bezugspunkt innerhalb dieser Arbeit fungieren soll. Wenn es schon nicht Kernthema der vorliegenden Überlegungen ist, so sind doch spezifische Problemkonstellationen innerhalb dieses Textes aufzugreifen, um sie letztlich in anderem Kontext deutlicher herauszuarbeiten, wie er in „Fleisch und Stein“1(Sennett,1997) geschildert wird.
In beiden Schriften gerät ein Konfliktfeld der Moderne in den Vordergrund, das sich, zunächst nur sehr unscharf, mit dem Begriff der „Sozialität“ bzw. der Identität umreißen lässt. Die Perspektive, von der Sennett sich diesem nähert, auch wenn bisweilen intertextuelle Verknotungen bzw. Überschneidungen existieren, sind jedoch nahezu grundverschieden: Geht es in „Fleisch und Stein“ um den Entwurf einer Stadtgeschichte, so schlägt er in „Der flexible Mensch“2(Sennett,2000) Ansätze vor, anhand derer die
1Dieser Titel wird fortan innerhalb bibliographischer Angaben mit FS und Seitenangabe abgekürzt.
2Diese Übersetzung des Titels wurde für die deutsche Ausgabe des Buches gewählt, auch wenn sie in
gewisser Hinsicht unglücklich ist. Warum, wird sich weiter unten zeigen.