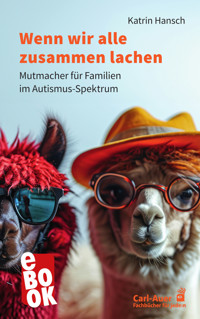
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Fachbücher für jede:n
- Sprache: Deutsch
Wetterfest durch die Stürme des Alltags Ist mein Kind einfach trotzig, oder steckt vielleicht etwas anderes hinter seinem auffallenden Verhalten? Die Diagnose Autismus, manchmal schon der Verdacht, dass ein Kind sich nicht "neurotypisch" verhält, zieht viele weitere Fragen nach sich: Wie gestalten wir damit unser Familienleben? Was ist dran an der Pathological Demand Avoidance (PDA)? Wie können wir unser Kind unterstützen? U. v. m. Katrin Hansch betreibt seit mehreren Jahren den Blog Different Planet, in dem sie über Neurodiversität im Allgemeinen und den Alltag einer "autistischen Familie" im Besonderen schreibt. In diesem Buch fasst sie den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zusammen und beschreibt, wie bei allen Herausforderungen Zuversicht und Lebensfreude erhalten bleiben. Das Buch lenkt den Blick von einer empfundenen Störung oder Dysfunktionalität auf die Gestaltung des Alltags. Es schildert die Facetten eines autistischen Lebens unaufgeregt und umfassend: von Diagnostik bis Ernährung, von Schlafen bis Urlaub, von Begleiterkrankungen bis zu staatlichen Hilfestellungen. Der Fokus bleibt dabei stets auf der Selbstbestimmung und den Bedürfnissen der Beteiligten, um das eigene Leben mit Glück und Sinn erfüllen zu können. Die Autorin: Katrin Hansch, Dipl.-Marketing-Kommunikationswirtin IMK; Systemische Beraterin artop Institut an der Humboldt Universität Berlin; Geschäftsführerin der Museum&Location Veranstaltungsgesellschaft der Staatlichen Museen zu Berlin mbH.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katrin Hansch
WENN WIR ALLE ZUSAMMEN LACHEN
MUTMACHER FÜR FAMILIEN IM AUTISMUS-SPEKTRUM
Mit einem Geleitwort von András Wienands
2024
Reihe »Fachbücher für jede:n«
Reihengestaltung und Satz: Nicola Graf, Freinsheim, www.nicola-graf.com
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagfoto: © Fatih – stock.adobe.com
Redaktion: Celine Eßlinger
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2024
ISBN 978-3-8497-0542-8 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8504-8 (ePUB)
© 2024 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: www.carl-auer.de.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
INHALT
GELEITWORT
VORWORT
MUT ZUM ANDEREN LEBEN – EINE EINSTIMMUNG
1 AUTISMUS: EIN SPEKTRUM DER VIELFALT
1.1. Vielfältige Wahrnehmungsmöglichkeiten von Autismus
1.2. Ist unser Kind vielleicht autistisch? – Die Sehnsucht nach einer Erklärung
Einfach irgendwie anders
Licht ins Dunkel bringen
1.3. Autismus als Diagnose
Spektrum? Störung? Oder einfach nur anders als die Norm(alität)?
Wie vergeben Ärzt:innen eine Autismus-Diagnose?
Die subjektive Wahrheit einer Diagnose
1.4. Mögliche Symptome von Autismus – klar definiert und schwer zu verstehen
Soziale Interaktion, Kommunikationsmuster und eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensweisen und Interessen
Alltagstaugliche Beispiele für die möglichen Symptome
Bandbreite und Grenzen der Subtypen
Die eigene Brille
1.5. Was sich mit der ICD-11 ändert
Ein Spektrum mit fließenden Übergängen statt Subtypen
Neues Verständnis und Beschreibung der Symptome
Autismus als relatives Problem
Autismus und Intellekt
Was ist mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)?
Eine neue Kategorie: Soziale Kommunikationsstörung
Fazit
1.6. Ursachen von Autismus
Was sind KEINE Ursachen einer Autismus-Spektrum-Störung?
1.7. Häufigkeit: Wird Autismus zur Modediagnose?
Folge- und Begleiterkrankungen von Autismus
2 NICHT NUR BESONDERS, SONDERN AUCH ANDERS
2.1. Ist hier etwas anders – oder mache ich alles falsch?
Hier ist was anders – UND ich mache alles falsch!
Theory of Mind (ToM)
Zentrale Kohärenz
Exekutive Funktionen
Schwierige Phase oder abweichende Entwicklung?
2.2. Zwischen Superkraft und Schuldgefühlen
Auf das Herz gehört
Ein Vater reflektiert den Diagnoseweg seines Sohnes
3 DIAGNOSE – JA ODER NEIN?
3.1. Alles richtig gemacht
Der Schlüsselmoment
Einfach nur genügend lieben
Welche Vorteile hat denn nun eine Diagnose?
3.2. Hilfestellungen in der Schule
Nachteilsausgleich
Schulhilfe und Schulassistenz
3.3. Pflegegrad
Wie bekommt man den Pflegegrad?
Schwerbehindertenausweis
Einzelfallhelfer
3.4. Der geschützte Raum
3.5. Der Weg zum Ziel
Nachteile einer Diagnose
3.6. Sorge vor Stigmatisierung
Soll ich meinem Kind die Diagnose mitteilen?
4 KLEINE UND MITTLERE HERAUSFORDERUNGEN – AUTISMUS IM ALLTAG (I)
4.1. Masking: Warum Autisten manchmal gar nicht autistisch wirken
4.2. Stimming: Innere Ordnung herstellen
Stimming und die Verarbeitung von Reizen
Stimming zu Hause: zulassen und ermutigen
4.3. Essen und Trinken – eine echte Herausforderung
Safe Foods
4.4. Weitere Besonderheiten im autistischen Alltag
Schlaf
Befremdliche Wirkung von Medikamenten und Co.
Kleidung muss sich RICHTIG anfühlen
Urlaub und Freizeit – einfach anders als bei anderen
Immer wieder sonntags
5 GROSSE HERAUSFORDERUNGEN – AUTISMUS IM ALLTAG (II)
5.1. Auf zum Overload!
5.2. Entladung des Reizbreis: Meltdown und Shutdown
5.3. Der große Knall: das Phänomen des autistischen Burn-outs
5.4. Entmaskieren – wie geht das?
5.5. Individuelle Warnzeichen für eine Reizüberflutung
Heute bleibe ich zu Hause! – Strategien für das Bewältigen der Langstrecke
5.6. Der Wunsch nach Teilhabe
Eine besondere Zeit: Pubertät und Jugend
5.7. Psychische Folge- und Begleiterkrankungen
Die Liste geht weiter
Überlegungen zu Ursachen, Auslösern und möglicher Hilfestellung
5.8. Leid ist nicht messbar – der Mythos des milden Autismus
Es ist nicht mild, es ist verborgen – und es ist anstrengend, jeden Tag und jede Nacht!
6 HILFE FÜR ALLE BETEILIGTEN
6.1. Plan B
Auch Eltern dürfen Hilfe brauchen
Wie wählt man eine passende Unterstützungsmaßnahme aus?
6.2. Der Therapie-Dschungel
Psychoedukation: Aufklärung durch Wissensvermittlung
Körpertherapien
Kunst-, Musik- und Bewegungstherapien
Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie PEP®
Ergotherapie und Heilpädagogik
Unterstützung der sozialen Interaktion und Kommunikation mit TEACCH® und PECS®
Marte Meo
Logopädie
Psychotherapien
Pharmakologische Unterstützung
Selbsthilfeangebote
Für zu Hause: Quetschen, Massieren und Kaseinverzicht
6.3. Professionelle Unterstützung an Schulen
Was ist eigentlich diese Inklusion – und merken wir was davon?
6.4. Eigeninitiativen
7 AUTOS ISMOS – AM ORT DES SELBST
7.1. Sonderfall autistische Frauen
Das schüchterne Mädchen
Zufluchtsort Magersucht
Masking Queens – autistische Frauen, die Königinnen des Verschleierns
Sind Frauen anders autistisch?
7.2. Der PanDA in dir
PDA und andere Katastrophen
SCHLUSSWORT
WORTE DES DANKES
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
LITERATUR
ÜBER DIE AUTORIN
Geleitwort
Liebe:r Leser:in,
als verantwortlicher Leiter eines Berliner Institutes, das für die psychotherapeutische Ausbildung und die kassenfinanzierte, psychotherapeutische Versorgung von rund 1600 Menschen (davon 400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) verantwortlich ist, ist es mir ein großes Anliegen so zu helfen, dass die Hilfe den Betroffenen nützt. Eine Selbstverständlichkeit? Leider nicht.
Frühkindlicher Autismus, das Asperger-Syndrom und atypischer Autismus, neu beschrieben als Autismus-Spektrum, werden als Entwicklungsstörungen des zentralen Nervensystems angesehen. Da sie sich nicht über Biomarker erfassen lassen, bedarf es aufmerksamer Mütter, Väter, Großeltern, Erzieher:innen und Lehrer:innen, Freund:innen, Hausärzt:innen, Psycholog:innen und Psychiater:innen, um eine Ahnung zu entwickeln was „los sein“ könnte.
Ich möchte nicht wirklich wissen, welche Leidenswege unzählige Familien gehen müssen, bis ihnen bei diesem Thema auf die richtige Art und Weise geholfen wird. Manchmal ist die vollständige Erschöpfung bis hin zum Burn-out der Eltern erforderlich, damit eine achtsame Person versteht, dass es sich nicht um falsche Erziehungsmethoden oder Paarkonflikte der Eltern handelt, sondern dass das Zentralnervensystem eines jungen Menschen auf eine Weise funktioniert, die nicht der Norm entspricht.
Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft, in der so vieles möglich ist. Und doch leiden Tausende Kinder und deren Familien, weil die Eltern von sich annehmen, sie seien einfach noch nicht gut genug – beziehungsweise: noch nicht so gut wie andere Eltern. In einer Leistungsgesellschaft ist häufig der erste Gedanke: Wenn wir noch besser werden, dann wird das schon! Aber genau dieser Wunsch der Eltern treibt die Familien an den Rand der Erschöpfung.
Katrin Hansch gelingt es mit dem vorliegenden Buch in ganz wunderbarer Weise, diesen Familien Mut zu machen, statt besser zu werden, anders zu sein. Sie nimmt die Leser:innen dabei sowohl als betroffene Mutter als auch als Systemische Beraterin an die Hand. Dasselbe Buch von einer Expertin ohne eigene Alltagserfahrungen im Autismus-Spektrum geschrieben, hätte nur den halben Wert. Von einer selbst betroffenen Autorin, die als Systemische Einzel-, Paar- und Familienberaterin beide Seiten vereint, ist das Buch unschätzbar wertvoll.
Ich wünsche mir, dass das Thema der Autismus-Spektrum-Störung – bzw. noch weiter gefasst: der Neurodiversität – zukünftig auf ebenso breiter Ebene wahrgenommen wird, wie all die anderen Themen, die sich die Gesellschaft in den vergangenen 20 bis 30 Jahren erarbeitet hat. Noch ist das Thema jedoch eher einer Randgruppe vertraut.
Dieses feine, hochintelligente und hoch empathisch geschriebene Buch, das randvoll mit wertvollen Informationen, Erfahrungen und Ideen ist, wird seinen Teil dazu beitragen, dass viele Eltern und Angehörige sagen lernen: Wir sind stolz auf unsere Kinder, weil – und nicht obwohl! – sie so erfrischend anders sind. Das Buch wird ein fester Bestandteil unserer Bibliothek im Rahmen der Approbation zum/zur Psychologischen Psychotherapeut:in sein. Und ich wünsche mir, dass die Bibliotheken der Kliniken, Praxen und Universitäten dieses Landes nachziehen, damit diese Familien und ihre Kinder nicht länger mit sicherlich gut gemeinten, aber doch die Situation bis hin zu lebensbedrohlichen Symptomen verschärfenden Ratschlägen nach Hause geschickt werden.
Den betroffenen Eltern und Großeltern, die dieses Buch lesen, möchte ich im Sinne der Autorin sagen: Alle wollen besondere Kinder haben. Sie haben eines. Machen sie sich, gemeinsam mit ihren Kindern oder Enkelkindern, die Welt so, wie sie ihnen gefällt! (Pippi Langstrumpf hatte eben doch Recht. Immer schon!) Dieses Buch wird ihnen bei der Gestaltung einer wunderschönen Villa Kunterbunt, ihrer ganz eigenen, eine große Hilfe sein.
Berlin, Mai 2024
Dipl.-Psych. András Wienands
Gesellschaft für Systemische Therapie und Beratung
Vorwort
»Die meiste Zeit war ich wütend. Auf das Leben. Ich habe mich sehr allein gelassen und fehl am Platz gefühlt. Anders zu sein ist NICHT TOLL, es hat sich NICHT TOLL angefühlt! Ich hab mich von Papa und Dir total gegängelt gefühlt. Nichts hat mir wirklich Spaß gemacht. Und am allerschlimmsten war die Schule.«
(Different Planet – »Die Zeit davor«)
Als mein Sohn mir diese schmerzhaften Sätze um die Ohren feuert, ist er 12 Jahre alt, und wir reden über die Kratzer, die die lange Zeit bis zur richtigen Diagnose auf seiner Seele hinterlassen hat. Die Diagnose Asperger-Syndrom wurde etwa drei Jahre vor diesem Gespräch gestellt.
Seitdem hat sich viel für uns verändert. Er und wir wissen heute, warum er sich anders fühlt. Und wir wissen, wie er Hilfe erfahren kann, und er erfährt sie auch. Heute ist er ein glücklicher Junge.
»Ich fühle mich insgesamt besser. Im Gegensatz zu früher liebe ich die Schule. Und zu Hause fühle ich mich irgendwie richtiger.«
(Different Planet – »Ohne Asperger wäre ich vielleicht ein schlechterer Mensch«)
Kratzer auf den Seelen der eigenen Kinder sind kaum zu ertragen. Sie pochen in stillen Stunden in einem selbst, sie lassen einen nicht schlafen und nicht zur Ruhe kommen. So ging und geht es mir, und so geht es denen, die ich als meine Community beschreibe. Wenn ich morgens aufstehe, viel zu früh, übernächtigt und rastlos, dann finde ich häufig traurige Mails, meistens von Müttern, die emotionale und praktische Unterstützung suchen. Und jemanden, der ihnen Mut zuspricht.
Dieses Buch soll genau das tun: Mut zusprechen, Wege aufzeigen, Unterstützung anbieten. Denn ist man als Einzelner oder als Familie nicht nur besonders, so wie jede und jeder von uns, sondern dazu noch anders, kann der Weg zum richtigen Platz im Leben auch mal steinig sein.
Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie besonders Familien ihr tägliches (Er)leben gestalten können, wenn bei einem Familienmitglied eine Diagnose aus dem autistischen Spektrum oder der Verdacht auf eine solche vorliegt.
Dann braucht es nicht nur eine gehörige Portion Alltags-Mut, sondern auch praktische Hinweise, wie man als System Familie die Steine des Alltags so einbauen kann, dass sie irgendwann in das eigene Zuhause passen.
Das Buch soll auch die Wahrnehmung dafür öffnen, dass autistisches Erleben nicht per se ein Problem sein muss. Viele Autist:innen finden heute einen passenden Weg für sich. Dazu gehört aus meiner Sicht ein gutes Verständnis des Phänomens selbst, sodass ein positiver Blick auf die individuellen Bedürfnisse, die damit einhergehen, möglich wird.
Geschrieben habe ich dieses Buch aus der Perspektive einer autistischen Mutter mit zwei autistischen Kindern, die unterschiedlicher kaum sein könnten.
Mein älterer Sohn erhielt im Jahr 2018 die Diagnose Asperger-Syndrom. Einige Jahre danach wurde ich selbst getestet und als autistisch erkannt und diagnostiziert, ebenso wie nicht viel später mein jüngerer Sohn. Er weist zudem die Merkmale eines Profils auf, das als Pathological Demand Avoidance (PDA) bezeichnet wird, und das ich im letzten Kapitel des Buches näher beleuchte.
Aus der Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen den als neurodivergent bzw. neurotypisch bezeichneten Polen des Menschseins, der bisher vorwiegend theoretisch gelebten Inklusion im Alltag und dem, was als Normalität gilt, entspringen die meisten Beiträge auf dem im Jahr 2020 von mir ins Leben gerufenen Blog Different Planet.1 Dort berichte ich über das Leben als Familie im Autismus-Spektrum und halte regen und beratenden Austausch mit einer stetig wachsenden Gemeinschaft.
Einige der im Buch zitierten Texte sind vor der Einführung des Begriffs Autismus-Spektrum entstanden, sodass vielfach die Bezeichnungen der Subtypen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus zu finden sind.2
Berlin, Mai 2024
Katrin Hansch
1 Verfügbar unter: www.differentplanet.de.
2 Einige der Blogbeiträge wurden zur besseren Lesbarkeit für dieses Buch geringfügig modifiziert.
Mut zum anderen Leben – eine Einstimmung
Ein Leben zu führen, in dem das eigene Ich ständig angepasst oder sogar verdrängt wird, bedeutet nach meiner Erfahrung kein glückliches Leben. Abgesehen davon, dass dies vermutlich für alle Menschen gilt, hat es für sog. neurodivergente Kinder und Erwachsene eine besondere Bedeutung. Denn eine Neurodivergenz wie Autismus ist kein separater Teil der Persönlichkeit oder des Charakters, den man als abgetrennt betrachtet oder erlebt, sie ist vielmehr eine Art Grundausstattung des Seins. Man geht durch jeden Schritt des Alltags als Autist:in. Diese Grundausstattung zu verdrängen oder anzupassen ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich – zumindest auf Dauer. Dass sich Symptome, die mit dem autistischen Dasein einhergehen und die manchmal auch belastend sein können, (therapeutisch) lindern lassen, ist durch die Akzeptanz der autistischen Grundausstattung keinesfalls ausgeschlossen.
Die Sichtweise auf Autismus als Grundausstattung des Seins meint nicht, dass alle Menschen, die als autistisch gelten, deswegen gleich sind. Autismus ist wie ein bestimmtes Betriebssystem, auf das die Individualität aufgespielt ist. So, wie auch neurotypisch – also das, was als das vermeintliche Normal gilt – als ein Betriebssystem betrachtet werden kann und ebenso eine Grundlage der individuellen Ausgestaltung darstellt.
Das autistische Betriebssystem kann mit sich bringen, dass nicht alles so verläuft, wie bei den meisten anderen. Es kann dazu führen, dass ein Kind tagtäglich von einem Erwachsenen durch den Unterricht begleitet wird, damit es ebenso lernen kann, wie seine Mitschüler:innen. Oder es kann bedeuten, dass zu Hause die Uhren nicht auf spontan, sondern auf minutiös durchgeplant stehen. Und es kann auch dazu führen, dass insbesondere die Eltern autistischer Kinder ein ganz anderes Leben führen als andere – denn möglicherweise werden ihre kleinen Herzensmenschen niemals zu Kindergeburtstagen gehen wollen, nicht auf Klassenfahrten fahren, keine Feriencamps besuchen und auch als Teenager keine Sozialkontakte pflegen. Sie verbringen möglicherweise jeden Nachmittag, jedes Wochenende und jeden Ferientag im heimischen Umfeld und benötigen den Kontakt zu ihren Eltern.
Und hier kommt der Mut ins Spiel: Es braucht Mut für die Akzeptanz, dass es niemals so sein wird, wie man womöglich dachte, und dafür, dass man sich vielleicht tagtäglich auch nach außen erklären muss: »Nein, danke, meine Tochter hat sich über die Einladung gefreut, aber sie möchte lieber nicht kommen«, »Meinem Sohn ist grade alles zu viel, er ist total überreizt, er kann für ein bis zwei Tage nicht in die Schule kommen, und auf den Schulausflug in der nächsten Woche auch nicht«, »Nein, wir können am Wochenende nicht zur großen Grillparty mit Live-Band kommen. Und auch nicht am nächsten Wochenende und auch nicht am übernächsten«.
Das alles annehmen zu können und zu wollen, erfordert nach meiner Erfahrung richtig viel Mut.
Dieses Buch soll aber auch Lust machen! Denn das etwas andere (Er)leben mit oder als Autist:innen kann ein sehr schönes sein, wenn man es zulässt und aus der passenden Perspektive daraufschaut.
»Lerngeschenk« – so nennt eine Freundin ihren autistischen Sohn. Und ja: Man kann lernen, Autismus zu verstehen. Und nicht zu selten helfen einem besonders die Kinder dabei. Wenn man sie lässt.
Für meinen Mann und mich gehörte auf dem langen Weg zum Mut für und zur Lust auf ein autistisches Familienleben genau dieses Lernen und das Verstehen des theoretischen Konstrukts Autismus definitiv dazu. Beides hat uns dabei geholfen, unser Familienleben passend zu gestalten. Im Austausch mit anderen Neurodivergenten und ihren Angehörigen stelle ich immer wieder fest, dass dieses Verstehen der wissenschaftlichen Konzepte, die zu den unterschiedlichen neurodivergenten Phänomenen existieren, auch anderen hilft. Es schafft ein Gefühl von Kompetenz für den Alltag.
Und darum geht es in diesem Buch: um den Alltag – den ganz normalen Wahnsinn des täglichen Menschseins.
Mit Erfahrungsberichten und Hintergrundinformationen soll das Buch nicht nur zur Aufklärung über das Phänomen Autismus beitragen, sondern den Leser:innen helfen, einen emotionalen und praktischen Umgang damit im Alltag zu entwickeln.
Im Vordergrund stehen dabei die Möglichkeiten der individuellen Lebensgestaltung mit dieser Besonderheit – denn jedes Leben ist anders und jede:r Autist:in ist anders. Es gilt das altbekannte Motto eines unbekannten Urhebers: »Kennste einen Autisten, kennste einen Autisten.«
1
AUTISMUS: EIN SPEKTRUM DER VIELFALT
»Was ist eigentlich diese Krankheit, die Mark3 hat?«, fragt mich mein damals 5-jähriger Neffe. Er meint damit den kurz zuvor diagnostizierten Autismus meines älteren Sohnes.
»Weißt Du«, sage ich, »eigentlich ist es keine Krankheit. Autismus ist nichts, was man hat oder was geheilt werden muss oder kann. Autismus beschreibt eher eine Art des Erlebens und des Seins.«
»Du meinst: ER BLEIBT SO?!«
Mein Neffe schaut mich mit weit aufgerissenen Augen an.
Ich lache. »Ja!«, sage ich. »Er ist, wie er ist. Er ist super. So wie du!«
1.1 Vielfältige Wahrnehmungsmöglichkeiten von Autismus
Mein älterer Sohn war in der Zeit, in der seine Testungen liefen, kein glückliches Kind, und das hat man gemerkt, jeden Tag. Er war anstrengend und träge gleichzeitig, für ihn lag kein Sinn in seinem Tun. Ich habe permanent an ihm herumerzogen, und so haben wir ständig gestritten. Es war grauenhaft und wegen vieler Dinge mache ich mir bis heute Vorwürfe.
Heute sind wir uns einig, mein Großer und ich: Es war nicht der Autismus, der ihn unglücklich gemacht hat. Es waren die Rahmenbedingungen. Die Unkenntnis über sein inneres Erleben, das wirre Bemühen seiner Mutter, ihn ins normale System zu quetschen, und das Nicht(an)erkennen seiner Bedürfnisse.
Erst das echte, wahre Verstehen des individuellen Autismus meines Sohnes und der Bedürfnisse, die für ihn und uns daraus resultieren, hat dazu geführt, dass aus einem unglücklichen Kind ein glückliches und aus einer belasteten Familie eine wurde, die sich auch wieder den schönen Seiten des Lebens widmen kann.
Eine gesicherte Diagnose und damit die Möglichkeit der zunächst abstrakten und theoretischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Autismus haben meinem Mann und mir dabei geholfen, uns mit dessen individueller Übersetzung in unseren Alltag und der Gestaltung des geschützten Raums, den unser zu Hause heute darstellt, zu beschäftigen. (Auf die Gestaltung dieses geschützten Raums gehe ich in Kapitel 3.4 näher ein.)
»Ich hab mich total fehl am Platz gefühlt. Irgendwie wusste ich, dass ich schon einen Platz bekommen könnte. Ich wusste nur nicht, wie. Aber ich hab nie gezweifelt, dass ihr mich wirklich liebt.«
(Mark, drei Jahre nach der Diagnose über die Zeit davor)
(Different Planet – »Die Zeit davor«)
Nicht selten bekommen Eltern, die gerade beginnen, sich mit der Möglichkeit zu beschäftigen, dass ihr Kind autistisch sein könnte, oder die erst kürzlich eine entsprechende Diagnose erhalten haben, den aus meiner Sicht nicht besonders passenden Hinweis, dass man seine Kinder einfach nur ausreichend lieben und so annehmen müsse, wie sie sind, dann regele sich der Rest schon von ganz allein. Doch Autismus regelt sich nicht. Er ist da, und er bleibt als Grundlage der Wahrnehmung ein Leben lang bestehen. Und gut für seine Kinder zu sorgen, indem man sich mit ihren Besonderheiten und Bedürfnissen intensiv auseinandersetzt, steht der ausreichenden Liebe zu ihnen meines Erachtens nicht entgegen.
Dass wir, mein Mann und ich, unsere Kinder bedingungslos liebten und lieben, bildet für mich die Basis, auf der alles Weitere aufbaut:
►
die kontinuierliche Neugestaltung und Anpassung unserer Abläufe und Kommunikation zu Hause,
►
das Beantragen von Schul- und Eingliederungshilfe,
►
die Suche nach einer Grund- und weiterführenden Schule, an der sie gesehen und akzeptiert werden,
►
das regelmäßige Rückkoppeln mit Ämtern, Lehrer:innen und Ärzt:innen,
►
das Beantragen der Nachteilsausgleiche,
►
die Anpassung unserer Arbeitszeiten und vieles, vieles mehr.
►
All das konnten wir erst zielführend umsetzen, als wir nach und nach erfassten, was Autismus ist – um uns dann mit diesem Wissen dem zuzuwenden, was ein Leben im Autismus-Spektrum für unsere Familie konkret bedeuten kann.
Die Idee, einfach nur ausreichend zu lieben, hatte zumindest mich bis dahin auf den berühmten »Ich bin an allem schuld und mache alles falsch«-Irrweg geführt.
1.2 Ist unser Kind vielleicht autistisch? – Die Sehnsucht nach einer Erklärung
Kurz bevor unser kleinerer Sohn vier Jahre alt wurde, sagte eine Erzieherin aus dem Kindergarten mit leuchtenden Augen zu mir »Philipp4 hat heute das erste Mal mit mir gesprochen, es war sehr süß! Überhaupt fängt er jetzt an, mit uns Erwachsenen zu kommunizieren.«
Ich war völlig entsetzt! Zu dem Zeitpunkt war er doch bereits seit knapp zwei Jahren in diesem Kindergarten!
Der Kleine tat sich wirklich schwer, im Kindergarten anzukommen. Bis er drei wurde, lag er eigentlich immer nur im sog. kleinen Zimmer und spielte mit Autos, am liebsten allein, Tag für Tag. Er nahm auch nicht an den Geburtstagsfrühstücken oder der Faschingsfeier teil. Er blieb dann lieber in »seinem« kleinen Zimmer und spielte dort. Er schien dabei nicht unglücklich zu sein, er wollte nur nicht bei den anderen mitmachen. Natürlich habe ich mal darüber nachgedacht, den Kindergarten zu wechseln, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass es nicht an diesem Kindergarten liegt, sondern eher am »Prinzip Kindergarten«.
Zum dritten Geburtstag unseres Kleinen zeigte sich mal wieder das Ausmaß meiner eigenen Unbelehrbarkeit. Unbedingt wollte ich, dass er auch mit einem Frühstück im Kindergarten feiert – so wie es die anderen Kinder auch tun (Sei normal! Sei normal!). Natürlich hat der kleine Kerl mir tausend Mal gesagt, dass er das gar nicht will. Das sei furchtbar laut und furchtbar wild, alle liefen durcheinander, und außerdem gebe es immer Salami. »Ach«, denkt sich die renitente Mama, »es wird ihm schon gefallen, wenn er erstmal mit der Krone auf dem Kopf dort sitzt.« Ich sollte meine Strafe bekommen: An mich geklammert saß er halb auf seinem Stühlchen, halb auf meinem Schoß, aß nichts, lächelte nicht und wartete, bis es vorbei war. Ich verbrachte die Zeit hockend und verkrampft neben ihm am Stühlchen und war um ein ausgeglichenes Lächeln bemüht. Als meine Beine irgendwann komplett eingeschlafen waren, sind wir nach Hause gegangen.
Was hatte das alles zu bedeuten? Haben wir nicht ein autistisches Kind, sondern zwei? Aber er ist doch so ganz anders als sein großer Bruder! Und viele der als typisch beschriebenen Symptome passen auch einfach nicht!
(Different Planet – »Kennste einen Autisten, kennste einen Autisten«)
Einfach irgendwie anders
So wie es uns zunächst mit unserem älteren und später dann mit unserem jüngeren Sohn ging, geht es den meisten: Da ist Verunsicherung, besonders zu Beginn der Auseinandersetzung mit den Symptomen von Autismus, und da sind Zweifel, ob die Beschreibungen, die zu lesen oder zu hören sind, wirklich zu dem kleinen Geschöpf, das gerade so friedlich neben einem schläft, passen. Oder zu dem großen Geschöpf, mit dem man zusammenlebt, oder auch zu sich selbst.
Zu dieser Unsicherheit gesellt sich häufig die Sehnsucht nach einer greifbaren Erklärung für das, was zu Hause passiert und einfach irgendwie anders ist als bei anderen. Auch Ablehnung, Wut oder Trauer über die Möglichkeit dieser Diagnose können auftreten – und manchmal schüttet sich alles gleichzeitig über einem aus: Verunsicherung, Zweifel, Sehnsucht, Trauer, Scham, Schuld, Wut, Hoffnung und vieles mehr vermischen sich dann zu einem inneren Gefühlsbrei.
Bei mir hat es viele Jahre gedauert, bis ich zu der Einsicht kam, dass sich diese Gefühle nicht dauerhaft unterdrücken lassen, und dass sie alle berechtigt sind. Als ich nicht mehr anders konnte, als sie zuzulassen, haben sie mir durch ihre Wucht sogar dabei geholfen, den richtigen Weg für meinen Umgang mit all dem zu finden, was da passierte.
Der richtige Weg ist wohl immer nur der eigene, ganz individuelle – und weil diesen vorher noch niemand gegangen ist, findet man ihn nicht so leicht.
Besonders in der Zeit, in der ich immer wieder versucht habe, die Symptome, mit denen Autismus und sich ähnlich darstellende Phänomene beschrieben werden, mit dem zu vergleichen, was ich bei unserem Großen wahrnahm, war ich durch und durch verunsichert, welchen Schritt ich als nächstes gehen könnte und wie daraus ein ganzer Weg werden könnte.
Im Rückblick auf diese Zeit, die für mich im Jahr 2016 begann, denke ich, dass es guttun kann, das Folgende zu beherzigen, wenn man diese Phase gerade durchlebt:
Anregungen für die Phase der Zweifel und der Sehnsucht nach einer Erklärung
Autismus kann die Erklärung für den Eindruck sein »Bei uns ist irgendwas anders als bei anderen«. Es kommen aber auch viele andere Gründe in Frage, denn Autismus ist im Alltag häufig nur schwer erkennbar. Die zugeordneten Symptome treffen niemals alle zu. Manche sind einfach nicht vorhanden, andere werden stärker oder schwächer gezeigt bzw. vom Umfeld wahrgenommen, und wieder andere sind nur in einigen Phasen spürbar und in anderen gar nicht.
Einige Merkmale werden von den Betreffenden gut ausgeglichen oder überdeckt. Selbst Fachpersonen können sie ohne Testungen nur schwer erkennen (Preißmann 2020).
Besonders bei bereits erwachsenen und spätdiagnostizierten Autist:innen können die Symptome einer Folge- oder Begleiterkrankung die autistischen Merkmale so dominieren, dass diese kaum noch wahrzunehmen sind (Preißmann 2020).
Sollte sich die Vermutung bestätigen: Autismus ist keine Strafe! In Autist:innen schlummern ebenso viele Fähigkeiten, Begabungen und Potentiale wie in Nichtautist:innen – auch zum Glücklichsein!
Autist:innen sind lebendige, ganzheitliche Menschen mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, Biografien, Talenten und Einstellungen, genauso wie Nichtautist:innen. Es gibt nicht den Autisten oder die Autistin.
Licht ins Dunkel bringen
Der beste Weg, den Zweifeln zu begegnen und Licht ins Dunkel zu bringen, ist der Gang zur Fachärztin oder zum Facharzt.
Der zuständige medizinische Fachbereich ist die Psychiatrie. In (kinder- und jugend)psychiatrischen Praxen kann in aller Regel der Wunsch nach Beratung und einer autismusspezifischen Diagnosestellung erfüllt werden.
Mithilfe wissenschaftlicher Testverfahren, die dort von geschulten Fachpersonen durchgeführt werden, wird bei einem begründeten Verdacht untersucht, ob es sich tatsächlich um Autismus handelt.
Mit Kindern kann alternativ ein sog. Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ), von denen es ca. 160 in Deutschland gibt, aufgesucht werden. Eine weitere Möglichkeit sind spezialisierte Ambulanzen von Kliniken, die häufig ebenso eine Erwachsenendiagnostik anbieten.
In der Realität ist dieser Rat – zur Fachärztin oder zum Facharzt, einem SPZ oder in eine Klinik zu gehen – leider nicht ganz leicht umzusetzen, denn diese sind fast überall gnadenlos überlaufen. Kinderärzt:innen bzw. Hausärzt:innen können i. d. R. nicht autismusspezifisch untersuchen.
Mittlerweile bieten auch psychologische Praxen vermehrt eine Autismus-Diagnostik an. Da Psycholog:innen im Gegensatz zu Psychiater:innen keine Ärzt:innen sind, werden die Kosten dafür in aller Regel nicht von den Krankenkassen übernommen und damit auch nicht eventuelle Anschlusstherapien.
1.3 Autismus als Diagnose
Um eine greifbare Vorstellung davon zu bekommen, was Autismus ist, wie er sich anfühlen und zeigen kann und wie man ihn als Familie möglicherweise (er)lebt, unternehmen wir im weiteren Verlauf dieses Kapitels zunächst immer wieder Ausflüge in die Theorie rund um Autismus.
Das Phänomen Autismus wird zunehmend intensiv beforscht (Freitag et al. 2017). Das gilt für seine Ursachen und Häufigkeiten, für seine unterschiedlichen Erscheinungsformen, mögliche Einflussfaktoren sowie Folge- und Begleiterkrankungen und sog. Differentialdiagnosen, also Symptome, Krankheiten oder Störungen, die von Autismus abzugrenzen sind (Kamp-Becker, Stroth u. Stehr 2020, S. 457 ff.).
Da der Fokus dieses Buches auf dem alltäglichen Leben mit Autismus liegt, beschränken sich die Einblicke in die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die aus meiner Sicht dafür notwendigen Aspekte.
Spektrum? Störung? Oder einfach nur anders als die Norm(alität)?
Das Fachwissen um die Besonderheiten, die das autistische Sein mit sich bringt, wächst aufgrund der intensiven Beforschung stetig. Gleichzeitig mehren sich persönliche Blogs, Social-Media-Profile und Publikationen von Autist:innen und ihren Angehörigen, sodass auch die Sichtweisen und Anliegen von Menschen, die Autismus im Alltag (er)leben, eine immer breitere Aufmerksamkeit erfahren. Diese persönlichen und sehr individuellen Darstellungen helfen dabei, die Vielschichtigkeit autistischen Erlebens kennenzulernen – hier werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse lebendig.
Eine gewisse theoretische Lebendigkeit erhält Autismus bereits über die Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung (ASS), die aktuell bevorzugt verwendet wird. Sie stammt aus den medizinischen Handbüchern zur Diagnose, auf die später in diesem Kapitel eingegangen wird.
Der Begriff Spektrum soll abbilden, dass Autismus ein breitgefächertes Phänomen mit potenziell von der Norm abweichendem Erleben und Handeln ist, das in den Alltagsstrukturen der vermeintlichen Normalität zu unterschiedlichen Problemen führen kann.
Erhält eine Person die ärztliche Diagnose Autismus, so wurden die Anzeichen ihres Erlebens und Handelns in verschiedenen Testungen untersucht und die Ergebnisse mit denen der Allgemeinheit verglichen. Daraufhin wurde festgestellt, dass sie bei der getesteten Person nicht den durchschnittlichen Ergebnissen der Bevölkerung entsprechen, sondern davon auffällig abweichen. Je nach angewendetem Verfahren kann eine nötige Anzahl von Merkmalen festgesetzt sein, bei denen eine signifikante Abweichung vorliegen muss (Maus 2020, S. 23 ff.).
Mit einer sicheren Diagnose ist aus meiner Sicht ein wichtiger, erster Schritt getan. Es gibt allerdings nicht wenige, die sich bewusst dagegen entscheiden, eine Diagnose einzuholen. Das hat manchmal rationale Gründe, manchmal ist es ein Bauchgefühl und häufig eine Mischung aus beidem. Meines Erachtens ist es absolut richtig, sich in dieser Frage selbst zu vertrauen und seinen eigenen Weg zu finden. Häufig höre ich auch von Eltern, dass sich möglicherweise betroffene Kinder gegen die Testungen sperren. In diesem Fall ist es nach meinem Empfinden ratsam, das Einholen einer Diagnose zu überdenken und (zunächst) von ihr abzusehen.
Weshalb es für unsere Familie wichtig und richtig war, ärztlich gesicherte Diagnosen stellen zu lassen, wird im Verlauf des Buches erläutert.
Wie vergeben Ärzt:innen eine Autismus-Diagnose?
Für das Ausstellen einer ärztlichen Diagnose nutzen Psychiater:innen zwei verschiedene internationale Manuale, also wissenschaftliche Handbücher, in denen die Diagnosen kodiert sind. Diese stellen auch die Basis für die erwähnten Testverfahren dar (Maus 2020, S. 23 ff).
Eines der in Deutschland verwendeten Manuale ist die ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, dt.: Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme), die von der World Health Organization (WHO) herausgegeben wird und in Deutschland verbindlich für die Vergabe von Diagnosen ist.
ICD-10: Einteilung in Subtypen
In Deutschland ist derzeit noch die 10. Version der ICD gültig, die im Jahr 1994 erstmals von den Mitgliedstaaten der WHO verwendet wurde.
Autismus wird in dieser ICD-10 im Kapitel Psychische und Verhaltensstörungen bei den Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen eingeordnet und in die Subtypen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus kategorisiert (BfArM 2018).
ICD-11: Autismus als Spektrum
Die 11. Version der ICD ist im Jahr 2022 international in Kraft getreten, doch liegt sie u. a. für Deutschland bislang noch als Entwurfsfassung vor. Sie wird derzeit übersetzt und evaluiert, um vermutlich im Jahr 2027 in Deutschland verbindlich zu gelten.
Autismus ist hier als Autismus-Spektrum-Störung bei Mentale-, Verhaltens- oder Neuronale Entwicklungsstörungen eingeordnet. Die Einteilung in die Subtypen wird aufgegeben und eine andere Form der Unterscheidung gewählt, die am Ende dieses Kapitels gezeigt wird (BfArM 2024).
DSM: Autismus-Spektrum-Störung seit 2013
Das zweite Manual ist das DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, dt.: Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen), es wird herausgegeben von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA).
Das DSM ist in Deutschland nicht verbindlich.
In seiner seit 2013 gültigen 5. Version, dem DSM-5, wird die Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung bereits verwendet und auch hier ist keine Einteilung in die aus der ICD-10 bekannten Subtypen vorgenommen (APA 2015).
Eine Diagnose nach ICD-10: Subtyp statt Spektrum
Mit der Diagnose nach ICD-10 geht die Zuordnung zu einem der drei Subtypen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom oder atypischer Autismus einher. Die wahre Geschichte eines Jungen im Kindergartenalter veranschaulicht einige ihrer Hauptmerkmale:
Momme, heute acht Jahre alt, wurde an einem heißen Sommertag in Berlin geboren. »Die Säuglingszeit war total entspannt, er war ein fröhliches, aufgewecktes und friedliches Baby. Ein richtiger Friedensstifter!«, erzählen seine Eltern begeistert. »Er ließ sich problemlos überall hin mitnehmen, er lachte, konnte fotografiert werden, kuschelte, spielte mit seiner großen Schwester und deren Freundin. Über zweieinhalb Jahre lief einfach alles großartig.
Dann luden uns die Kindergartenerzieherinnen zum Gespräch: Er lebt in seiner eigenen Welt, sagten sie, er ist abwesend und hat kaum Kontakt zu anderen Kindern, außerdem spricht er kaum.«
Die Eltern trauten ihren Ohren nicht! Beschrieben die da grade ihren Momme?? Er spielte doch zu Hause, auch mit einem Freund, und er kommunizierte mit ihnen, seinen Eltern – zudem zeigte er sich interessiert an vielen Dingen. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Konnte das wahr sein?
Sie begannen, genauer hinzusehen. Ja, doch, da war was anders. Sie suchten Rat bei der Kinderärztin und entschieden sich dann gemeinsam zu einem Besuch des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ). Schnell bestätigte sich der Verdacht auf Autismus – auch, wenn einige Sachen so gar nicht ins autistische Lehrbuchbild passen wollten: Zum Beispiel isst er abwechslungsreich und gut und er kuschelt gern!
Aber wir wissen ja: »Kennste einen Autisten, kennste einen Autisten.« Nicht alle zeigen alles.
Momme erhielt nach den entsprechenden Untersuchungen die Diagnose Asperger-Syndrom. »Er war ja knapp drei Jahre unauffällig, er konnte eigentlich nur ein Aspi sein«, erzählen seine Eltern. Aber im weiteren Verlauf erscheint die Diagnose dann doch nicht mehr so richtig passend. Wenn man es genau nimmt, wurde er ja doch noch vor seinem dritten Geburtstag auffällig. Als er so in Vorbereitung auf die Schule von Fachlehrern in der Kita beobachtet wurde, sahen diese bei ihm ungenügende sprachliche Mittel – was nicht zur Definition des Asperger-Syndroms passt.
»Sie konnten in ihm unter keinen Umständen einen Asperger erkennen«, erzählt Mommes Mama weiter, »und wenn ich manch andere Asperger so sehe, kann ich das auch verstehen.« Seine Diagnose wurde in frühkindlichen Autismus geändert, bei dem der Spracherwerb per Definition entweder deutlich verzögert einsetzt oder ganz ausbleibt. Doch wieder wurde die Diagnose angezweifelt. Ist er vielleicht ein hochfunktionaler Autist, bei dem Sprache und Kognition zwar auffällig spät einsetzen sollen, sich dann aber später einem für Asperger typischen Verlauf angleichen? Oder fasst man Momme als atypischen Autisten auf, weil er so viele autistische Symptome zeigt, aber keine der anderen Diagnosen so recht passen will?«
Für Eltern ist sowas vom Prinzip her egal. Mommes Mama, sein Papa und seine Schwester lieben ihn so, wie er ist. Doch sind am Ende alle froh, als er die endgültige Diagnose als frühkindlicher Autist erhält und damit Unterstützungsleistungen für ihn beantragt werden können.
(Different Planet – »High-Function-WAS???«)
In der ICD-10 wird Autismus wie gesagt nicht als Spektrum verstanden. Vielmehr werden hier einleitend die maßgeblichen Besonderheiten für die gesamte Symptomgruppe beschrieben und anschließend die Subtypen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus abgegrenzt, sodass der diagnostizierende Arzt bzw. die diagnostizierende Ärztin eine Zuordnung vornehmen kann.
Mommes Geschichte soll verständlich machen, was in den letzten Jahren im Forschungsbereich festgestellt wurde: Eine sichere Kategorisierung in Subtypen scheint nicht mit wissenschaftlich nachweisbarer Gültigkeit möglich zu sein. Offenbar sind die Übergänge zwischen den Subtypen fließend. Autismus wird dadurch in der ICD-11 als Spektrum beschrieben (Kamp-Becker, Stroth u. Stehr 2020, S. 458).
Die subjektive Wahrheit einer Diagnose
Gleichzeitig – und mindestens gleich bedeutsam – mit der Diagnose gilt meines Erachtens, was bei jeder Besonderheit, Einschränkung, Begabung, Krankheit, Behinderung, Störung und auch bei Gesundheit gilt: Die wissenschaftlich festgelegten Kriterien, die es zur Einordnung, Abgrenzung oder Behandlung benötigt, sind ein wichtiger Teil – die subjektive Übersetzung in den eigenen Alltag ist der andere. Denn kein Bandscheibenvorfall, keine Migräne, kein ADHS, keine Allergie, keine Depression, nicht einmal ein Vitamin-D-Mangel, die Pubertät, eine Hochbegabung oder aber pures Wohlbefinden wird von zwei Menschen gleichermaßen erlebt oder gelebt. Die jeweils aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Normen, die im Moment gültigen medizinischen Definitionen und, nicht zuletzt, die eigene Einstellung zu Gesundheit und Krankheit und der Umgang damit prägen das subjektive Erleben (Faltermaier 2020).
Autistisch zu sein bedeutet für jede:n etwas anderes.
1.4 Mögliche Symptome von Autismus – klar definiert und schwer zu verstehen
Sucht man in Büchern, Zeitschriften oder dem World Wide Web nach einer Beschreibung autistischer Symptome, wird man schnell fündig. Die meisten seriösen Veröffentlichungen halten sich da natürlich an die wissenschaftlichen Kriterien. Ich habe oft und viel dazu gelesen – doch meistens nichts verstanden, weil die Beschreibungen so allgemeingültig sind. Ich möchte versuchen, sie nach einer kurzen abstrakten Einleitung lebendiger und damit greifbarer werden zu lassen.
Ein Hinweis vorab: Erkennt man alle oder einige der Merkmale bei sich oder anderen wieder, so ist das kein Beweis für eine autistische Störung. Und nimmt man die Symptome nicht wahr, garantiert das auch nicht, dass keine autistische Störung vorliegt. Denn individuelle Wahrnehmung ist naturgemäß subjektiv und kontextabhängig. Sie zeigt vor allem, welchen Ausschnitt eines großen Bildes jemand erkennen kann, und weniger, wie das Bild wirklich oder objektiv ist.
Soziale Interaktion, Kommunikationsmuster und eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensweisen und Interessen
Die Hauptkriterien für das Vorliegen von Autismus sind in der ICD-10 zunächst in drei Symptomkategorien eingeteilt, bevor anschließend die Subtypen konkreter beschrieben werden. Die drei Kategorien lauten soziale Interaktion, Kommunikationsmuster und eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensweisen und Interessen (Tebartz van Elst 2022, S. 75 ff.). In diesen müssen ab der frühen Kindheit auffällige Abweichungen auftreten, auch wenn sie erst im Rückblick zuzuordnen sind (»Ach, deswegen hat die Lilly früher immer …!«).
Die ICD-11 wird die soziale Interaktion und die Kommunikationsmuster voraussichtlich verschmelzen lassen, sodass dort zwei, anstelle von drei Hauptkategorien beschrieben sein werden.
Damit ändern sich nicht die maßgeblichen Hauptsymptome, mit denen Autismus für Ärzt:innen messbar gemacht werden soll. Doch ihre Unterscheidung und Zuordnung erfolgt dann mithilfe der neu definierten Kategorien (Move 2023).
Alltagstaugliche Beispiele für die möglichen Symptome
Die ICD-10 sagt bei der relevanten Codierung F84 Tief greifende Entwicklungsstörungen:
»Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes.« (BfArM 2018)
Diese kurze und abstrakte Beschreibung der Abweichungen muss potentiell auf alle Autist:innen passen.
Für Menschen, die keine Mediziner:innen oder andere Expert:innen im Bereich Autismus sind, ist dies nur schwer greifbar. Einige Beispiele sollen helfen, die wissenschaftlichen Beschreibungen des Manuals besser zu verstehen.
Soziale Interaktion
»Ist das ein wertschätzendes Lächeln? Oder ein hämisches? Hat in seiner Stimme Wut mitgeklungen? Oder eher Trauer? Vielleicht war es auch Verwunderung?! Unterbricht sie ihren Satz, weil sie fertig ist, oder soll ich warten, bis sie weiterspricht? Steht der dunkelhaarige Mann einfach etwas herausgerückt, aber dennoch in der Schlange an, oder wartet er noch auf jemanden, und ich kann an ihm vorbeigehen?«
So oder so ähnlich versuchen viele Autist:innen die sozialen Signale zu deuten. Der Prozess ist ihnen dabei ebenso bewusst oder unbewusst wie Nichtautist:innen. Da die Informationen zwischenmenschlicher Zeichen für sie häufig rätselhaft sind, sind ihre Reaktionen nicht selten ebenso rätselhaft oder werden als unpassend wahrgenommen – und Missverständnisse sind vorprogrammiert.
Autistische Menschen senden diese sozialen Signale i. d. R. auch seltener als Nichtautist:innen, sodass sie gleichermaßen ein Rätsel für andere sein können (Freitag et al. 2017).
»Max sitzt immer alleine da und guckt den anderen zu!«, berichtet die Oma ihrer Schwiegertochter, nachdem sie Max einige Male aus der Schule abgeholt hat. Sie macht sich Sorgen um den kleinen Kerl. Findet er denn gar keine Freunde? Er ist doch ein prima Junge!
Im Kindes- und Jugendalter haben Autist:innen häufig Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen. Die Wechselseitigkeit eines sozialen Kontakts, sowohl bei der Entstehung als auch bei der Aufrechterhaltung, stellt sie vor verwirrende Herausforderungen. Sie wählen dann entweder das Alleinsein, den Kontakt zu Erwachsenen oder manchmal zu deutlich älteren oder deutlich jüngeren Kindern (Freitag et al. 2017).
Mamas Freundin ist spontan zum Kaffee vorbeigekommen und sitzt auf Annas Stammplatz am Küchentisch. »Anna!«, ruft sie, »dich habe ich ja lange nicht gesehen, wie groß du bist! Wie geht es dir und was macht die Schule? Du bist doch jetzt in die 4. Klasse gekommen, oder?«
Au weia, denkt Anna, und versucht, den Anblick der nicht sehr vertrauten Person auf ihrem Platz zu verarbeiten. Und so viele Fragen. Anna überlegt sich, dass sie am besten der Reihe nach antwortet. Das erste war keine Frage, anschließend gab es drei. Was die Schule macht, weiß sie eigentlich gar nicht. Können Schulen etwas machen? Eigentlich sind damit ja die Gebäude gemeint. Gebäude machen ihrer Kenntnis nach nichts.
»Anna!«, reißt ihre Mutter sie irgendwann aus ihren Gedanken, »möchtest du vielleicht wenigstens Hallo sagen?«
»Hallo«, stammelt Anna also und blickt weiter verunsichert auf die Szenerie.
Veränderungen in sozialen Situationen verunsichern Autist:innen häufig, und spontane Reaktionen, die von Nichtautist:innen als passend empfunden werden, fallen ihnen dann schwer (Freitag et al. 2017). Annas Mutter und ihre Freundin hätten ein – wenn auch zögerliches und schüchternes »Hallo, ja, geht ganz gut« vermutlich als passend eingeschätzt. Erlebt aber haben sie ein schweigendes, vielleicht sogar ausdrucksloses Kind, das – von außen nicht wahrnehmbar – intensiv über seine Antworten nachdenkt.
Kommunikationsmuster
»Mamiiii! Tucken! Da – Wauwau!«, ruft die kleine Clara ihrer Mama zu, die neben mir auf dem Sofa sitzt. »Es ist so süß«, sagt sie zu mir, »seit Clara vor einigen Wochen zu sprechen begonnen hat, macht es noch mehr Spaß!« Schön, denke ich sehnsüchtig, und gucke meinen gleichaltrigen Paul an, der sich auch kurz nach seinem zweiten Geburtstag noch nicht anschickt, mit mir zu sprechen … Der Hund, der seine Freundin Clara so in Entzückung versetzt hat, scheint ihn nur kurz von seinem Spiel abzulenken.
Zwei Jahre später hole ich Paul aus dem Kindergarten ab. Die Erzieherin sagt zu mir: »Dein Kleiner ist so lustig! Er hilft uns oft beim Tischdecken und Abräumen und dann erzählt er uns Geschichten wie ein Großer – was der alles schon kennt und weiß! Mit den anderen Kindern bleibt er nach wie vor schüchtern, aber mit uns blüht er auf. Und er wirkt irgendwie immer schon so … so … reif.«
Ja, denke ich schmunzelnd, das passt zu meinem Pauli. Schüchtern mit den Kindern, aber mit den Erwachsenen will er mitreden.
Autistische Kinder lassen ihre Eltern häufig auf die ersehnten ersten Worte warten – um dann aber richtig loszulegen und sich dann auch meistens ungewöhnlich auszudrücken. Die Sprache erscheint dann unpassend zum Alter – sie kann z. B. altklug wirken. Die Sprache kann aber auch ganz ausbleiben.
Ebenso sind Gestik und Mimik häufig schwach ausgeprägt. Viele Autist:innen erzählen, ohne dass sich in ihren Gesichtern viel Ausdruck zeigt und ohne mit ihren Händen und Armen begleitende Bewegungen zu machen.
Es kann ihnen auch Schwierigkeiten bereiten, wenn ein:e Gesprächspartner:in einen Themenwechsel vornimmt. Allerdings können sie selbst Meister:innen in spontanen Themenwechseln sein, um immer wieder auf ihre Interessen zurückzukommen (Freitag et al. 2017).
Eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensweisen und Interessen
6 Uhr morgens, der Wecker klingelt. Die Geschichtslehrerin Elke steht auf, zieht ihre Hausschuhe an und geht direkt ins Bad, um ihren Morgenmantel überzuziehen. Dann macht sie einen Kaffee. Ein Schuss Milch, ein Teelöffel Zucker. Das Duschen dauert ca. 4 Minuten, bis sie angezogen ist, braucht es weitere 15. Die Kleidung hat sie sich abends bereitgelegt. Anschließend isst sie ein weißes Brötchen, immer um 6.30 Uhr. Mit Butter und Honig die eine Seite, mit Frischkäse die andere. Um Punkt 7 Uhr verlässt sie das Haus. Jeden Tag, von Montag bis Freitag.





























