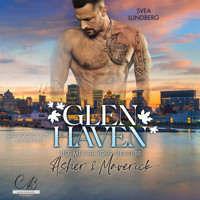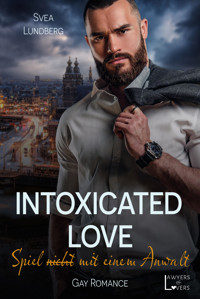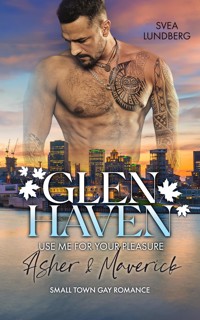4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Traumtänzer-Verlag Lysander Schretzlmeier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland, München, 1955: In einem Jazzkeller trifft der junge Pianist Maxim auf den Kriegsveteranen Rudolf. Die Liebe zur Musik verbindet die beiden ungleichen Männer. Schließlich vertraut Rudolf Maxim eine Geschichte an, die er bislang niemandem erzählt hat und die auch Maxim dazu bringt, seine eigene verbotene Liebe in neuem Licht zu betrachten. Frankreich, Verdun, 1916: Gefangen zwischen den Fronten, inmitten des Trommelfeuers, trifft Rudolf auf einen französischen Soldaten. Endlich bekommt das Grauen ein Gesicht. Doch in diesem spiegelt sich keinerlei Hass, sondern etwas zutiefst Menschliches. Etwas, das Rudolf erschreckend vertraut erscheint. In den wenigen gemeinsamen Stunden in einem zerschossenen Graben sind Rudolf und Jacques sich mit einem Mal näher, als sie es sein dürften. Bis sich ein Gedanke nicht mehr beiseiteschieben lässt: Könnten sie jemals Feinde sein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Widmung
I. Kapitel – 1955
II. Kapitel – 1914-1915
III. Kapitel – 1955
IV. Kapitel – 1914-1916
V. Kapitel – 1955
VI. Kapitel – 1916
VII. Kapitel – 1955
VIII. Kapitel – 1916
IX. Kapitel – 1955
X. Kapitel – 1916
XI. Kapitel – 1955
XII. Kapitel – 1955
XIII. Kapitel – 1955
XIV. Kapitel – 1917
XV. Kapitel – 1955
XVI. Kapitel – 1917-1918
XVII. Kapitel – 1955
XVIII. Kapitel – 1918-1925
Epilog – 1955
Nachwort & Danksagung
Weitere Bücher von Svea Lundberg
TITEL
Wenn wir Feinde
wären
Ein Roman von Svea Lundberg
Impressum
Copyright © 2021 Traumtänzer-Verlag
Lysander Schretzlmeier
www.traumtaenzer-verlag.de
© 2021 Svea Lundberg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten.
ISBN: 978-3-947031-35-1 (Taschenbuch)
ISBN: 978-3-947031-36-8 (E-Book mobi)
ISBN: 978-3-947031-37-5 (E-Book ePub)
Autorin: Svea Lundberg
Covergestaltung: Constanze Kramer
www.coverboutique.de
Bildnachweise:©Janar Siniväli, © tomertu – stock.adobe.com
©Sergey Nivens, MSK Photography - shutterstock.com
Weitere Romane der Autorin aus unserem Verlag:
Die stille Seite der Musik
Die Clifton-Lüge
Unter weiten Adlerschwingen
Widmung
Gewidmet Heinz-Emil.
In jeder einzelnen Figur lebt ein Teil von dir.
Emil trägt deinen Namen, Maxim teilt deine Liebe zur Jazz-Musik.
Mit Rudolf sehe ich den Schrecken der Front durch deine Augen,
auch wenn euer Krieg nicht derselbe war.
Und in Jacques lebt dieser wundervolle Mensch weiter, der geliebt wurde und vermisst wird.
Danke für alles.
I. Kapitel – 1955
Die auffallend weißen Zähne der Bardame blitzten im diffusen Licht des Jazzkellers auf, als sie lächelte und eine kleine Porzellanschale auf dem Klavier abstellte. Maxim erwiderte die Geste, jedoch mit einem innerlichen Augenverdrehen. Er hatte ihr schon mehrfach höflich zu erklären versucht, dass er keine Oliven mochte. Nicht mehr. Und dass er nicht trank. Wenigstens nicht, wenn er am Klavier saß und spielte. Aber die Bardame schien sich entweder nicht für seine Worte zu interessieren, oder sie hatte ihn schlichtweg nicht verstanden.
»Shouldn’t drink vodka without olives, ya?«
Vermutlich sprach sie tatsächlich kein Deutsch, geschweige denn Französisch – und sein Englisch hingegen war gelinde gesagt katastrophal. Demnach beließ Maxim es auch dieses Mal bei einem Lächeln und versuchte, ihren eindringlichen Blick zu ignorieren, ebenso wie das Glas und die kleine Olivenschale auf dem Klavier. Wäre es sein eigenes, würde er ganz sicher nicht dulden, dass man es als Bartisch zweckentfremdete. Aber bis er sich ein eigenes Klavier oder gar einen Konzertflügel würde leisten können, würde er noch in unzähligen Jazzkellern spielen müssen. Er würde noch einige Nächte unter freiem Himmel schlafen, immer darum bangend, nicht überfallen und seines wenigen Hab und Guts beraubt zu werden oder sogar …
Er verbot sich, den Gedanken zu Ende zu bringen. Er hatte es so gewollt. Gut, nicht alles hiervon, aber es war sein freier Entschluss gewesen, Frankreich zu verlassen und in München sein Glück zu versuchen. Er würde es schon finden. Irgendwann.
Als Solokünstler in einem der Münchner Jazzkeller auftreten zu dürfen, war ein guter Anfang. Es hatte ihn auch allerlei Überredungskünste gekostet, doch letztlich schien es den Betreiber überzeugt zu haben, dass Maxim bereits im Le Caveau de la Huchette gespielt hatte. Überhaupt schien dem Publikum ein französischer Musiker eine willkommene Abwechslung zu sein. Schon bei seinem ersten Auftritt am vergangenen Wochenende hatte Maxim mehr Applaus erhalten als seine amerikanischen Musikerkollegen. Ob dies nun an reiner Sympathie oder an seinem Stil lag, vermochte er nicht eindeutig zu sagen. Beides wäre ihm recht gewesen, Letzteres jedoch noch ein wenig mehr. Ganz im Stile André Persianis, der wiederum Milt Buckner nacheiferte, versuchte Maxim sich seit einiger Zeit an Blockakkorden. Und er fand, er machte seine Sache recht gut.
Einer inzwischen liebgewonnenen Routine folgend, ballte Maxim beide Hände zu Fäusten, legte sie aneinander und blies dreimal warmen Atem über seine Daumen. Dann streckte er die Finger, holte tief Luft. Der Geruch von Bier, Pfeifentabak und feuchtem Stein drang ihm in die Nase und ließ ihn sich heimisch fühlen. Glücklicherweise roch es nicht nach Zigarren.
Während er die Hände auf die Tasten senkte, huschte sein Blick noch einmal durch den Keller. Über die Stehtische und Stühle und über die Köpfe der Menschen hinweg, die teilweise in Gespräche vertieft waren und teilweise gespannt zu ihm aufsahen. Für einen winzigen Moment blieb sein Blick an einem älteren Mann hängen, der in der hintersten Ecke des Jazzkellers an einem kleinen Tisch saß. Seine schmale Gestalt wirkte unscheinbar, ebenso wie seine Kleidung, und gleichsam erschien er auf eine Art präsent, die es Maxim unmöglich machte, sogleich wieder fortzusehen. Der Herr war am vergangenen Wochenende schon da gewesen, fiel Maxim auf. Ganz sicher. Dann berührten seine Finger die Tasten und der Mann in der Ecke und der Tabakgeruch und die Oliven auf dem Klavier waren vergessen.
*
Brennend und inzwischen ein wenig zu warm rann der Wodka Maxims Kehle hinab. Nun, da er seinen Auftritt beendet hatte, genehmigte er sich die kleine Aufmerksamkeit der Bardame. Mit einem schiefen Lächeln nickte er in ihre Richtung und schob sich eine der Oliven in den Mund. Stellte, noch bevor er zugebissen hatte, fest, dass er tatsächlich keine Oliven mochte. Sie nie wirklich gemocht hatte und noch weniger mochte, seit … Nicht daran denken!
Für einen langen Moment hielt Maxim den Blick der Bardame. So lange, bis der Gedanke an Oliven in Paris verflogen war. Zu lange, wie Maxim fand. Rasch wandte er sich ab, ehe die Dame selbst oder einer der Umstehenden auf den Gedanken kommen könnte, ein neunzehnjähriger Franzose interessiere sich für die sicherlich Mitte dreißigjährige Amerikanerin.
Eine junge Frau tauchte neben dem Klavier auf und rettete Maxim unwissentlich aus seiner unangenehmen Lage. Noch während er ihr weit ausgestelltes Kleid musterte, dessen Farbe ihn an Sumpfdotterblumen erinnerte, begann sie, auf ihn einzureden.
»Ihre Blockakkorde, ich muss Ihnen sagen, sie waren wundervoll. Wie Sie die oktavversetzt verdoppelte Melodie zur Unterstützung der swingenden Melodielinie eingesetzt haben, war grandios. Man kann so wunderbar dazu tanzen, wenn sich die Melodie vom rhythmischen Hintergrund abhebt, finden Sie nicht auch?«
Maxim blinzelte irritiert und blieb einfach auf dem Klavierhocker sitzen, noch immer das Schälchen mit den Oliven in der Hand.
»Alors … oui. Ja, ich meine, ja, sicher, das kann man. Wenn man denn tanzt …«
»Oh, ich liebe es, zu tanzen. Sie nicht auch?«
»Non. Ich tanze nicht. Ich spiele nur.«
»Und das ganz hervorragend. Mein Ehemann – leider kann er heute Abend nicht hier sein – veranstaltet dann und wann Tanzgesellschaften und ist immer auf der Suche nach fähigen, jungen Musikern. Hätten Sie nicht Lust, einmal bei uns vorzuspielen?«
In einem langen, erleichterten Atemzug entließ Maxim die angestaute Luft aus seiner Lunge. Er hatte ihre Bewunderung für sein musikalisches Talent tatsächlich für einen Flirtversuch gehalten. Wie gut, dass dem nicht so war. Erst die Bardame und nun dieses zugegeben-ermaßen bezaubernde Wesen in Dotterblumengelb – sie erregten beide nicht seine Aumerksamkeit.
»Bien sûr, sehr gerne«, gab Maxim mit einem aufrichtigen Lächeln zurück. Er würde ihr selbstverständlich nicht sagen, dass er jedes Angebot, mit seiner Musik Geld zu verdienen, angenommen hätte.
»Ausgezeichnet. Sagen Sie, sind Sie an jedem Samstag hier?«
»In diesem Monat, ja«, entgegnete er wahrheitsgetreu und erhob sich endlich vom Klavierhocker. Noch hatte er keine Ahnung, wie er die nächsten Monate in München über die Runden kommen sollte. Aber wenigstens für die kommenden beiden Wochen wusste er, dass er genug Geld haben würde, um sich jeden Tag ein warmes Essen leisten zu können. Und vielleicht sogar einmal einen angenehm weichen Schlafplatz.
»Wie schön. Ich hoffe, dass mein Gatte mich am nächsten Samstag wieder begleiten wird. Vielleicht wird ein Vorspielen dann gar nicht mehr nötig sein. Spielen Sie nur so wunderbar wie heute und er wird Sie vom Fleck weg engagieren.«
Es war naiv, das wusste Maxim, dennoch schlug sein Herz bei ihren Worten ein vorfreudiges Stakkato.
»Verraten Sie mir noch Ihren Namen? Damit ich meinem Mann berichten kann …«
»Maxim«, entgegnete er rasch und streckte ihr seine freie Hand entgegen. »Maxim Dupond.«
»Sehr erfreut.« Schmal und zierlich, noch zierlicher als seine eigene, lag ihre Hand in seiner. »Annegret Büchner. Mein Mann ist Carl Büchner.«
Er nickte, als sagte ihm der Name irgendetwas. Ihr schien es zu genügen. Mit einem weiteren strahlenden Lächeln verabschiedete sie sich von ihm und huschte hinüber zu ihren Freundinnen, die ihn mit unverhohlener Neugier musterten. Als habe er es nicht bemerkt, wandte Maxim sich ab.
Die Bardame war gerade in ein Gespräch mit einem der Gäste vertieft. Daher ergriff Maxim das Wodkaglas vom Klavier und stellte es, gemeinsam mit dem Olivenschälchen, auf dem Tresen ab. Eine mahnende innere Stimme sagte ihm, er solle den Jazzkeller verlassen und sich auf die Suche nach einem Schlafplatz machen. Aber der Geruch des Kellers erinnerte ihn gerade zu sehr an die vergangene Zeit in Paris, als dass er ernstlich hätte darüber nachdenken können.
Ein einziger, kleiner Tisch war noch frei. Schräg gegenüber der Bar und mit gutem Blick auf die Bühne, auf der inzwischen weitere Musiker ihre Instrumente auspackten. Diesen Tisch steuerte Maxim an, und als er sich setzte, fiel sein Blick wieder auf den Mann am Nachbartisch. Ganz in der Ecke.
Ja, wirklich, stellte Maxim fest, als er sich niederließ, er war am vergangenen Wochenende bereits hier gewesen. Hatte an demselben Tisch gesessen. Allein und schweigend. Nur ein Glas vor ihm, genau wie jetzt. Und obwohl er schon seit Stunden dort zu sitzen schien, war es noch immer zur Hälfte voll. Die klare Flüssigkeit darin schien einfach Wasser zu sein.
Seufzend lehnte Maxim sich auf dem Stuhl zurück und schloss für einen Moment die Augen. Nun, da er nicht mehr auf der Bühne saß und die Anspannung des bevorstehenden Auftritts von ihm abgefallen war, kehrte bleierne Müdigkeit in seine Glieder zurück. Er hätte den Jazzkeller doch verlassen und sich auf die Suche nach einer Unterkunft für die Nacht machen sollen. Wenn er seine wenigen Habseligkeiten noch länger im Hinterzimmer stehen ließ und sich erst spät in der Nacht auf die Suche machte, würden die guten Schlafplätze längst belegt sein. Mit der Bezahlung des heutigen Abends hätte er sich auch ein kleines Zimmer in einer Pension leisten können, aber draußen herrschten noch milde Temperaturen und solange dies so war, wollte er nicht verschwenderisch sein.
Demnach bestellte er bei einem der Kellner lediglich ein kleines Bier und lauschte den Jazzern auf der Bühne. Auch wenn seine eigene Liebe dem Piano und den Blockakkorden in der Tradition Buckners galten, so mochte er doch den auf Bläsermelodien konzentrierten Cool Jazz und dessen weit geschwungene Melodiebögen ebenfalls.
Einer plötzlichen Eingebung folgend öffnete er die Augen, die ihm im Laufe des Musikstücks erneut zugefallen waren, und schielte zu dem Mann am Nebentisch. Er saß noch genauso da wie Minuten zuvor. Aufrecht, ohne verkrampft zu wirken. Die Hände unter dem Tisch verborgen und vermutlich im Schoß gefaltet. Das schummrige Licht malte Reflexe in sein ergrauendes Haar, das vermutlich einmal sattbraun gewesen war. Die Augen hielt er geschlossen, wie Maxim zuvor. Um die schmalen Lippen spielte ein zufriedener Ausdruck. Dennoch wirkten die Gesichtszüge auf eine bedrückende Art von den Strapazen der Zeit gezeichnet.
Es kam nicht oft vor, dass Maxim sich fragte, wie sein Vater wohl heute aussehen würde, hätte er den Krieg überlebt. Wie er überhaupt ausgesehen hatte. Damals, als er und seine Mutter sich kennengelernt hatten. Zwei Jahre, bevor die Truppen gegen Nazi-Deutschland mobilisiert wurden.
Maxim hatte nie ein Foto von ihm gesehen. Und auch das Gesicht seiner Mutter verblasste in seinen Erinnerungen längst zu Schemen, die an den Rändern zerfaserten und immer diffuser wurden. Vielleicht würde er sie eines Tages vergessen haben. In Hinterkammern seines Gehirns zurückgedrängt, auf die er keinen Zugriff mehr hatte.
Er wollte sich nicht fragen, ob sie es mit ihm genauso getan hatte. Redete sich stattdessen lieber ein, sie hätte ihn nicht freiwillig ins Heim gegeben. Sicher hatte sie es schwer gehabt. Ohne Mann. In einem vom Krieg zerrütteten Lothringen.
Sie hatte keine andere Wahl gehabt.
Ganz sicher nicht.
Ob dieser Mann Kinder hatte?
Irritiert über seine eigenen Gedanken wandte Maxim rasch den Kopf und starrte auf den Saxofonisten. In diesem Moment wäre ihm Bebop doch lieber gewesen als Cool Jazz.
*
Im fahlen Licht einer einzelnen Straßenlaterne öffnete Maxim sein Portemonnaie. Seinen vom schneidenden Wind klammen Fingern fiel es schwer, die Scheine zu fassen. Bittere Ironie, dass es so wenige waren, dass er für seine Zählung nicht lange brauchte. Einen großen Teil von dem, was er samstags im Jazzkeller einnahm, hatte er in den darauffolgenden Tagen schon wieder ausgeben müssen. Eine eisige Böe fegte durch die düstere Nebenstraße und schnitt beißend in den Kragen seines Mantels. Nein, er hatte wirklich keine Lust, diese Nacht in der überraschend früh hereingebrochenen Herbstkälte Münchens zu verbringen. Ein Zimmer in einer kleinen Pension würde er sich gerade so leisten können. Blieb zu hoffen, dass er um diese Uhrzeit überhaupt noch einen Unterschlupf bekommen würde.
Er hatte zu lange am Stachus gespielt, stets in der Hoffnung, doch noch ein paar mehr Münzen in seinen kleinen Violinen-Koffer wandern zu sehen. Aber entweder waren die Münchner dem ungemütlichen Wetter geschuldet zu rasch an ihm vorbeigeeilt, oder sein Spiel hatte sie schlichtweg nicht zu berühren vermocht. Er konnte es ihnen nicht mal verübeln. Er war kein Violinist, er war Pianist. Eigentlich …
Hektische Schritte auf klackernden Absätzen hinter ihm brachten Maxim dazu, rasch seine Geldbörse in seine Manteltasche zu schieben. Die Schritte verklangen. Über die Schulter hinweg sah Maxim sich um. Im Lichtkegel einer mehrere Meter entfernt stehenden Laterne erblickte er eine Frau. Viel zu leicht bekleidet für das herbstliche, feucht-kalte Wetter.
Hastig wandte Maxim sich ab, ließ den Blick die Straße entlangschweifen, auf der Suche nach einem Schild, welches ihm die passende Richtung aus dem Viertel weisen könnte, dessen Namen er sich nie merken konnte. La Cloche … irgendetwas mit Glocken. Kopfschüttelnd bückte er sich, wollte nach seinem Violinenkoffer greifen. Die Scheinwerfer eines nahenden Autos blendeten ihn. Gleich darauf hielt der Wagen. Ein feiner Nieselregen hatte vor wenigen Minuten eingesetzt, ließ den dunklen Lack im Laternenlicht glänzen. Bewundernd huschte Maxims Blick über den Lancia Aurelia – er hatte schon als Kind eine Schwäche für Automobile gehabt, eines besitzen würde er jedoch sicherlich nie.
Er wollte sich schon abwenden, um sich endlich einen Schlafplatz für die Nacht zu suchen, doch eine tiefe Stimme aus dem Inneren des Wagens ließ ihn innehalten.
»Wie viel?«
Maxim blinzelte irritiert. Halb dem Umstand geschuldet, dass er nicht bemerkt hatte, wie sich das Auto mit geöffneten Fenstern näherte, halb der Frage, von der er sich nicht sicher war, ob er sie richtig verstanden hatte.
»Sag … wie viel?« Die Stimme klang nun drängender. Schneidend.
»Comment?« Maxim trat näher an den Lancia heran, spähte ins Innere. »Wie bitte?«
Das Gesicht des Mannes lag halb im Schatten, dennoch erkannte Maxim strenge, kantig geschnittene Züge. Im flackernden Schein eines Feuerzeuges blitzten für einen kurzen Moment auffallend helle grüne Augen auf. Der Fremde nahm einen hektischen Zug von seiner Zigarette.
»Sprichst du überhaupt deutsch?«
»Oui. Ja.« Einem inneren Drang folgend trat Maxim einen halben Schritt zurück, auch wenn ihn dies nicht dem durchdringenden Blick des Mannes entzog. Dieser schnaufte, beugte sich über den Beifahrersitz und ruckte am Türöffner.
»Na schön … Ich hab nicht viel Zeit. Steig ein.«
Die Worte hallten in Maxims Kopf, überlaut im Gegensatz zum Klappern der Absätze, die sich über Asphalt näherten. Ehe er begreifen konnte, tauchte die leicht bekleidete Frau neben ihm auf.
»Wenn er nicht will … Ich bin frei.«
Wieder ein aufgebrachtes Schnaufen aus dem Inneren des Lancias. Die Tür wurde unwirsch aufgestoßen und Maxim stolperte rückwärts.
»Je ne suis pas … Ich bin nicht … Excusez-moi!« Noch während er die letzten Worte keuchend hervorstieß, haste er die Straße entlang. Windböen trieben ihm den stärker werdenden Nieselregen ins Gesicht.
*
In den folgenden Tagen vermied Maxim es, bei seinem Weg von der kleinen Pension, in der er sich eingemietet hatte, zum Jazzkeller besagte Straße im Glockenbachviertel zu passieren. Er ärgerte sich über seine eigene Leichtgläubigkeit. Darüber, dass er keinen Sinn daran verschwendet hatte, darüber nachzudenken, was des Nachts in Münchens Straßen geschah.
In Paris hatte er gewusst, an welchen Plätzen sich die Prostituierten und Stricherjungs herumtrieben und diese instinktiv gemieden. Überhaupt hatte er in seiner Heimat Frankreich ein Gespür dafür gehabt, in welche Seitenstraßen man besser keinen Blick warf, und um welche Menschen man besser einen großen Bogen machte. Hier in Deutschland schien ihm dieser Instinkt verloren gegangen zu sein. Oder vielleicht hatte er nur nicht auf die innere Stimme gehört, weil sein Hirn so damit beschäftigt gewesen war, all die neuen Eindrücke in sich aufzunehmen.
Von nun an würde er umsichtiger durch die Straßen gehen.
Mit neuem Elan öffnete er die Eingangstür zum Jazzkeller. Noch während er die steinernen Stufen in das Gewölbe hinunterstieg, umfing ihn der vertraute Tabakgeruch. Obwohl er selbst nicht rauchte, bedeutete der erdig-kratzige Geruch Heimat.
Maxim war spät dran, die vorherigen Musiker hatten die kleine Bühne bereits geräumt, sodass er sich direkt am Klavier niederlassen konnte. Sein Violinenkoffer fand dahinter Platz, seine übrigen wenigen Habseligkeiten hatte er am Vormittag in der Pension zurückgelassen.
Kaum hatte er sich gesetzt, stand auch schon einer der Kellner neben ihm und stellte ungefragt eine Tasse Tee auf dem Klavier ab. Kein Wodka, keine Oliven. Die Bardame war an diesem Abend offensichtlich nicht im Haus.
Während Maxim seine klammen Finger knetete, um sie für das bevorstehende Klavierspiel geschmeidig zu machen, ließ er den Blick suchend durch den Gewölbekeller schweifen. Entgegen ihrer Vorhersage war Annegret Büchner nicht da. Und auch kein Mann, den Maxim aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund für ihren Ehegatten Carl hätte halten wollen.
Enttäuschung machte sich in ihm breit, wurde jedoch gleich darauf von einem merkwürdig warmen Gefühl im Bauch überlagert, als Maxim einen Schluck des dampfend heißen Tees nahm und sein Blick auf den Mann an dem kleinen Tisch in der Ecke fiel. Tief ausatmend stellte Maxim die Teetasse zurück auf das Klavier, ballte die Hände, blies dreimal gegen seine Daumen und begann zu spielen.
*
Als er die Hände von den Tasten hob und in den Schoß sinken ließ, der Applaus in seine Ohren drang, sah er zu dem Mann in der Ecke. Er war noch da. Und nun waren es auch der Wodka und die Oliven. Unbemerkt von Maxim hatte die Bardame beides auf dem Klavier abgestellt, während er gespielt hatte. Er vermied es, sich suchend umzusehen oder ihr gar zuzuprosten, beobachtete stattdessen weiter den Fremden. In einem Zug leerte dieser sein Glas – früher als am vergangenen Wochenende. Er war noch da gewesen, als Maxim gegangen war. Was ihn wohl heute von hier forttrieb?
Ein Kellner, der an der Bühne vorbei zu dem Tisch in der Ecke eilte, versperrte Maxim für einen Moment den Blick und gab ihm Zeit, sich zu fragen, woher seine Neugier rührte. Was kümmerte es ihn, was der Mann vorhatte?
Mit einem leichten Kopfschütteln wandte Maxim sich ab, erhob sich vom Klavierhocker und griff nach dem Wodkaglas. Beißend rann die Spirituose seine Kehle hinab, beschwor Erinnerungen an vergangene Abende in den Jazzkellern Paris’ herauf. Abende in dieser kleinen Bar im Quartier Latin. Erinnerungen, an die Maxim nicht denken wollte. Erinnerungen an Alain. An sein fein geschnittenes Gesicht, halb verborgen hinter dem Rauch einer Zigarre. An seinen durchdringenden Blick über diese kleine Glasschale hinweg. Und an die Art, wie er eine Olive herausfischte und die Augen niederschlug, kurz bevor er sie sich in den Mund schob. Oh, nein, er sollte wirklich nicht an Alain denken. Und auch keine dieser Oliven essen.
»Herr Dupond?«
Versunken in diese Erinnerungen, zuckte Maxim zusammen und fuhr regelrecht herum.
»Entschuldigen Sie.«
Er blinzelte. An diesem Abend trug Annegret Büchner ein hellblaues Kleid und ein ebensolches Band im Haar. Es ließ sie noch jünger wirken, als sie vermutlich war.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken.«
»Il n'y a pas de souci! Ich war unachtsam.« Rasch streckte er ihr eine Hand entgegen. »Ich habe Sie vorhin, als ich zu spielen begann, nicht gesehen. Es freut mich, dass Sie hier sind.«
»Mein Ehemann … Carl, er ist auch hier, er … oh … da ist er.« Annegret winkte und Maxim folgte ihrer Blickrichtung, hin zu einem elegant gekleideten Herrn, der soeben zu ihnen herüberkam. Die Art, wie er sich umwandte, sein Gang, seine Mimik – alles an ihm wirkte kultiviert, jedoch auf eine abgeklärte Weise. Scharf sog Maxim die Luft ein. Unangenehme Kühle fraß sich binnen Sekunden durch seine Kleidung.
»Carl, das ist Maxim Dupond, von dem ich dir erzählt habe.«
Für einen Sekundenbruchteil trafen sich ihre Blicke. Er hatte wirklich auffallend grüne Augen. Die Brauen zuckten für einen winzigen Moment nach oben. Erkennen?
Maxim vermochte es nicht zu sagen.
»Excusez-moi …«, setzte er an, seine Stimme zu kratzig, um zu sprechen. Sein Blick wanderte tiefer. Auf die ihm entgegengestreckte Hand. Wenn er sich nur vorstellte, diese Hand hätte ihn …
»Kennen wir uns nicht?«
Die Stimme schnitt tief, dunkel und gleichsam messerscharf ins Maxims Gehirn.
»Non … nein …«, stieß er stockend hervor, taumelte einen Schritt zurück und griff wie mechanisch nach seinem Violinenkoffer, den er wie jeden Abend neben dem Klavier abgestellt hatte. »Vous devez me confondre avec quelqu’un d’autre. Ich muss los …« Noch während er die letzten Worte hervorpresste, drängte er sich an Carl Büchner und seiner irritiert dreinschauenden Ehefrau vorbei in Richtung der Treppe, die zum Ausgang des Kellergewölbes führte.
Eisiger Wind schlug ihm entgegen und kühlte die Hitze auf seinen Wangen herunter. In seinen Ohren hörte er sein eigenes Herz pochen. So heftig, als sei er soeben nicht zwanzig, sondern fünfzig Stufen hinaufgerannt.
Für einen langen Moment blieb Maxim mitten vor der Tür zum Eingang des Jazzkellers stehen. Unschlüssig, was er nun tun sollte. Der vernünftige Teil in ihm sagte ihm, dass er sich verhielt wie ein naives Kind. Dass er im Begriff war, einen möglicherweise gut bezahlten Auftrag in den Wind zu schlagen. Und dass es ihm gleichgültig sein sollte, dass Carl Büchner offenbar eine Schwäche für junge, männliche Stricher hatte. Dass es ein Missverständnis gewesen war, ihn – Maxim – für einen solchen zu halten. Der rebellische Teil in ihm wollte zurück in den Keller gehen und Annegret vom heimlichen Treiben ihres Ehegatten erzählen. Der furchtsame Teil in Maxim wiederum trieb ihn dazu an, die Beine in die Hand zu nehmen und von hier zu verschwinden. Dabei war es kein Ekel vor dieser Sache an sich, die ihn von Carl Büchner forttrieb, sondern vielmehr eine Mischung aus einer schwer greifbaren Abneigung gegen diesen Mann und der Furcht vor seinen eigenen Erinnerungen.
Ein warmer Luftzug in seinem Rücken, als die Türe erneut geöffnet wurde, ließ ihn binnen eines Herzschlags eine übereilte Entscheidung treffen. Doch er kam lediglich fünf Schritte weit.
»Passen Sie doch auf!«
Wie Minuten zuvor zuckte Maxim zusammen und taumelte einen Schritt zurück. Eine Entschuldigung – halb französisch und halb deutsch – murmelnd, starrte er auf den Mann herab, in den er soeben hineingelaufen war und der nun fluchend am Boden lag. Maxim gewahrte ein Wirrwarr aus zwei Gehstöcken und einem Bein. Nur eines!
»Mon Dieu!«, stieß er erschrocken hervor, »je suis désolé!« Hastig stellte er seinen Violinenkoffer ab und neigte sich zu dem Herrn hinunter, wollte ihm aufhelfen, doch ein unkoordinierter Hieb mit einem der Gehstöcke traf seinen Handrücken und ließ ihn schmerzlich keuchen.
»Qu’est-ce qui … À quoi ça rime?« Schnaufend rieb er sich die schmerzende Hand, starrte fassungslos auf den sich am Boden krümmenden Mann. »Ich möchte Ihnen nur helfen!«
»Ich brauche Ihre Hilfe nicht!« Aus einem wutverzerrten Gesicht heraus traf ihn ein bitterer Blick. Wieder schnappte Maxim ungläubig nach Luft.
»Sie? Das ist … Mon Dieu, nun lassen Sie sich doch helfen!« Entschlossen neigte er sich herab und ergriff den Mann, der sich halb aufgerappelt hatte und sich auf einen der Stöcke stütze, an den Oberarmen, zog ihn vollends in die Höhe. Schwer atmend standen sie sich gegenüber. Maßen sich mit Blicken.
»Es tut mir wirklich leid. Ich war in Gedanken. Geht es Ihnen gut?« Maxim konnte nicht verhindern, dass sein Blick bei den letzten Worten besorgt zu dem nur halb ausgefüllten Hosenbein glitt. Augenblicklich fragte sich Maxim, wie ihm bislang entgangen sein konnte, dass der Mann, der immer in derselben Ecke saß, nur noch ein Bein hatte. Und wie es dazu gekommen sein mochte, dass …
»Bestens«, knurrte der Fremde und stieß einen der beiden Stöcke so heftig auf den Asphalt, als wolle er sich selbst damit Lügen strafen.
»Brauchen Sie …«
»Sind Sie ein Arzt mit magischen Händen, der Beine wachsen lassen und Erinnerungen auslöschen kann?«
Maxim blinzelte. Schluckte trocken.
»Nein, ich … bin nur Pianist.«
»Pianist, so, so …«
In einer vagen Handbewegung wies Maxim hinter sich, zum Eingang des Jazzkellers.
»Ja, ich habe dort drinnen …«
»Dann brauche ich Ihre Hilfe nicht.« Abrupt wandte der Fremde sich um und hinkte, auf seine beiden Gehstöcke gestützt davon. Der untere Teil des Hosenbeins hing kraftlos am Oberschenkel herab und flatterte im kalten Nachtwind, als wollte der dunkle Stoff Maxim zuwinken.
*
Zu seiner Erleichterung und Enttäuschung gleichermaßen sah Maxim weder Annegret und Carl Büchner wieder noch den einbeinigen Fremden. Es war sein letztes Vorspiel im Jazzkeller gewesen, und nachdem er am darauffolgenden Tag seine Entlohnung abgeholt hatte, war er nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Mehr als drei Wochen war dies nun her. Seitdem hielt er sich damit über Wasser, auf den Straßen Münchens auf seiner Violine zu spielen. Einmal hatte er Glück gehabt, an einem Klavier in einem kleinen Café musizieren zu dürfen – eine Wohltat für seine Ohren und Finger, aber der Lohn war mager gewesen. Ebenso mager, wie Maxim es inzwischen war.
Er hatte noch nie viel Fett auf den Rippen gehabt, doch inzwischen schleckerten seine beiden Hosen, die er besaß, und seine Pullover an ihm, und der beißende Herbstwind kroch unerbittlich unter seine Jacke. Seine Zehen fühlten sich in den dünnen Lederschuhen wie Eisklumpen an. Auch die fingerlosen Wollhandschuhe schafften es nicht mehr, seine Finger warmzuhalten. Wenigstens nicht warum genug, um passabel auf der Violine spielen zu können. Dementsprechend dürftig war die Ausbeute bisher. Nur ein paar Pfennige und eine Deutsche Mark hatten bislang ihren Weg in seinen offen stehenden Violinenkoffer gefunden.
Mit einem Schluck zu kaltem Wasser versuchte Maxim, den bitteren Geschmack aus seinem Hals zu spülen und das Knurren seines Magens zu beruhigen. Beides gelang mehr schlecht als recht. Mit verbissen aufeinandergepressten Kiefern setzte er erneut seine Violine an. Ließ den Bogen jedoch bereits nach den ersten beiden schiefen Tönen wieder sinken, als sich zwei Gehstöcke und zwei Hosenbeine, von denen eines noch mehr schlackerte als seine eigenen, in sein Blickfeld schoben.
Erstaunt sah er zu dem Mann auf, der auf einen der beiden Stöcke gestützt, vor ihm stand und ihn musterte. Forschend. Reglos.
»Bonjour.« Seine eigene Stimme klang kratzig, gar nicht so, als habe er eben erst etwas getrunken.
Der Fremde nickte – nachdenklich, wie es Maxim schien – und beobachtete ihn weiterhin. Mit raschen Seitenblicken vergewisserte sich Maxim, dass keiner der anderen Passanten ihm direkte Aufmerksamkeit widmete. Auf keinen Fall wollte er einen von ihnen vergraulen, weil er nicht spielte und damit die Chance auf weitere Pfennige vertun. Dazu schmerzte sein Magen zu sehr vor Leere.
»Sie spielen nicht besonders gut.«
Sein Kopf ruckte herum.
»Comment?« Er räusperte sich, ein Hauch Trotz stieg hitzig in seiner Kehle hoch. »Mes doigts sont froids. Comprenez … Meine Finger … sie sind kalt.«
»Das ist eine Ausrede, aber kein Grund.«
Schnaufend stieß Maxim die Luft aus.
»Ah oui! Haben Sie schon einmal versucht, mit kalten Fingern eine Violine zu spielen?«
Hatte Maxim auf dem Gesicht des Fremden so etwas wie Verständnis erwartet, so wurde er auf ganzer Linie enttäuscht. Die schmalen Lippen verzogen sich zu einem ebenso schmalen Lächeln, dem ein Hauch von Spott anhaftete.
»Meine Finger haben in wesentlich kälterem Zustand schon wesentlich grausamere Dinge getan, als ein paar Saiten zu zupfen. Sie sollten besser wieder Klavier spielen.«
Einen Moment lang war Maxim versucht, seinem Gegenüber einen französischen Fluch an den Kopf zu werfen. Doch er verkniff es sich, ebenso wie er den Gedanken, weshalb der Fremde von ›grausamen Dingen‹ sprach, überging.
»Das würde ich ja gerne. Aber ich kann mich schlecht ungefragt in einem Jazzlokal ans Klavier setzen, non?«
Der Fremde brummte etwas, das sowohl Zustimmung als auch Widerspruch hätte sein können. Er schwieg, schien über Maxims Worte nachzudenken, und da noch immer keiner der Passanten Anstalten machte, stehen zu bleiben oder gar ein Portemonnaie zu zücken, nahm Maxim sich die Zeit, sein Gegenüber zu mustern.
Im herbstlichen-grauen Tageslicht wirkten die Furchen auf der Stirn des Mannes nicht ganz so tief, die Fältchen um Mund und Augen dafür umso sorgenvoller. Das ergrauende Haar war licht, besonders an den Schläfen.