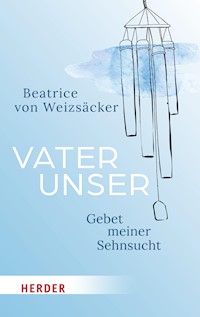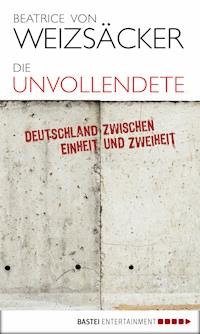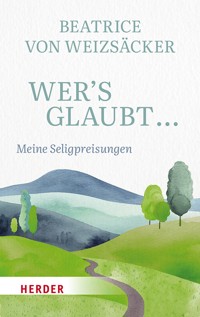
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Selig die Armen, die Hungernden, die Traurigen" – mit seinen acht Seligpreisungen stellte Jesus die Logik der Welt auf den Kopf. Doch was bedeutet das überhaupt, Selig-Sein? Was ist ein reines Herz? Kann nur selig sein, wer Frieden stiftet? Und wie kann das Himmelreich mein Eigentum sein? Beatrice von Weizsäcker geht der Sache auf den Grund und fragt Jesus ganz direkt, im Gasthaus, in einer Kirche, bei sich zu Hause oder im Konzertsaal: Was meinst du eigentlich damit? Und sie entdeckt: Die Seligpreisungen sind für sie wie Wegweiser, die Jesus an den Pilgerpfad ihres Herzens stellt. Und Jesus selbst geht als Wegweiser mit. Ein persönliche und überraschende Begegnung mit den Worten Jesu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beatrice von Weizsäcker
WER’S GLAUBT ...
Meine Seligpreisungen
Für Margarita
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt München
Umschlagmotiv: mutia_paint - Freepik.com
Schmuckelement im Innenteil: © MaxNadya / shutterstock
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL
ISBN Print 978-3-451-39819-3
ISBN E-Book 978-3-451-83687-9
Inhalt
Vorwort
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich
Himmelswunder • Arme Seelen • Der Schnupperkurs • Gottes Habseligkeiten • Wer’s glaubt, wird selig • Mit Jesus in der Kirche Christkönig – über die Armseligkeit der Kirche bei der Segnung von Paaren • Meine Armseligkeit • Verheißung statt Leistung • Meine Seligpreisung – für meine Sakramentsmenschen und die Kirche
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden
Jesus, Weggefährte • Die Vertröstung • Himmelreich-Trost • Mit Jesus im Konzert – über den Tod und den Trost • Mit Jesus in Jerusalem – über den Kreuzweg und die Einsamkeit • Trauerschmerz trifft Hoffnungstrost • Anna und der Einsiedler (Teil I) • Meine Seligpreisung – für die, die da sind
Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben
Das Poesiealbum • Die Sanftmut • Der Sanftmut • Engel, Pfützen, Bethlehem: die Eselliebe • Das Land und das Erbe • Das Haus, der Himmel und lauter Konflikte • Wer das glaubt ... • Mit Jesus in einem Münchner Gasthaus – über Wut • Mutig leben • Meine Seligpreisung – für die Ermutiger
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden
Gerechtigkeit versus Rechtsstaat • Reichtum der Gerechtigkeit • 308-fache Gerechtigkeit • Die katholische Kirche sättigt nicht • Missbrauch, Würde, Priester, Frauen • Ein Lied für die Kirche • Mit Jesus in Oberbayern – über den Himmel, die Berge und politisch-moralische Predigten • Mein Hunger • Meine Seligpreisung – für die, die nicht aufgeben
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden
Staccato-Sätze für uns • Die Streichholzschachtel • Staccatissimo-Sätze für die Kirche • Der dünne Faden der Barmherzigkeit • Kyrie eleison • Die Würde der Armen • Mit Jesus in der Herz-Jesu-Kirche – über offene Kirchen, die Anmaßung, mit Jesus zu sprechen, und das Sakrament der Versöhnung • Gottes Erbarmen • Meine Seligpreisung – für meine Selig-Menschen
Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen
Herzen, überall • Jesu Anspruch, unsere Wirklichkeit • Der Schlamassel: das reine Herz • Die Krux: Gott schauen • Mit Jesus in München – über KI, einen virtuellen Segen und das reine Herz • Die Sehnsucht, die Umkehr, der Kuss • Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz ... • Die fehlende Seligpreisung: die Liebe • Meine Seligpreisung – für meine Herzensmenschen
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden
Illusion Frieden • Die Anmaßung • Das Scheitern • Das Trotzdem • Jesu Schalom • ... der alles Verstehen übersteigt • Kind sein • Mit Jesus in der Nacht – über Frieden, feurigen Glauben und den Angriff auf Israel • Werkzeug sein • Meine Seligpreisung – für die Friedensstifter
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen
Lauter Seltsamkeiten • Gerechtigkeit: Was logisch ist • Segenbogen-Himmelreich • Mit Jesus in Oberammergau – über Judas’ Liebe zu Jesus, das Scheitern und ein politisches Christentum • Jesus als Jurist • Einfach nur selig • Freut euch, jubelt • Meine Seligpreisung – für uns und für Gott
Selig ohne Ende
Anna und der Einsiedler (Teil II) • Die Gewissheit • Mit Jesus im Glück
Meine acht Seligpreisungen • Postscriptum
Dank
Quellen und Literatur
Über die Autorin
Vorwort
Zwei Überlieferungen aus der Bibel dürften den meisten bekannt sein. Das Vaterunser und die Seligpreisungen. Beide stammen aus der Bergpredigt. Das Vaterunser können viele auswendig, die Seligpreisungen dagegen nicht. Rudimentär erinnert man sich an „arm“ und „barmherzig“, seltener an die Sanftmut, eher noch an das „reine Herz“. Doch an die Sätze selbst? Vermutlich nicht. Das ist wenig verwunderlich, denn das Vaterunser ist das Gebet der ganzen Christenheit. Wir beten es Sonntag für Sonntag und oft auch zwischendurch. Die Seligpreisungen kommen seltener vor.
Der eigentliche Unterschied aber liegt im Gegenüber. Das Vaterunser nennt unsere Bitten und unseren Lobpreis. Nicht wir sind angesprochen, sondern Gott. Bei den Seligpreisungen ist es umgekehrt. Sie richten sich an uns. Es sind Heilsversprechen. Wem „Heilsversprechen“ zu fromm ist, der kann sie zum Maßstab für sein Reden und Handeln nehmen. Als Richtschnur für ein Leben, an dem Gott Wohlgefallen hat. Oder als Wegweiser. So wie es der Psalmist sagt: Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben. (Ps 84,6)
Acht Seligpreisungen gibt es. Das ist kein Zufall, denn die Zahl ist heilig. Sie steht für Vollkommenheit.
Die Welt wurde in sieben Tagen erschaffen, der achte Tag markierte den Beginn der neuen Woche. Acht Menschen wurden mithilfe der Arche Noachs gerettet. (Gen 7,13; 1 Petr 3,20) David, der achte Sohn des Isai, wurde zum König von Israel gesalbt, nachdem Samuel die sieben anderen Söhne verworfen hatte. Erst beim Anblick Davids sagte er: Auf, salbe ihn! Denn er ist es. (1 Sam 16,12)
Das jüdische Lichterfest Chanukka, mit dem die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem gefeiert wird, dauert acht Tage. Das geht zurück auf eine schöne Erzählung aus dem Talmud. Danach wurde im zerstörten Tempel nur ein Kännchen Öl gefunden, das eigentlich bloß einen Tag hätte leuchten können. Auf wundersame Weise brannte es jedoch acht Tage und acht Nächte. Darum hat der Chanukka-Leuchter acht Kerzen.
Wie alle jüdischen neugeborenen Söhne wurde Jesus am achten Tag beschnitten. Seine Auferstehung war am achten Tag, „… am frühen Morgen des ersten Wochentages“. (Mk 16,9) Damit begann eine neue Zeit. Darum versammeln sich die Christen seither am achten Tag, dem „ersten Tag der Woche“. (Apg 20,7)
Im Islam spielt die Zahl Acht ebenfalls eine Rolle. Die Religion kennt neben sieben Höllen acht himmlische Paradiese. Der Felsendom in Jerusalem ist deshalb achteckig.
Auch jenseits der Religionen ist die Zahl von Bedeutung. In China ist sie die Glückszahl schlechthin, weshalb die Olympischen Spiele am 8.8.2008 um 8 Uhr 8 eröffnet wurden. Selbst das beliebteste WLAN-Passwort in chinesischen Hotels besteht aus lauter Achten. Es ist die 88888888. Das Sonnensystem hat acht Planeten. In der Mathematik schließlich ist die (liegende) Acht das Zeichen für Unendlichkeit.
Doch zurück zu den Seligpreisungen. Matthäus zählt sie auf (Mt 5,3–11):
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen.
Manche Sätze leuchten mir sofort ein, wie etwa die zweite Seligpreisung über die Trauernden, die getröstet werden, wenngleich auch sie ihre Tücken hat. Andere erschließen sich nicht so leicht, wie die dritte über die Sanftmütigen, die „das Land erben“ werden. Alles in allem werfen die Seligpreisungen eine ganze Reihe von Fragen auf.
Was bedeutet es, dass den Armen das Himmelreich gehört? Kann ich das Himmelreich besitzen? Was ist „arm vor Gott“? Und wer? Wie ist das mit der Kirche, die so reich ist und trotzdem oft armselig. Gehört auch ihr das Himmelreich?
Welche Sättigung erwartet Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, manchmal unter Lebensgefahr?
Was ist ein reines Herz? Was ist, wenn ich keines habe: Kann ich dann Gott nicht schauen?
Kann nur selig sein, wer Frieden stiftet? Was ist mit den Kriegen, mit den Menschen, die kämpfen müssen? Sind sie etwa keine Kinder Gottes? Dürfen sie noch nicht einmal Kinder Gottes genannt werden?
Was nützt den Verfolgten das Himmelreich, wenn sie nichts anderes wollen, als zu überleben, wenn ihnen Folter und Tod droht und sie über das Mittelmeer flüchten, wissend, dass sie womöglich ertrinken werden?
Anders gefragt: Kann nur selig sein, wer eine der Voraussetzungen erfüllt, die Jesus nennt? Sind Barmherzigkeit, Sanftmut, Trauer, Verfolgung, ein reines Herz Bedingungen für das Selig-Sein? Und wenn mir nichts davon gelingt, bin ich dann verloren? Kann ich dann nicht selig sein? Schon Annette von Droste-Hülshoff trieb die Frage um. In ihrem traurig-schönen Gedicht „Am Allerheiligentage“ schrieb sie: „Muß ich selber mich zerreiben? Wird mich keiner selig nennen?“
Schließlich: Was bedeutet es überhaupt, dieses Selig-Sein?
Fragen über Fragen.
Natürlich kann man dazu Bücher lesen. Doch oft will ich mehr wissen als theologische Theorie. Ich will der Sache auf den Grund gehen, will zurück zu ihrem Ursprung und hinaufgehen auf den Berg, auf dem Jesus die Seligpreisungen verkündet hatte und wo ich selbst einmal war, um ihm nahe zu sein. Ich will ihn fragen, sei es dort oder woanders, im Gasthaus oder in einer Kirche, bei mir zu Hause oder im Konzertsaal, in Oberbayern oder Jerusalem: Was meinst du eigentlich damit?
*
Es ist neu für mich, mit Jesus zu sprechen. Ihn etwas zu fragen. Ihn um etwas zu bitten. Begonnen hatte es am 19. November 2019. Da hatte ich am frühen Morgen ein Foto eines kleinen Kreuzes gepostet, das ich erst zwei Wochen vorher in Rom gefunden hatte; ganz leicht ist dieses Kreuz und gar nichts wert, aber ich mochte es sofort. Jesus mit ausgebreiteten Armen und wie zum Segen nach oben zeigenden Händen; zwölf ihm zugewandte Tauben vor blauem Hintergrund. Gleich nach der Reise hatte ich das Kreuz an der Wand neben meinem Schreibtisch befestigt, mit einer blauen Reißzwecke. Ich postete das Bild, notierte etwas und versah es mit allerlei Hashtags. Anlasslos. Und ahnungslos.
Am Abend wurde mein Bruder Fritz ermordet.
In der Nacht fiel mir der Post wieder ein, ich löschte den Text, die Hashtags und schrieb: „Gib acht auf meinen Bruder.“
*
Es war der erste Mal, dass ich Jesus um etwas bat. Sicher, Gebete gab es viele, Bitten, Klagen, Flehen. Doch nie war Jesus der Adressat gewesen, einmal abgesehen vom frühen Kindergebet „Komm Herr Jesus, sei unser Gast …“. Sonst richtete ich mich an Gott. Nur unterhalten habe ich mich nie mit ihm. Und nun diese Bitte an Jesus, wie der Beginn eines Gesprächs. Ich weiß nicht, woher der Satz kam. Ich kann mich kaum daran erinnern, ihn geschrieben zu haben. Er stand auf einmal einfach da. Offenbar wollte ich, dass Jesus etwas tat, dass er half. Meinem Bruder. Und mir.
Seit jener Nacht ist Jesus für mich ein Freund, ein Weggefährte und Gesprächspartner. Ich frage ihn, ab und zu fragt er mich. Manchmal lachen wir. Manchmal weinen wir. Manchmal beten wir. Und manchmal schweigen wir. Wie das so ist mit einem guten Freund.
Ich weiß nicht, ob seine Antworten mit kirchlichen Dogmen übereinstimmen, aber das spielt auch keine Rolle. Denn was Jesus sagt, nicht nur im Buch, das sagt er mir. Mag sein, dass es befremdlich ist, ihn für mich zu vereinnahmen. Als sei er bloß für mich da. Denn natürlich ist Jesus viel größer und viel mehr. Er kam ja nicht meinetwegen auf die Welt, sondern für uns. Er starb auch nicht für mich, sondern für alle. Schließlich ist er der Gottessohn.
Doch hatte Johannes nicht gesagt, dass Jesus mich erwählt hat und nicht umgekehrt ich ihn? (vgl. Joh 15,16) So sehr mich das wundert: Daran halte ich mich.
Darum beanspruche ich ihn für mich. Nicht nur, wenn ich das kleine Kreuz an meinem Schreibtisch betrachte. Mit ihm und den Tauben, die ihn umgeben. Und die mir Frieden bringen. Mein Seelengefährte und seine Botinnen.
Wenn das anmaßend ist, dann ist es eben so.
*
„Und?“, fragte mich während des Schreibens mein Lieblingsmensch. „Hat Jesus dir geantwortet?“
„Ja“, erwiderte ich.
„Was hat er gesagt?“
Nun, das steht in diesem Buch.
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich
Wie das Vaterunser beginnen die Seligpreisungen mit dem Himmel. Vater unser im Himmel fängt das Gebet an, das Jesus uns gelehrt hat. Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich, heißt die erste Seligpreisung, und auch diese Worte stammen von ihm. Der Himmel spielt bei den zentralen Texten Jesu eine herausragende Rolle. Doch nicht nur dort. Die ganze Bibel beginnt mit dem Himmel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so lautet der erste Satz des Alten Testaments, es ist der Auftakt der Schöpfungsgeschichte. (Gen 1,1)
Am Anfang sind Himmel und Erde klar getrennt. Nur der Regenbogen verbindet sie, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Im Vaterunser sind Himmel und Erde ebenfalls getrennt. Im Himmel wohnt der Vater, auf der Erde wohnen wir. Nur Gott verbindet beide. Der Himmel ist sein Thron, die Erde der Schemel seiner Füße. (vgl. Mt 5,34 f.)
Und dann sagt Jesus in den Seligpreisungen auf einmal: … ihnen gehört das Himmelreich. Was für ein Gedanke. Was für eine Verheißung. Uns, dir, mir gehört das Himmelreich! – Vorausgesetzt, wir sind arm vor Gott. Doch wie soll das gehen? Wie kann, juristisch gesprochen, das Himmelreich mein Eigentum sein? Wie kann es, nichtjuristisch gesagt, mir gehören? Dass ich ins Himmelreich gehöre, kann ich mir vielleicht noch vorstellen, obwohl ich nicht weiß, ob ich es auch verdiene. Aber dass das Himmelreich mir gehört?
Ich nähme es sofort.
Himmelswunder
Ich kann mir keinen schöneren Ort denken als den Himmel. Keinen friedlicheren. Ob es stürmt, ob dunkle Wolken den Blick versperren, ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, ob am Tag, ob in der Nacht: Der Himmel ist immer da.
Ich mochte den Himmel schon als Kind. Ich erinnere mich an die erste Nacht unter freiem Himmel und den Blick in die Sterne, die immer mehr wurden, je dunkler es wurde und je länger ich hinsah. Diese Unendlichkeit des Weltalls. Und das Wunder, dass ich nicht hineinfiel in dieses grenzenlose Nichts.
Später kamen neue Wunder dazu. Himmelszelt-Wunder. Das liegt an meinen Brüdern, die beide nicht mehr leben. Die Drobigen, Fritz und Andreas, sie haben meinen Blick verändert. Der Himmel bekam ein Gesicht, er bekam ihr Gesicht. Sie sind der Himmel. Und sie tun Wunder.
Einmal, in der Nacht, schien der Mond nach einem kräftigen Gewitter. Er schien auf ein paar Wolkentupfer, die langsam ihre Bahnen zogen. Mittendrin leuchtete ein zartes Wolkenherz. Allmählich löste es sich auf im stillen Wind, als sei es schüchtern. Das war bestimmt ein Gruß. Ein Gruß von meinen Brüdern. Ein andermal sah ich zwei Sternschnuppen, auch sie gewiss ein Gruß von meinen beiden. Sie winken oft auf diese Weise, meist zu Silvester und zum Geburtstag im August.
Nicht immer treten beide miteinander auf. Einst hat Andreas mir geschrieben, mit einem hellen Wolken-A. Senkrecht und ruhig lag es am Himmelszelt, als wollte es gesehen werden. Hinter dem A waren flache Schnörkel, die immer kleiner wurden, bis sie verschwanden. Wie eine Schrift, kaum leserlich. Ich konnte sie entziffern. Und war aus dem Häuschen.
Das ist der Himmel. Unzerstörbar. Unverbrüchlich. Ein Lebensort und Wunderland. Ein Versprechen auf die Zukunft, die sichtbar schon begonnen hat.
Nirgends stelle ich es mir schöner vor, nirgends beglückender als dort, beim „Vater unser im Himmel“ und seinem Sohn. Der Himmel ist die Welt, die wir betreten, wenn wir die irdische Welt verlassen, das glauben wir. Im Himmel sind die Menschen, die uns fehlen. Auferstanden von den Toten … aufgefahren in den Himmel … Dort ist Ruhe. Dort ist Frieden. Da ist Platz für alle.
Niemand weiß, wie der Himmel ist und wie es dort ist. Bestimmt ist er kein Ort, wie wir ihn uns vorstellen. Bestimmt ist er kein Ort wie andere Orte, die wir kennen. Der Himmel liegt außerhalb unserer Welt und jenseits unserer Vorstellungskraft. Der Himmel ist wie der Horizont, den man vielleicht erreichen will, doch niemals kann. Denn kaum ist man dort, ist er woanders. Hinter dem Horizont geht es weiter bis hinein in die Unendlichkeit. Der Himmel ist der unendliche Ort der Unendlichkeit Gottes.
Die Unendlichkeit aber entzieht sich dem Eigentumsbegriff. Denn Eigentum ist stets konkret: ein Gegenstand, ein Grundstück, ein Kunstwerk, ein Urheberrecht, eine Erfindung. Eigentum ist vom Grundgesetz geschützt. Ganz anders als der Himmel. Er kann uns darum nicht gehören.
Und das Himmelreich?
Auch das Himmelreich ist kein Ort. Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe, sagt Jesus. (Mt 4,17) Und an anderer Stelle: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. (Mt 18,3) Damit kann kein Ort gemeint sein. Das Himmelreich, von dem Jesus spricht, ist das Reich Gottes. Es ist der Himmel, reich an Gottes Gaben. Reich an seiner Gegenwart. Reich an seiner Güte. Reich an seiner Freiheit. Reich an seiner Liebe. Reich an Freude, an Erfüllung, an seiner Unendlichkeit. Nichts davon kann man besitzen.
Trotzdem sagt Jesus: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Die Seligpreisungen beginnen mit einem Rätsel. Mit einer kühnen Behauptung.
Arme Seelen
Wer arm ist vor Gott, ist selig. So steht es im Matthäusevangelium. Doch welche Armut ist gemeint? Armut als Gegensatz von Reichtum? Armut statt Eigentum? Armut statt Geld? Armut statt Macht? Armut statt Fülle? Sind nur die gemeint, die nichts davon haben?
Und was ist mit den vielen, die zu wenig haben, um über die Runden zu kommen? Die Hungernden, die Frierenden, die Obdachlosen, die Gefangenen, die Gefolterten, die Geflüchteten. Was nützt ihnen die Armut vor Gott, wenn sie nicht einmal genug haben, um in Würde zu leben? Manche riskieren sogar das Leben, das sie noch haben, um ihrer Not zu entkommen. Wie Spott muss ihnen die Seligpreisung vorkommen. Sie alle wissen, was Armut heißt.
Und die, die viel besitzen, die mehr haben, als sie brauchen? Die Vermögensberater beschäftigen, weil sie keinen Überblick mehr über ihre Finanzen haben, oder keine Zeit, sich um ihren Reichtum zu kümmern, die nichts anderes im Sinn haben, als ihr Geld zu vermehren: Sie sind nicht arm. Trotzdem sind sie nicht reich im Sinne Jesu, wie eine Geschichte aus der Bibel zeigt. Es ist das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr. (Mk 10,17–27)
Als Jesus unterwegs war, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete ihm: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote. Der Mann beteuerte: Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus entgegnete: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das betrübte den Mann, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! Die Jünger waren verwirrt. Noch einmal sagt Jesus: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen! Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Da gerieten die Jünger in Panik und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sprach: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich.
Ich mag die Geschichte. Nicht nur, weil sie zeigt, dass auch reiche Menschen arme Seelen sind. Nicht nur wegen des Bildes, das Jesus verwendet, die Idee, dass ein Kamel versuchen könnte, durch ein Nadelöhr zu spazieren. Sondern vor allem wegen des letzten Satzes. Wir mögen nicht verstehen, was Gott mit uns vorhat. Wir mögen nicht erkennen, was Jesus mit Armut meint. Wir mögen nicht wissen, was wir tun sollen oder wie wir uns richtig verhalten sollen. Wir können es nicht, weil es für uns nicht möglich ist, die Ratschlüsse Gottes zu ergründen. Doch das spielt keine Rolle, weil Gott an unserer Seite ist. Und für ihn ist alles möglich.
Jede Gruppe, ob arm, ob reich, ob nicht genug, zeigt, dass es bei der Seligpreisung nicht um Leistung geht, nicht um Geld oder Macht. Dass Armut vor Gott etwas anderes sein muss. Demut könnte es sein. Das Wissen, dass wir unzulänglich sind. Dass wir nicht genügen. Und der Glaube, dass Gott uns nimmt, wie wir sind. Als Wollende. Und Geringe. Als arme Seelen. So könnten wir selig sein.
Der Schnupperkurs
Was aber ist selig? Und wer? Das Wort „selig“ kommt in der Einheitsübersetzung 98-mal vor, bei Martin Luther dagegen nur 87-mal. Wie froh bin ich, katholisch zu sein. Falls Seligkeit denn etwas Gutes ist.
Das Wort selig kommt vom indogermanischen „salin“, das Glück und Heil bedeutet. So wird selig oft verstanden. Wer glücklich ist, ist selig, sagt man. Das lässt sich sogar noch steigen, vom Glück zur Glückseligkeit.
Trotzdem stimmt es nicht, weil glücklich und selig nicht dasselbe sind. Glück ist ein Moment. Selig zu sein, ist mehr. Natürlich kann auch das Gefühl der Seligkeit vorbeigehen. Aber die Seligkeit hat eine andere Dimension. Es ist eine göttliche, eine himmlische: Selig, … denn ihnen gehört das Himmelreich, sagt Jesus gleich zweimal in den Seligpreisungen, bei der Armut und bei der Gerechtigkeit. Da schimmert es durch, das Göttliche. Und es ist auch so. Wenn ich selig bin, fühle ich mich wie im Himmel. Wenn ich vom Seelenfrieden spreche, meine ich einen inneren, einen himmlischen Frieden. Einen Frieden, der schon da ist und nicht erst im Himmel auf mich wartet.
Im Englischen heißt selig „blessed“. Zurückübersetzt bedeutet das „gesegnet“. Doch auch selig und gesegnet sind keine Synonyme. Gesegnet zu werden, beschreibt eine Handlung, selig zu sein einen Zustand. „Geseligt“ werden gibt es nicht. Noch etwas anderes unterscheidet die Begriffe. Wenn wir gesegnet werden, können wir selig sein, müssen es aber nicht. Selig im Sinne von befreit, erlöst, beseelt. Es gibt Momente, in denen uns der Segen zwar guttut, er aber nicht dazu führt, dass es uns auch gut geht. Weil er womöglich nur kurz befreit von all der Last, die trotz des Segens weiter lastet.
Es hat schon seinen Grund, warum Jesus „selig“ sagt und nicht „glücklich“ oder „gesegnet“.
Die Seligpreisungen sind wie eine Vorstufe zu dem, was kommt. Wie ein Schnupperkurs, den Jesus uns anbietet. Niemand muss ihn belegen. Es gibt keinen Zwang. Jesus lädt uns ein, daran teilzunehmen. Man muss auch nicht alle Fächer belegen, um selig zu sein, Armut, Trauer, Sanftmut, Barmherzigkeit, Frieden. Schon gar nicht muss man alles bestehen, denn niemand könnte das. Jesus ist keiner, der uns prüft.
Mit den Seligpreisungen weist Jesus einen Weg, der zu Gott führt. Das Ziel heißt Himmelreich, Trost, Gerechtigkeit, Erbarmen, Gotteskindschaft. Jesus gibt uns die Seligpreisungen wie Landkarten an die Hand. Er begleitet uns, damit wir uns nicht verirren. Er hilft uns, wenn wir nicht weiterwissen. Er ist an unserer Seite, damit wir selig sein können. Und selig sind.
Selig sein ist etwas Gutes.
Gottes Habseligkeiten
Das Wort „selig“ ist beliebt. Darum kommt es in Redewendungen immer wieder vor. „Gott hab sie selig“, sagen manche Leute, wenn sie über Menschen sprechen, die nicht mehr leben. Es ist eine Bitte, oft inmitten eines beliebigen Gesprächs. Man hört das oft in Bayern. In der Regel sind es Ältere, die so reden. Meist sagen sie es bei Angehörigen. Sie benutzen den Ausdruck keineswegs nur, wenn es um Trauriges geht. Genauso oft kommt er in heiteren Geschichten vor: „Mein Mann, Gott hab ihn selig, liebte es, beim Schafkopfen zu schummeln.“ – „Meine Schwester, Gott hab sie selig, hat immer die Weihnachtsplätzchen stibitzt.“
Es ist, als wollten sie Gott um Erlaubnis bitten, etwas über jene zu sagen, die bei ihm sind. Als wollten sie sich vergewissern, dass ihre Lieben bei Gott gut aufgehoben sind. Denn das besagt der kleine Satz: Gott vergisst sie nicht. Sie sollen Gottes Habseligkeiten sein, ganz wörtlich. Gott soll sie haben, damit sie selig sind. Gott soll sie mögen.
Ich mag den Zusatz. Ich sage ihn selten, aber ich denke ihn oft. Ich mag ihn, weil er mit Gott verbindet, was zu Gott gehört. Beiläufig, diskret. Niemand muss verstehen, warum ich so denke. Niemand muss mitbekommen, wer oder was mir am Herzen liegt. Niemand muss merken, dass ich auch mich mit einbeziehe. Niemand muss begreifen, wie ernst es mir ist, wenn ich dann doch einmal sage: „Andreas, mein Bruder, Gott hab ihn selig, …“ – „Mein Bruder Fritz, Gott hab ihn selig, …“ Das geht nur Gott etwas an.
Manchmal füge ich auch ein kleines Komma ein, dann wird es eine Bitte:
Gott, hab meine Brüder selig.
Gott, hab auch mich selig.
Bei dir finde ich Frieden.
Denn ich gehöre zu dir.
Gott, ich bitte dich:
Hab uns selig,
mich und meine beiden.
Denn wir gehören dir.
Wir sind deine Habseligkeiten.
Wer’s glaubt, wird selig
Dann gibt es eine Redewendung, die alle kennen: „Wer’s glaubt, wird selig.“ Ich mag den Satz, weil er so herrlich doppeldeutig ist. Viele verwenden ihn ironisch. Manchmal unfreundlich sarkastisch. Oder liebevoll spöttisch. Man sagt es, wenn etwas völlig unglaubhaft klingt. Zum Beispiel: „Ich habe heute früh einen Geist im Nymphenburger Park gesehen.“ – „Wer’s glaubt, wird selig.“ Gemeint ist: „Das glaubst du doch selbst nicht.“ Oder: „Gestern hat mir jemand hundert Euro versprochen, wenn ich fünf Liegestütze mache.“ – „Wer’s glaubt, wird selig.“ Anders gesagt: „Nie im Leben.“
Wenige wissen, dass der Spruch von Jesus stammt. Nachdem der Auferstandene Maria aus Magdala erschienen war, ging sie zu den Jüngern und berichtet ihnen davon. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Später erschien Jesus zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Erst erkannten sie ihn nicht, aber dann. Sie gingen zu den anderen und berichteten ihnen. Und auch ihnen glaubte man nicht.