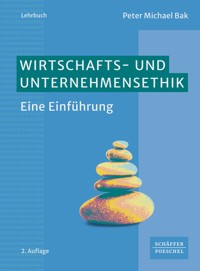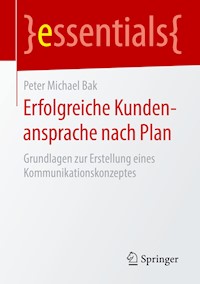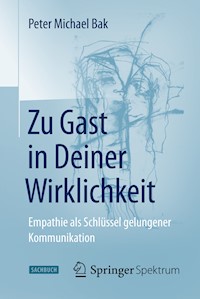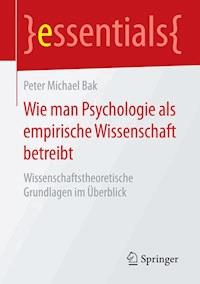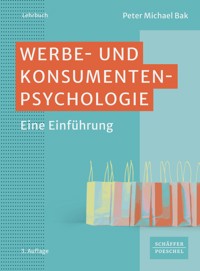
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Autor stellt die Grundlagen von Werbung und Psychologie im Überblick dar. Dabei beleuchtet er neben Werbezielen, unterschiedlichen Werbeformen und -strategien auch psychologische Konzepte wie Prozesse der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, des Lernens, der Motivation, der Emotion, soziale Prozesse und die menschliche Persönlichkeit. Die Betrachtung wichtiger werblicher Gestaltungsmittel, das Thema Marke, die Beschreibung der Planung und Umsetzung von Werbemaßnahmen, Besonderheiten des Interkulturellen Marketings und Werbeethik runden das Buch ab. Für die dritte Auflage wurden an zahlreichen Stellen Angaben aktualisiert oder ergänzt. Grundlegend wurde an Inhalt und Aufbau wenig verändert. Auch wenn sich die Werbeformen und die digitalen Möglichkeiten permanent weiterentwickeln, bedeutet das nicht, dass sich die grundlegenden Mechanismen der Werbung ändern müssen. Neu erfinden braucht man das Rad der Werbung daher auch im digitalen Zeitalter nicht. Das Unterkapitel Werbeziele wurde dennoch komplett überarbeitet. Das Kapitel 2 "Fokus Medien", in dem auf die Besonderheiten von TV-, Radio- und Printwerbung sowie der Digitalen Werbung eingegangen wird, wurde neu aufgenommen. Ansonsten wurden zahlreiche Zahlenangaben und einige Details aktualisiert
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumVorwort zur dritten Auflage1 Fokus Werbung1.1 Daten und Fakten zur Werbung1.2 Werbung als Teil des Marketings1.3 Adressaten von Werbung1.4 Gängige Werberezepte1.5 Grund- und Zusatznutzen1.6 Werbeklassifikationen1.6.1 Konsumgüterwerbung1.6.2 Investitionsgüterwerbung1.6.3 Dienstleistungsmarketing1.6.4 Non-Profit-Werbung bzw. Social Marketing1.7 Werbung als Kommunikation1.8 Werbeziele1.8.1 Senderorientierte Werbeziele1.8.2 Empfängerorientierte Werbeziele1.8.3 Marktorientierte Werbeziele1.8.4 Psychologische Werbeziele1.9 Häufige Werbeformen1.10 Ausblick2 Fokus Medien2.1 Printwerbung2.1.1 Besonderheiten der Printwerbung2.2 Radiowerbung2.2.1 Besonderheiten der Radiowerbung2.3 Fernsehwerbung2.3.1 TV-Werbetypen im Überblick2.3.2 Besonderheiten der Fernsehwerbung2.4 Digitale Werbung 2.4.1 Besonderheiten der digitalen Werbung2.5 Ausblick3 Fokus Konsument3.1 Wahrnehmung3.1.1 Die fünf Sinnesorgane3.1.2 Informationsverarbeitung3.1.3 Aufmerksamkeit3.1.3.1 Automatische und kontrollierte Prozesse3.1.3.2 Aufmerksamkeitstheorien3.1.3.3 Aufmerksamkeit im Alter3.1.4 Subliminale Informationsverarbeitung3.1.5 Ausblick3.2 Gedächtnis3.2.1 Gedächtnisstrukturen und -prozesse3.2.2 Assoziative Netze3.2.3 Priming3.2.4 Embodiment3.2.5 Kognitive Schemata3.2.6 Ausblick3.3 Lernen3.3.1 Klassische Konditionierung3.3.2 Evaluative Konditionierung3.3.3 Operante Konditionierung3.3.4 Modelllernen und Sozialisation3.3.5 Ausblick3.4 Motivation3.4.1 Triebtheorien der Motivation3.4.2 Feldtheorie3.4.3 Intrinsische und extrinsische Motivation3.4.4 Grundmotive menschlichen Verhaltens3.4.4.1 Die Bedürfnispyramide von Maslow3.4.4.2 Drei Hauptmotive: Macht, Leistung, sozialer Anschluss3.4.5 Erwartungswert-Modelle3.4.6 Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen3.4.7 Ausblick3.5 Emotionen3.5.1 Begriffserklärungen3.5.2 Kognitive Emotionstheorien3.5.3 Emotionen als Informationen3.5.4 Emotionen und Informationsverarbeitung3.5.5 Ausblick3.6 Nonverbale Kommunikation und Verhalten3.6.1 Blickverhalten3.6.2 Mimik3.6.3 Gestik3.6.4 Distanzverhalten (Proxemik)3.6.5 Berührung3.6.6 Ausblick3.7 Einstellungen3.7.1 Explizite und implizite Einstellungen3.7.2 Einstellung und Verhalten3.7.3 Zwei-Wege-Modell der Einstellungsänderung3.7.4 Persuasive Kommunikation3.7.4.1 Kommunikative Beeinflussungstechniken3.7.4.2 Indirekte Kommunikation3.7.4.3 Direkte Kommunikation3.7.5 Ausblick3.8 Entscheidungsverhalten3.8.1 Entscheidungsarten3.8.2 Wann Kaufen wirklich glücklich macht3.8.3 Intuitive und deliberative Entscheidungen3.8.3.1 Entscheidungsheuristiken3.8.3.2 Weitere Faktoren der Entscheidungsbeeinflussung3.8.3.3 Theorie des unbewussten Denkens3.8.4 Nachentscheidungskonflikte und kognitive Dissonanz3.8.5 Prospect Theory und Verhaltensökonomik3.8.6 Nudging (»Anstupsen«)3.8.7 Ausblick3.9 Persönlichkeit3.9.1 Die »Big Five« der menschlichen Persönlichkeit3.9.1.1 Offenheit für neue Erfahrungen3.9.1.2 Gewissenhaftigkeit3.9.1.3 Extraversion3.9.1.4 Verträglichkeit3.9.1.5 Neurotizismus3.9.2 »Big Five« im werblichen Kontext3.9.3 Weitere Persönlichkeitsmerkmale3.9.3.1 Kognitionsbedürfnis3.9.3.2 Bedürfnis nach Einzigartigkeit3.9.3.3 Selbstüberwachung (self-monitoring)3.9.3.4 Materialismus3.9.4 Ausblick3.10 Sozialer Kontext3.10.1 Symbolischer Interaktionismus3.10.2 Symbolische Selbstergänzung3.10.3 Soziale Kategorisierung3.10.4 Soziale Vergleiche3.10.4.1 Das Inklusions-Exklusions-Modell3.10.4.2 Modell der selektiven Zugänglichkeit3.10.5 Ausblick4 Fokus Werbegestaltung4.1 Farben4.2 Bilder4.3 Humor4.3.1 Herabsetzung und Überlegenheitsgefühl4.3.2 Inkongruitäts-Auflösungsmodell4.3.3 Humor in der Werbung4.4 Attraktivität4.4.1 Evolutionsbiologische Perspektive4.4.2 Attraktivität in der Werbung4.4.3 Erotik und Sex in der Werbung4.5 Furcht4.6 Musik4.7 Ausblick5 Fokus Marke5.1 Was ist eine Marke?5.1.1 Markenimage5.1.2 Markenidentität5.1.3 Markenfunktionen5.2 Verschiedene Markentypen5.3 Spezialfall: Arbeitgebermarke5.4 Verschiedene Markenkonzepte5.4.1 Marke als assoziatives Netzwerk5.4.2 Marke als Schema5.4.3 Marke als Einstellungsobjekt5.4.4 Marke als Persönlichkeit5.4.5 Marke als Konstruktion5.5 Schritte zur Markenentwicklung5.5.1 Analyse der Ausgangslage5.5.2 Festlegung der Markenidentität5.6 Ausblick6 Fokus Interkulturelles Marketing6.1 Was ist Kultur?6.1.1 Percepta6.1.2 Concepta6.1.3 Kulturtheorien6.1.4 Kulturdimensionen nach Edward T. Hall6.1.5 Kulturdimensionen nach Geert Hofstede6.1.6 Kulturdimensionen nach Alfons Trompenaars6.2 Kulturelle Unterschiede im Marketingkontext6.2.1 Kultur und Preispolitik6.2.2 Kultur und Produktpolitik6.2.3 Kultur und Distributionspolitik6.2.4 Kultur und Kommunikationspolitik6.3 Strategien für Marketing und Werbung6.3.1 Standardisierung6.3.2 Differenzierung6.4 Spezialfall I: Country-of-Origin-Effekt6.5 Spezialfall II: Ethnomarketing6.6 Ausblick7 Fokus Planung und Umsetzung7.1 Definition von Marketing- und Kommunikationsziel7.2 Definition der Zielgruppe7.2.1 Segmentierungskriterien7.2.2 Sinus-Milieus7.2.3 Eins-zu-eins-Marketing und Kundenbeziehungs- management7.2.4 Viele Möglichkeiten durch das Internet7.3 Festlegung der Copy-Strategie7.4 Mediaplanung7.5 Kontrolle der Werbewirkung7.5.1 Dimensionen der Werbewirkung7.5.2 Methoden der Werbewirkungsmessung7.5.2.1 Quantitative Verfahren7.5.2.2 Qualitative Verfahren7.5.2.3 Problem der Reaktivität und Implizite Verfahren7.5.2.4 Neuromarketing7.6 Ausblick8 Abschließendes zum Thema WerbeethikLiteraturDer AutorIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Version Ihres Buches zugreifen zu können
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5855-9
Bestell-Nr. 20014-0003
ePub:
ISBN 978-3-7910-5856-6
Bestell-Nr. 20014-0101
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5857-3
Bestell-Nr. 20014-0152
Peter Michael Bak
Werbe- und Konsumentenpsychologie
3. Auflage, Januar 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Bildnachweis (Cover): Say-Cheese, iStock
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Katharina Harsdorf
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort zur dritten Auflage
Werbung ist ein Versprechen. Ein Versprechen auf ein mindestens angenehmes Erlebnis. Die Psychologie wiederum gilt als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Kein Wunder also, dass sich die Psychologie für die Werbung interessiert und umgekehrt, wenn auch nicht immer aus gleichen Gründen. Die Werbebranche möchte psychologisches Wissen nutzen, um die Werbung noch verführerischer zu machen. Die Psychologie ist zunächst nur eine Wissenschaft, die sich in diesem Kontext mit der Frage beschäftigt, wann Werbung aus welchen Gründen und auf welche Art und Weise unser Erleben und Verhalten beeinflusst. Das Interesse an der Werbung ist dabei alles andere als neu. Schon in den 1920er Jahren entstanden Bücher wie »Psychologie der Reklame« von Christoph von Hartungen (von Hartungen, C. 1926).
Als eigenständiges Fach ist die »Werbepsychologie« dagegen noch gar nicht so alt, hat sich aber mittlerweile als akademische Disziplin durchgesetzt. Das Angebot an wirtschaftspsychologischen Studiengängen mit Schwerpunkten u. a. in Werbe- und Konsumentenpsychologie hat sich seit dem Erscheinen der Erstauflage dieses Buches in kurzer Zeit vervielfacht. Dem großen Bedarf an zuverlässiger, überblicksartiger, interdisziplinärer Information zur Werbe- und Konsumentenpsychologie möchte auch das vorliegende Buch in seiner dritten Auflage erneut gerecht werden. Am Aufbau des Lehrbuchs hat sich wenig geändert. Zunächst rücken die Werbung, die Werbeziele, unterschiedliche Werbeformen und -strategien in den Mittelpunkt der Betrachtungen (Fokus Werbung). Danach folgt das neu hinzugefügte Kapitel »Fokus Medien«, in dem auf die Besonderheiten von TV-, Radio- und Printwerbung sowie der digitalen Werbung eingegangen wird. Anschließend werden der Konsument sowie für das Verständnis von Werbewirkungen grundlegende psychologische Konzepte eingehend beleuchtet: angefangen von Prozessen der Wahrnehmung und des Gedächtnisses, über Arten und Weisen des Lernens bis hin zu Motivation, Emotion und spezifischen sozialen Bedingungen und Prozessen, die ja stets den Hintergrund individuellen Verhaltens darstellen (Fokus Konsument). Danach werden wichtige werbliche Gestaltungsmittel wie Humor, Attraktivität oder Musik betrachtet (Fokus Werbegestaltung), bevor die Marke in den Mittelpunkt der Betrachtungen rückt (Fokus Marke). Es folgt ein Blick auf die Besonderheiten des Interkulturellen Marketings (Fokus Interkulturelles Marketing), ein Thema, das angesichts des globalen Wettbewerbs und der immer stärker werdenden internationalen Vernetzung in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Schließlich wird es im »Fokus Planung und Umsetzung« darum gehen, die grundlegenden operativ-werblichen Schritte zu beschreiben. Am Ende stehen ethische Reflexionen, die in dem vorliegenden Zusammenhang unentbehrlich sind. Denn Ziel der Werbepsychologie sollte es nicht sein, sich als Dienstleister zu verstehen, dessen Forschungsbemühungen darauf abzielen, Menschen oder Kunden zu Verhaltensweisen zu bewegen, die weder von diesen gewünscht, noch legitimiert, noch aus psychologischer Sicht gesund oder für ein gelingendes Leben hilfreich sind. Die Kenntnis werblicher Prozesse ist daher nicht nur bedeutsam zur Verbesserung werblicher Kommunikation, sondern ebenso fundamental zum Schutz gegenüber unerwünschten Effekten und Wirkungsweisen.
Für die dritte Auflage wurden an zahlreichen Stellen Angaben aktualisiert oder ergänzt. Die bewährte Struktur des Buches wurde beibehalten. Auch wenn sich die Werbeformen und die digitalen Möglichkeiten permanent weiterentwickeln, bedeutet das nicht, dass sich die grundlegenden Mechanismen der Werbung ändern müssen. Neu zu erfinden braucht man das Rad der Werbung daher auch im digitalen Zeitalter nicht. Das Unterkapitel 1.8 »Werbeziele« wurde dennoch komplett überarbeitet. Das Kapitel 2 »Fokus Medien« wurde neu aufgenommen. Ansonsten wurden zahlreiche Zahlenangaben und einige Details aktualisiert.
Bei der Fülle des möglichen Stoffes versteht es sich, dass viele Themen nur knapp behandelt werden und manche Themen gar nicht den Weg in das Buch gefunden haben. Dennoch hoffe ich, dass sich Studierende genauso wie Praktiker nach der Lektüre mit Freude an der psychologischen Auseinandersetzung mit (nicht nur) werbepsychologischen Themen beteiligen und sich mit Neugierde zu einer vertiefenden Auseinandersetzung entscheiden werden. Meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich, dass sie das Buch brauchbar im Unterricht einsetzen können. Und allen Leserinnen und Lesern, dass sie einen guten, leicht verstehbaren und nachvollziehbaren Überblick über das Thema der Werbe- und Konsumentenpsychologie bekommen und das Wissen daraus in sinnvoller und nützlicher Weise anwenden werden.
Und noch ein Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch häufig das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Peter Michael Bak, Saarbrücken, November 2023
1 Fokus Werbung
Werbung ist allgegenwärtig.
Die Geschichte der Werbung beginnt in dem Moment, in dem Menschen angefangen haben, mit Waren zu handeln. Schon in der Antike, bei den Ägyptern, Griechen und Römern, hat es Werbung gegeben. Auf Märkten warben die Händler um ihre Kundschaft. Es gab bereits Marken und Markenzeichen. So findet man etwa in Tongefäßen und anderen Artikeln Zeichen, die auf den ausführenden Handwerker verweisen. Je mehr Anbieter und Waren auf den Markt kamen, umso mehr Werbung war nötig, um auf sich aufmerksam zu machen und sich von den anderen Anbietern zu unterscheiden. Waren und Güter mussten jetzt nicht mehr nur den existenziellen Grundbedarf abdecken, sondern wurden zunehmend auch z. B. zu Luxusgütern. Spiele und Kosmetik entwickelten sich zu wichtigen Statussymbolen.
MERKE
Die Werbung und insbesondere die Werbeindustrie, so wie wir sie heute kennen, entwickelte sich parallel zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Durch die enorme Zunahme an Produktionsmöglichkeiten und -kapazitäten im 19. Jahrhundert musste zum einen für den entsprechenden Absatz gesorgt werden. Zum anderen vermehrte sich durch den wachsenden ökonomischen Wohlstand die Geldmenge der Käufer. Man konnte sich mehr und häufiger etwas leisten. Verlockende Aussichten für Händler und Produzenten, die nun mit immer neuen Produkten und Dienstleistungen auf den Markt drängten. Der Boden für die Konsumgesellschaft war bereitet. Heute ist Werbung ein allgegenwärtiger Bestandteil unseres Alltagslebens. Nach Angaben von Nielsen Media Research wurden im Jahr 2020 6,82 (2016 waren es »nur« 4,36) Millionen Werbespots im deutschen Fernsehen gezeigt (de.statista.com). Werbung ist in allen Medien zu Hause: Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften, Plakatwände, Videowalls, Kino, Internet oder Smartphones. Es gibt kaum einen Ort oder einen Zeitpunkt, an dem wir nicht mit Werbebotschaften konfrontiert werden. Sogar auf dem Bahnsteig, auf dem Boden, in Schulen oder Kindergärten, wir kommen an Werbung nicht vorbei. Aber was ist Werbung eigentlich? Wie lässt sich Werbung definieren? Welche Ziele sind damit verbunden? Welche Werbeformen und Werberezepte gibt es? Fragen, auf die wir im Folgenden Antworten geben wollen. Beginnen wir zunächst mit einem Blick auf einige Daten und Fakten.
1.1 Daten und Fakten zur Werbung
Die Werbeindustrie, also alle Unternehmen, die sich mit der Produktion und dem Verkauf von WerbungWerbung, Bruttoinvestitionen beschäftigen, ist ein mächtiger Zweig der Volkswirtschaft. Die Investitionen in Werbung sind in Deutschland seit Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Vergleich zu 2006 haben sich nach Nielsen Media Research die Ausgaben im Jahr 2016 um 10 Milliarden Euro erhöht (vgl. Tab. 1).
18,45
19,14
24,98
29,45
35,60
36,71
Tab. 1: Entwicklung der Bruttoinvestitionen in Werbung in Deutschland (Angaben in Milliarden Euro)
Nielsen Media Research,
de.statista.com
Die wichtigsten WerbeträgerWerbeträger, gemessen an den Werbeeinnahmen, waren im Jahr 2021 die Internetsuche, Internetwerbung, lineares Fernsehen und die postalische Direktwerbung. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren zeigen sich erneut dramatische Veränderungen bei einzelnen Werbeträgern. Das Internet hat das Fernsehen als wichtigsten Werbeträger abgelöst, gedruckte Tageszeitungen und Publikumszeitschriften werden immer unwichtiger (vgl. Tab. 2)Werbung, BruttoinvestitionenNetto Werbeeinnahmen.
Werbeträger
2016
2021
%
Internetsuche
k. A.
5,17
Internet – Display Ads
1,52
5,17
+240,13
Fernsehen
4,56
4,34
–4,82
Tageszeitungen (Print)
2,53
1,82
–28,06
Anzeigenblätter (Print)
1,92
1,20
–37,50
Außenwerbung
1,03
1,07
+3,88
Fachzeitschriften
0,86
1,35
+56,98
Publikumszeitschriften
1,02
0,71
–30,39
Hörfunk
0,77
0,71
–7,79
Tab. 2: Netto-Werbeeinnahmen erfasster Werbeträger in Deutschland (Angaben in Milliarden Euro)
Quelle: ZAW,
de.statista.com
Das Internet ist bedeutendster Werbeträger.
Auch die MediennutzungMediennutzung über alle Medien steigt seit Jahren beständig an (vgl. Tab. 3). Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche tägliche Mediennutzung allein für TV, Radio und Internet der Menschen über 14 Jahren in Deutschland bei mehr als 10 Stunden (616 Minuten). Es gibt diesbezüglich zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den Nutzergruppen. Beispielsweise wird das Internet vor allem von den jüngeren Personen genutzt (www.ard-zdf-onlinestudie.de). Die intensive Mediennutzung führt auch dazu, dass die Anzahl der Werbebotschaften, die wir täglich erhalten, mittlerweile mehrere Tausend umfasst.
2015
2019
2022
TV
244
236
213
Radio
106
100
91
Internet (inhaltlich*)
50
58
83
Gesamt
546
560
616
Tab. 3: Durchschnittliche tägliche Mediennutzung von Erwachsenen ab 14 Jahren (Angaben in Minuten pro Tag). *Inhaltliches Internet meint Nutzung sozialer Netzwerke, Artikel lesen, Blogs/Foren nutzen, E-Learning oder Onlinebanking.
Quelle: Seven.One Media, www.seven.one
Das Verhältnis zur Werbung ist ambivalent. Beispielsweise fühlen sich nach einer repräsentativen Umfrage (Global Consumer Survey 2022; de.statista.com) 43 % der 18- bis 64-jährigen Deutschen von der Internetwerbung genervt. Allerdings haben beinahe ebenso viele Personen kein Problem mit der Werbung, wenn sie dafür kostenlos Inhalte bekommenWerbung, Verhältnis zur.
Einstellung zur Werbung ist ambivalent.
Es ist ein Teufelskreis: Je mehr Werbung existiert, umso mehr muss man Werbung machen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Mit nicht nur positiven Auswirkungen auf die Werbeakzeptanz. Es werden überall neue Wege und Mittel gesucht, um (potenzielle) Kunden in verschiedenen Kontexten werblich anzugehen, ob am Bahnsteig, im Flugzeug, in den Medien, beim Sportverein oder auf dem Smartphone. Ein immenser Aufwand, bedenkt man, wie kurz wir diesen Bemühungen unsere Aufmerksamkeit schenken: einer Printanzeige etwa nur zwischen 2 und 3 Sekunden (Sjurts, I. 2010), einer Außenwerbung noch weniger. Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Werbeindustrie ständig nach neuen und auch subtileren Methoden der Werbung Ausschau hält.
1.2 Werbung als Teil des Marketings
Gesamte Wertschöpfungskette ist als System zu verstehen.
Gewöhnlich werden im Unternehmen folgende WertschöpfungsprozesseWertschöpfungsprozesse, im Unternehmen unterschieden: Eingangslogistik, Produktion, Ausgangslogistik, Marketing, Vertrieb und Kundenservice (Porter, M. E. 1989). Der Marketingprozess selbst lässt sich nochmals ausdifferenzieren nach den vier Bereichen Preis-, Produkt-, Kommunikations- sowie Distributionspolitik (vgl. Abb. 1). Die Werbung wird gewöhnlich im Bereich der Kommunikation angesiedelt.
Diese kategorische Differenzierung dient in erster Linie der Veranschaulichung, ist jedoch in der Praxis selten so in Reinform anzutreffen, da sie in vielen Fällen wenig Sinn macht. So kann man die Preispolitik, die Distributions- und Produktpolitik nicht isoliert von der werblichen Kommunikation betrachten. Umgekehrt kann Werbung auch die Produkt-, Distributions- und Preispolitik beeinflussen. Letztlich müssen die vier Bereiche des Marketings und darüber hinaus die gesamte Wertschöpfungskette als System verstanden werden, bei dem die einzelnen Prozesse ineinandergreifen und -wirken. Dies wird auch an neueren Managementstrategien, wie etwa dem Corporate Branding, deutlich, bei dem das Unternehmen als Ganzes im Sinne des Markenaufbaus bzw. der Markenführung geführt wird.
Abb. 1:
Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen
1.3 Adressaten von Werbung
Ansprache aller Stakeholder
WerbungWerbung, Adressaten als eine besondere Form der Unternehmenskommunikation besitzt viele Adressaten. Kunden, potenzielle Kunden, die Öffentlichkeit oder auch bestehendes und neues Personal. Letztere werden etwa mit Maßnahmen im Rahmen der Schaffung einer Unternehmensmarke (Employer Branding; vgl. Kap. 5.3Employer Branding) angesprochen. Werbung richtet sich aber auch an das Management, die Öffentlichkeit (Imagewerbung) oder an Lieferanten, Investoren oder mediale Mittler und die Presse.
MERKE
Werbliche Maßnahmen
Allgemein formuliert richten sich werbliche Maßnahmen an alle möglichen Interessengruppen am Unternehmen (interne und externe StakeholderStakeholder), denn alle sollen vom Unternehmen, seinen Leistungen, Produkten, Mitarbeitern positiv überzeugt werden, damit sie in ihrer Funktion zum Erfolg des Unternehmens beitragen bzw. diesen nicht verhindern.
Für jede Interessengruppe lassen sich dabei eigene Ziele definieren: Die Kunden sollen dann von einem Produkt überzeugt werden, die Mitarbeiter sollen stolz auf ihr Unternehmen sein, die Wettbewerber sollen von der Leistungsfähigkeit beeindruckt werden, die Lieferanten sollen die Stärke des Verhandlungspartners erkennen und die Öffentlichkeit soll dem Unternehmen mit Wohlwollen gegenüberstehen. Schauen wir uns die Werbeziele für Konsumenten und ganz allgemein den Markt noch etwas genauer an.
1.4 Gängige Werberezepte
Orientierungen für die Werbekonzeption
Für Werber und Marketingverantwortliche stellt sich die Frage, wie man Werbung generell anzulegen hat. Was will man wie erreichen? Wie sollen die Werbeziele konkret umgesetzt werden? Es haben sich verschiedene, ganz allgemeine Vorstellungen als gut vermittelbar herausgestellt. Sie dienen als grobe Orientierungen für die Planung und Konzeption von WerbemaßnahmenWerbemaßnahmen, Konzeption.
Die AIDA-Formel
Die bekannteste Werbeformel ist das sogenannte AIDAAIDA-Formel-Konzept. Danach soll die Werbung zunächst Aufmerksamkeit (Attention) erzeugen, anschließend, wenn der Rezipient die Botschaft verstanden hat, Interesse am Produkt wecken (Interest). Dieses Interesse soll im nächsten Schritt den Wunsch erzeugen, das Produkt zu erwerben (Desire), was dann letztlich zum Handeln (Action), hier also Kaufen führen soll.
Die PPPP-Formel
Eine weitere Faustformel zur Gestaltung von Werbung ist die PPPP-FormelPPPP-Formel. Danach gilt es, die Aufmerksamkeit des Rezipienten mit Hilfe eines Bildes (Picture) zu gewinnen. Konkrete oder auch metaphorische Bilder eignen sich besonders gut, weil wir auf diesem Weg viele Informationen in kürzester Zeit verarbeiten können. In der Werbung selbst wird dann ein Versprechen abgegeben (Promise) und ein entsprechender Beweis geliefert (Prove), warum der Absender oder das Produkt dieses Versprechen auch einhalten kann. Zudem wird der Rezipient entsprechend aufgefordert, sich selbst von dem Produkt zu überzeugen (Push).
USP/UAP
Unter USP (Unique Selling Proposition)Unique Selling Proposition (USP)versteht man den einzigartigen Produktvorteil, der werblich betont wird, z. B. die Zusatzinformation »mit Hyaluronsäure«. In den meisten Fällen handelt es sich aber weniger um ein tatsächlich einzigartiges Produktmerkmal, sondern vielmehr um die kommunikative Betonung eines bestimmten Merkmals (UAP, Unique Advertising PropositionUnique Advertising Proposition (UAP)), wodurch das Produkt unverwechselbar gemacht werden soll und das im besten Fall von den Wettbewerbern bisher nicht fokussiert wurde. So wirbt die Automarke BMW beispielsweise mit dem Slogan »Freude am Fahren«. Natürlich bedeutet dies nicht, dass es in anderen Fahrzeugen weniger Spaß macht, nur werden von den anderen Herstellern eben andere Eigenschaften kommuniziert. Audi wirbt mit der Aussage »Vorsprung durch Technik«, hat sich also für die Betonung einer anderen Kernkompetenz entschlossen. So kann man sich durch Kommunikation differenzieren, selbst wenn es faktisch kaum Differenzierungsgründe zwischen den Wettbewerbern gibt.
1.5 Grund- und Zusatznutzen
Wir verwenden und kaufen Produkte zunächst zu einem bestimmten Zweck. Wenn wir uns frei und selbstständig von einem Ort zum anderen bewegen möchten, so benutzen wir vielleicht ein Fahrrad, bei größeren Entfernungen dagegen ein Auto. Zahnpasta benutzen wir, um unsere Zähne zu reinigen, und eine Tagescreme, um unsere trockene Haut geschmeidig zu machen.
MERKE
Grundnutzen
Produkte haben einen instrumentellen NutzenNutzen, wir benutzen sie, um ein konkretes Ziel zu erreichen.
Die meisten ProduktProdukt, Zusatznutzene haben über diesen unmittelbaren Zweck hinaus jedoch noch einen anderen Nutzen für uns. So verwenden wir nicht irgendein Auto, nicht irgendeine Zahnpasta und nicht irgendeine Tagescreme, sondern wir fahren ein Auto, in das wir uns gerne setzen und das auch zu unserem Charakter passt, wir benutzen eine Zahnpasta mit extra viel natürlichen Kräutern, die bestimmt gesund sind, und eine Creme mit Olivenöl aus der Toskana, weil das sicher etwas Besonderes ist. Es geht uns also nicht nur um feuchte Haut oder saubere Zähne, sondern auch um guten Geschmack, Gesundheit oder einfach nur um die schöne Assoziation, die wir mit dem Produkt verbinden.
MERKE
Zusatznutzen
Die Produkte erfüllen neben dem GrundnutzenGrundnutzen noch weitere Zwecke, haben für uns noch einen weiteren Nutzen. Gerade wenn Güter zunehmend austauschbar sind, ist dieser ZusatznutzenZusatznutzen entscheidend für die Produktwahl.
Bei austauschbaren Produkten entscheidet der Zusatznutzen.
Der Zusatznutzen lädt das Produkt mit einer bestimmten Bedeutung. Das kann einmal eine besondere Verwendungsform sein (»Die neue Thomapyrin ist jetzt auch zum Kauen da«), eine besondere Produkteigenschaft Produkteigenschaft(»Bei Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen: Mobilat: Mit der 3-Wirkstoff-Formel«) oder eine andere Eigenschaft, die das Produkt für uns in bestimmten Situationen als besonders geeignet darstellt, z. B. weil wir damit unseren Status kommunizieren können oder unsere Individualität zeigen. Es spielt darüber hinaus nicht unbedingt eine Rolle, ob der Zusatznutzen tatsächlich einen Vorteil für den Kunden liefert oder nicht. Es reicht schon, wenn der Käufer den Eindruck erhält, mehr als bei einem vergleichbaren Produkt zu bekommen, um die Kaufentscheidung zu beeinflussen (Gierl, H./Großmann, T. 2008). Müssen wir uns zum Beispiel zwischen einem normalen Bodenreiniger und einem Bodenreiniger, der zudem mit Aloe-Vera-Extrakt besonders sanft zu unseren Händen ist, wählen, dann würden wir uns womöglich für Letzteren entscheiden, selbst wenn wir beim Putzen stets Handschuhe tragen und gar keinen Kontakt mit dem Bodenreiniger haben. Allein der Gedanke, dass im Falle des Falles meine Hände auch noch gepflegt werden oder dass es sich offenbar um ein qualitativ hochwertigeres Produkt handeln muss, überzeugt uns. Denn immerhin ist auch noch Aloe Vera enthalten, ein Rohstoff, den man sonst nur aus der Pflegekosmetik kennt!
Irreführende WerbungWerbung, irreführende
Dem aufmerksamen Betrachter wird auffallen, dass die Werbung voll solcher zusätzlicher Versprechen bzw. Hinweise ist, die häufig trivial oder selbstverständlich sind oder nicht viel Aussagekraft besitzen. So werden viele Waschmittel mit dem Zusatz »dermatologisch getestet« beworben, was viele Kunden mit der Bedeutung »dermatologisch verträglich« verwechseln. Verträglichkeit und Test sind aber völlig unabhängig, der Konsument erfährt ja nicht das Testergebnis, sondern wird de facto nur über den Umstand des Tests informiert. Darüber hinaus ist es nach dem »Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln« sogar vorgeschrieben, dass Wasch- und Reinigungsmittel »nur so in den Verkehr gebracht werden, dass infolge ihres Gebrauchs jede vermeidbare Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit […] unterbleibt« (www.gesetze-im-internet.de). Die Information gaukelt demnach einen Vorteil vor, der in Wirklichkeit gar nicht besteht. Dieser häufig anzutreffende Umstand ist immer wieder Anlass für Verbraucherorganisationen, Hersteller bzw. die Werbeindustrie öffentlich zu kritisieren.
BEISPIEL: Ist die »Monsterbacke« gesund?
Der Joghurthersteller Ehrmann hatte auf seinem Fruchtquark »Monsterbacke« mit dem Spruch »So wichtig wie das tägliche Glas Milch!« geworben. In einem Gutachten für den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg wurde gefordert, dass der Hersteller den Slogan ändert bzw. ergänzt. Die deutsche Wettbewerbszentrale hatte zuvor geklagt, da der Spruch einen Vorteil für die Gesundheit des Kunden verspreche und damit irreführend sei (vgl. Hirschbeck, A. 2013).
1.6 Werbeklassifikationen
Werbung Werbeklassifikationen wird für alles gemacht: für Toilettenpapier, Schokolade, Terpentin, Motorenöl, Dübel oder eine Weißblechstanzmaschine. Daneben machen auch Institutionen, Vereine, Behörden, Ministerien und Universitäten Werbung, ebenso wie Klempner, Dachdecker oder Maler. Je nachdem, wer Werbung macht und an wen sich Werbung richtet, lassen sich typische Unterschiede hinsichtlich der beworbenen Güter, deren Distribution, der Entscheidungswege und der daran beteiligten Personen sowie des Werbeträgers ausmachen. Betrachten wir daher im Folgenden einige wichtige Unterschiede im Konsumgüter-, Investitionsgüter-, Dienstleistungs- und Non-Profit-Bereich.
1.6.1 Konsumgüterwerbung
MERKE
KonsumgüterwerbungKonsumgüterwerbung (B2C – Business to ConsumerB2C – Business to Consumer) bezeichnet Werbung für typische Alltagsdinge, etwa Zahnpasta, Waschmittel oder Marmelade.
In den meisten Fällen handelt es sich bei der Werbung um sogenannte Massenkommunikation Massenkommunikation im Rundfunk oder Printbereich. Die Produkte können überall, also im Einzelhandel oder in Discountern, erworben werden. Es besteht selten Beratungsbedarf aufseiten der Kunden, es sei denn, es handelt sich um komplizierte, risikohafte oder teure Produkte, bei denen mit einem höheren Involvement Involvement gerechnet werden kann. Entscheidungen zugunsten eines Produktes sind häufig impulsiv. Außerdem werden sie in der Regel vom Käufer selbst und ohne Absprache mit anderen getroffen. Wir beratschlagen uns beim Kauf einer Zahnpasta nicht mit unserem Partner, sondern greifen (gewohnheitsmäßig) geradewegs zu. Die Werbung für diese Konsumgüter richtet sich daher in erster Linie an Konsumenten, die das Produkt kennen und mögen sollen, aber auch an den Zwischenhandel, dem das Produkt Erfolg versprechende Absatzmöglichkeiten bietet und der dazu animiert werden soll, das Produkt in sein Portfolio aufzunehmen bzw. dort zu behalten.
1.6.2 Investitionsgüterwerbung
MERKE
Investitionsgüterwerbung
InvestitionsgüterwerbungInvestitionsgüterwerbung (B2B – Business to BusinessB2B – Business to Business) ist Werbung für Güter und Dienstleistungen, die selbst wiederum zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen benötigt werden.
Kunden sind hier also nicht die Endkunden, sondern Unternehmen bzw. Entscheider in Unternehmen. Typische Investitionsgüter sind Maschinen oder Büroausstattungen. Viele Investitionsgüter findet man daher auch im Fachhandel oder sie werden direkt vom Hersteller geliefert. Der persönliche Verkauf und Kundendienst haben dabei eine große Bedeutung, da es sich oft um erklärungsbedürftige oder sehr teure und mit einem Risiko versehene Produkte handelt bzw. um Produkte, die in bestehende Produktionsprozesse und -umgebungen integriert werden müssen. Dabei können Fragen auftauchen, die es zunächst zu klären gilt. Werbung für solche Produkte findet man überwiegend in Fachzeitschriften, von denen es allein in Deutschland im Jahr 2021 mehr als 5600 gab (Deutsche Fachpresse, de.statista.com). Aber auch Messen und der Direktvertrieb spielen eine sehr große Rolle, wenn es um Verkauf oder Informationen geht. Die Kaufentscheidungsprozesse dauern vergleichsweise lange, da die Anschaffung häufig mit hohen Kosten verbunden ist. Darüber hinaus werden oft auch länger gültige Verträge mit Lieferanten ausgehandelt. Außerdem kann es bei bestimmten Investitionsgütern notwendig sein, mehrere Fachabteilungen in die Kaufentscheidung zu involvieren.
Für die Werbetreibenden ist die Kenntnis der in die Kaufentscheidung involvierten Personen äußerst wichtig. Denn sie müssen die Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen an das Investitionsgut kennen und darauf eingehen. Daher werden häufig sogenannte Buying-Center-Analysen Buying-Center-Analysen durchgeführt, mit dem Ziel, den Entscheidungsprozess im Unternehmen kennenzulernen.
Buying Center (»Einkaufsgremium«)
MERKE
Buying Center
Mit dem Buying CenterBuying Center oder Buying Circle wird die Gruppe der Personen im Unternehmen bezeichnet, die an der Kaufentscheidung in ganz unterschiedlichen Rollen und mit völlig unterschiedlichen Interessen beteiligt sind oder darauf Einfluss nehmen.
Werbung muss unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen.
Man unterscheidet etwa den ProduktverwenderProduktverwender, der auf die Gebrauchstauglichkeit Wert legt, vom Einkäufer, der mehr auf die Kosten des Produktes schaut. Der Beeinflusser Beeinflusser wiederum kann ein Fachreferent oder Berater sein, der sich inhaltlich mit dem Produkt und seinen Konkurrenzprodukten auseinandergesetzt und vielleicht ein Gutachten erstellt hat. Der Entscheider ist dann meistens der Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, der mit seiner Prokura faktisch über den Kauf entscheidet. Daneben werden häufig noch die Gate-KeeperGate-Keeper genannt, also Personen, die den Informationsfluss zu und aus dem Buying Centersteuern, etwa Assistenten oder Referenten. Jeder Einzelne kann hier den Kaufprozess beschleunigen, verlangsamen, befördern oder verhindern. Um alle am Entscheidungsprozess beteiligten Personen von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen, müssen demnach die unterschiedlichen produktbezogenen Interessen sowie die spezifischen funktionsbezogenen Rezeptionsbedürfnisse und -gewohnheiten der Beteiligten berücksichtigt werden. Werbeaussagen wie »Einfach zu handhaben« sind möglicherweise für den Nutzer wichtiger als für den Geschäftsführer. Das Versprechen einer längeren Garantiezeit könnte dagegen den Einkäufer mehr interessieren. Die Analyse des Buying Centers ist auch von Bedeutung, wenn es um die Wahl der geeigneten Werbeträger geht. So ist etwa der Geschäftsführer vielleicht durch eine Management-Zeitschrift besser zu erreichen, der Produktionsleiter dagegen eher durch eine branchenspezifische Fachpublikation.
1.6.3 Dienstleistungsmarketing
MERKE
Bei Dienstleistungen Dienstleistungsmarketingstehen keine materiellen Waren im Mittelpunkt, sondern Personen und deren Leistungen.
Dienstleistungen sind häufig mit Risiken verbunden.
Die Dienstleistungen, die sich an Endkunden (z. B. Klempner, Finanzdienstleistungen) wie Unternehmen (z. B. Detektei, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen) richten, kann man im Gegensatz zu Produkten nicht im Vorhinein betrachten bzw. begutachten. Dies sorgt für Unsicherheit, die dazu führt, dass Kaufentscheidungen durchaus länger dauern bzw. im geschäftlichen Umfeld zunächst den Buying Circle Buying Circle durchlaufen. Das Marketing versucht, durch imagefördernde Kommunikation Vertrauen in den Anbieter aufzubauen und zu fördern, sodass die Kunden auch ohne Blick auf das fertige Resultat bereit sind, für die Dienstleistungen entsprechend zu zahlen. In der Werbung, die sowohl in Massenmedien wie auch in Special-Interest-Medien oder Fachzeitschriften geschaltet wird, finden sich daher häufig Begriffe wie »Sicherheit« oder »Vertrauen«, etwa bei dem Slogan der AXA-Versicherung: »Für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen«.
1.6.4 Non-Profit-Werbung bzw. Social Marketing
Im Social Marketing ist viel Zeit nötig.
Sogenannte Non-Profit-Organisationen (z. B. Rotes Kreuz, Greenpeace, UNICEF) haben keine wirtschaftlichen Gewinnziele. Ihnen geht es z. B. um karitative Hilfen, Umwelt- und Naturschutz, Gesundheit, Katastrophenhilfe oder den Einsatz für sozial Schwächere oder die internationale Einhaltung der Menschenrechte. Die Werbung dieser Non-Profit-Organisationen hat im Vergleich zu der von am Profit orientierten Unternehmen eine andere Zielsetzung, daher auch der Name Social MarketingSocial Marketing– nicht zu verwechseln mit Social Media Marketing.
MERKE
Häufig geht es in der Non-Profit-WerbungNon-Profit-Werbung. bzw. im Social Marketing darum, einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel herbeizuführen und gesellschaftlich relevante Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen zu beeinflussen.
Daneben wird mit entsprechenden Maßnahmen versucht, das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Mittels Fundraising versucht man, das Spendeneinkommen zu erhöhen. In der Werbung wird häufig versucht, durch entsprechende Appelle Spenden zu generieren oder die Rezipienten zu einer Verhaltensmodifikation zu bewegen. Gerade dies ist aber sehr schwierig und meistens kaum durch kurzfristige Werbekampagnen zu erreichen. Die Adressaten müssen gewissermaßen im Sinne der Werbeziele sozialisiert werden, ein Lernprozess, der Jahre dauern kann. Daher ist es wichtig, die Werbebotschaft möglichst selten zu wechseln, um die gewünschten Lernprozesse zu unterstützen.
1.7 Werbung als Kommunikation
MERKE
Werbung
Unter WerbungWerbung, als Kommunikation kann man generell alle kommunikativen Bemühungen eines Absenders beschreiben, die beim Empfänger ein bestimmtes Ziel erreichen sollen.
Dementsprechend muss erfolgreiche Werbung auf alle Aspekte der KommunikationKommunikation (vgl. Abb. 2)Kommunikationsprozess eingehen. Die Besonderheiten und Eigenschaften des Absenders gilt es dabei ebenso zu berücksichtigen wie die Frage, welche Botschaft von der Zielgruppe (Empfänger) wie am besten (zielgerecht) verarbeitet und verstanden werden kann. Dazu gehört auch die Auswahl des optimalen Werbeträgers, da es zwischen Absender, Empfänger, Botschaft und Werbeträger zu komplexen Wechselwirkungen kommen kann. Ein Hersteller von Luxusgütern wird sich entsprechende Werbeträger für die Vermittlung seiner Botschaft aussuchen und nicht in jedem Allerweltsblatt Werbung schalten, was unmittelbar imageschädigende Wirkung haben könnte. Gleichzeitig besitzen die Kunden auch ganz bestimmte Erwartungen an den Hersteller, etwa was die Ansprache und die verwendeten Werbemittel betrifft. Alle diese Feinheiten und sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren gilt es schließlich zu beachten. Dazu sind auch das eingehende Wissen über Prozesse innerhalb des Empfängers (das wird Gegenstand des Kapitels Fokus Konsument sein) und Besonderheiten der Mediaplanung (darüber wird in Kapitel Fokus Planung und Umsetzung gesprochen) wichtig. Grundlegend können wir zur Unterscheidung verschiedener Werbeformen zwischen Massenkommunikation und Individualkommunikation unterscheiden.
Abb. 2:
Der Kommunikationsprozess
Massenkommunikation
MERKE
Massenkommunikation
Kennzeichen der MassenkommunikationMassenkommunikation, wie wir sie etwa in der Rundfunkwerbung, Printwerbung in Zeitungen und Zeitschriften oder bei den Public Relations (PR) finden, ist die einseitige, indirekte, technisch vermittelte Kommunikation an ein großes, wenig differenziert betrachtetes Publikum.
Wie die Botschaft ankommt, hängt dabei von vielen Faktoren ab: vom Absender, vom Inhalt, vom Trägermedium, vom Empfänger und weiteren kontextuellen Randbedingungen wie zum Beispiel dem Image und der Bewertung des Werbeträgers. Der Vorteil der Massenkommunikation liegt auf der Hand: große Reichweite bei niedrigen Pro-Kopf-Kontaktkosten. Die Nachteile: Erstens kann keine individuelle Ansprache erfolgen und zweitens kann aufgrund der Einseitigkeit der Kommunikation der Empfänger dem Sender nicht direkt Rückmeldung geben bzw. die Rückmeldung erfolgt zeitlich stark verzögert. Dadurch können Missverständnisse nicht direkt gelöst werden bzw. können sich mögliche negative Auswirkungen länger und unbemerkt vom Absender entfalten.
Individualkommunikation
MERKE
Individualkommunikation
Die IndividualkommunikationIndividualkommunikation bezeichnet die direkte, zweiseitige, technisch vermittelte oder technisch unvermittelte Kommunikation.
Hier können ebenfalls Merkmale des Absenders (Geschlecht, Glaubwürdigkeit, Sympathie, Attraktivität), des Empfängers (Motivation, Müdigkeit, Interesse), des Mediums sowie weitere Randbedingungen die Güte der Kommunikation beeinflussen. Die Vorteile der Individualkommunikation liegen zum einen in der Rückmeldemöglichkeit des Rezipienten und zum anderen in der Möglichkeit des Senders, sich auf die Situation und Bedürfnisse des Rezipienten besser einzustellen. Die Nachteile liegen in der geringen Reichweite und dem hohen Pro-Kopf-Aufwand.
Welche der beiden KommunikationsformKommunikationsform, Entscheidungsfaktorenen gewählt wird, hängt dann unter anderem von folgenden Faktoren ab:
Größe der Zielgruppe,
Erreichbarkeit der Zielgruppe,
Homogenität/Heterogenität der Zielgruppe,
Schwierigkeit/Einfachheit der zu übermittelnden Botschaften sowie
Ziel der Kommunikation.
So wird man bei einem Massenprodukt selbstredend eher auf die Massenkommunikation setzen, während sich die Individualkommunikation besser für ein erklärungsbedürftiges Produkt in einem Nischensegment eignet.
Massenhafte IndividualkommunikationIndividualkommunikation, massenhafte
Generell gilt: Je besser sich der Absender in die Gedanken- und Gefühlswelt sowie die momentane Lebenswirklichkeit des Empfängers hineinversetzen kann, je empathischer er ist, umso eher gelingt es ihm, erfolgreich zu kommunizieren, da er in diesem Fall über die entsprechenden Kenntnisse darüber verfügt, welche Informationen der Empfänger auf welche Art und Weise erhalten möchte (vgl. dazu Bak, 2015, 2016).
Durch das Internet und die Innovationen im Bereich der mobilen Kommunikation haben sich neue Möglichkeiten der Kommunikation entwickelt. So bieten E-Mails, Bannerwerbungen oder allgemein Werbung in sozialen Netzwerken die Möglichkeit, massenhaft individuell zu kommunizieren. Dazu werden Informationen, die wir beim Verfassen von Nachrichten oder bei jedem Mausklick über uns preisgeben, gesammelt und mit bereits vorhandenen Daten vernetzt. Daraus entsteht dann ein spezifisches Nutzerprofil, für das bestimmte Werbemaßnahmen und Werbeinhalte maßgeschneidert angeboten werden (Online-Targeting, weitere Informationen dazu im nächsten Kapitel).
1.8 Werbeziele
Werbung ist in der Regel kein einmaliger Vorgang, sondern vielmehr ein dauernder Prozess, der sich aus einem Potpourri an unterschiedlichen Maßnahmen (TV-Werbung, Radiowerbung, Flyer, Plakatwerbung, Kataloge, Homepage etc.) zusammensetzen kann. Ausgehend von einem übergeordneten Kommunikationsziel (z. B. als Qualitätsführer wahrgenommen zu werden) dient jede einzelne Maßnahme einem bestimmten Zweck, d. h., die mit der Werbung und den einzelnen Maßnahmen verbundenen Ziele Werbezielesind nicht unbedingt einheitlich, sondern können ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen (Maßnahme A soll in erster Linie Wissen vermitteln, Maßnahme B Sympathie erzeugen). Die Ziele lassen sich nach unterschiedlichen Aspekten ordnen, die sich an dem eben beschriebenen Kommunikationsmodell orientieren.
1.8.1 Senderorientierte Werbeziele
Man kann Werbung – wie eben geschehen – allgemein als einen kommunikativen Prozess verstehen, in dem der Sender (das werbetreibende Unternehmen, die Organisation, die Marke) eine Botschaft in Richtung Empfänger sendetWerbeziele, senderorientierte. Jetzt zeigen uns schon unsere kommunikativen Alltagserfahrungen, dass es einen großen Unterschied für uns macht, wer mit uns kommuniziert. So werden wir einem Experten mehr Glauben schenken und eher vertrauen. Einem sympathischen Menschen werden wir wohlwollender zuhören und ihm sogar die ein oder andere Schwäche verzeihen. Gleiches gilt für eine attraktive Person, wie die Studien zum Halo-Effekt (siehe z. B. Nisbett, R. E./Wilson, T. D. 1977) belegen. Dasselbe gilt auch für den werblichen Zusammenhang, weswegen ein Großteil der Werbung darauf verwendet wird, das Image des Senders entsprechend aufzubauen, damit nachfolgende Ansprachen auch die gewünschte Wirkung erzielen können. Es geht also darum, das Wissen und die Einstellungen der Konsumenten in Bezug auf den Sender so aufzubauen, dass es zur Botschaft und zum Kommunikationsziel optimal passt. Im Kern geht es vor allem um die Glaubwürdigkeit des Absenders (Maathuis, O./Rodenburg, J./Sikkel, D. 2004; Nawratil, U. 2006; Eisend, M. 2013). So warb beispielsweise der Autohersteller Renault ab 2010 jahrelang mit dem Slogan »Créateur d’automobiles«. Was kann glaubwürdiger für die Expertise im Autobau sein, als sich als »Schöpfer von Automobilen« zu positionieren?
1.8.2 Empfängerorientierte Werbeziele
Neben der kommunikativen Positionierung des Senders geht es um die Ansprache der Empfänger, also der kommunikativen ZielgruppeWerbeziele, empfängerorientierte. Das können beispielsweise Kunden, potenzielle Kunden, Mitarbeiter, die Öffentlichkeit oder Investoren sein, womit auch die Ziele variieren können. So kann Werbung eingesetzt werden, um Kunden zu gewinnen oder zu binden, Bedürfnisse oder Interesse zu wecken. Anleger wollen überzeugt werden. Auch kann Werbung dazu genutzt werden, die Öffentlichkeit aufzuklären, zu beschwichtigen, für sich einzunehmen oder die Spendenbereitschaft zu erhöhen. Mitarbeiter können durch Werbung informiert, gewonnen und ans Unternehmen gebunden werden. Händler und Zwischenhändler sollen durch Werbung dazu gebracht werden, an den Produkterfolg zu glauben.
1.8.3 Marktorientierte Werbeziele
Werbeziele lassen sich mit Rippel (1990) zudem aus Sicht des Marktes formulierenWerbeziele, marktorientierte. So kann Werbung dazu genutzt werden, ein Produkt einzuführen (Einführungswerbung), sich gegenüber den Wettbewerbern abzugrenzen und durchzusetzen (Durchsetzungswerbung), den Wettbewerbern z. B. in gesättigten Märkten Marktanteile abzunehmen (Verdrängungswerbung) und schließlich neue Kunden zu gewinnen (Expansionswerbung).
1.8.4 Psychologische Werbeziele
Psychologisch lassen sich die Werbeziele nach kognitiven, affektiven und konativen Werbezielen aufschlüsseln (z. B. Hüsser, 2016)Werbeziele, psychologische. Kognitive Werbeziele beziehen sich darauf, dass Werbung Informationen vermittelt. Diese müssen beim Empfänger entsprechend verarbeitet und in bestehende Wissensstrukturen integriert werden. Der Empfänger soll also Wissen über die Marke, das Produkt, die Dienstleistung, das Unternehmen aufbauen, dieses behalten und auch wieder abrufen können. Auf affektiver Ebene geht es um die emotionale Ansprache. Der Rezipient soll sich unterhalten, Sympathie empfinden. Konative (behaviorale) Werbeziele wiederum richten sich auf das (potenzielle) Handeln des Empfängers. Er soll dazu gebracht werden, sich mit der Werbung zu beschäftigen, das Produkt zu kaufen oder weiterzuempfehlen. Alle drei Aspekte lassen sich zudem noch in kurzfristige (z. B. auf eine Rabattaktion hinweisen), mittelfristige (z. B. ein neues Produkt einführen) oder langfristige Ziele (z. B. Einstellungsänderungen bewirken) einteilen.
1.9 Häufige Werbeformen
Above- und Below-the-line-Werbung
Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Kunden anzusprechen und zu gewinnen, lassen sich Werber immer neue Methoden einfallen, die neben den klassischen WerbeformenWerbeformen eingesetzt werden. Üblicherweise unterscheidet man hier zwischen Above-the-line-WerbungAbove-the-line-Werbung (klassische Werbung über Massenmedien wie Printanzeigen, TV-Spots, Radiowerbung, Außenwerbung) und Below-the-line-WerbungBelow-the-line-Werbung (Werbung außerhalb der Massenmedien wie Product Placement, Event Marketing, Verkaufsförderung, Public Relations). In der Praxis kommen häufig mehrere Werbeformen gleichzeitig zum Einsatz. Gesucht wird das geeignete Werbemittel, um die Zielgruppen im richtigen Moment mit der passenden Werbebotschaft zu erreichen. Im Folgenden sollen einige gängige Werbeformen kurz beschrieben werden.
Außenwerbung (offline)
Darunter fallen alle Werbeträger im öffentlichen Raum, also Litfaßsäulen, Plakatwände, Videowände, Projektionen an Hauswänden, Bannerwerbung im Stadion, Schaufensterwerbung, Werbung in und an Verkehrsmitteln, Baustellenverkleidungen, Schilder etc. Ziel ist es, entweder den Kunden direkt zu einem bestimmten Verhalten zu animieren, ihn über Angebote und Möglichkeiten zu informieren oder ihn in ganz unterschiedlichen Kontexten mit der Werbebotschaft zu konfrontieren. Die Bedeutung der AußenwerbungAußenwerbung hat in den letzten Jahren zugenommen, wofür vor allem digitale Werbeträger verantwortlich sind (www.faw.de, Fachverband Außenwerbung, e. V.).
Bannerwerbung (online)
Die BannerwerbungBannerwerbung ist das Pendant zur Werbeanzeige im Internet. Auch hier gibt es ganz verschiedene Varianten und Größen. Ein Vorteil gegenüber der Printwerbung liegt in der dynamischen Steuerung, d. h. die Inhalte können zeitgesteuert oder nach anderen Vorgaben platziert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Werbung an den Nutzer anzupassen, etwa mit Hilfe von Cookies oder anderen Profiling-Instrumenten.
Blockwerbung (TV)
Native Advertising
BlockwerbungBlockwerbung ist eine häufige Werbeform im Fernsehen, bei der verschiedene Werbeclips nacheinander ausgestrahlt werden. Wird zweimal ein Spot in langer und kurzer Version gezeigt, unterbrochen durch andere Spots, spricht man von TandemspotTandemspot. Ziel ist es, durch die wiederholte Ausstrahlung Erinnerungseffekte zu erzielen. Wenn die Clips zum laufenden Programm oder zu einer speziellen Zielgruppe passen, spricht man auch von Narrow Casting bzw. im Fall von Printwerbung oder Werbung auf Webseiten von Native Advertising (genau genommen ist damit Werbung gemeint, die kaum vom redaktionellen Umfeld zu unterscheiden ist, etwa PR-Texte; z. B. Wojdynski, B. W./Evans, N. J. 2016)Narrow Casting. Davon erhofft man sich eine bessere Ansprache der Zielgruppe.
Buzz-Marketing (offline, online)
Der Begriff Buzz-MarketingBuzz-Marketing wurde vom Englischen to buzz (summen) abgeleitet. Es geht darum, dass Privatpersonen (Buzz-Agents), die sich als Produkt-Fans outen, gegen ein Honorar oder für Gratisprodukte in ihrem eigenen sozialen Umfeld Personen ansprechen, um für eine Marke oder ein Produkt zu werben. Dies kann auch über das Internet erfolgen. Der Buzz-Agent soll dabei nicht unbedingt verkaufen, sondern als Experte wahrgenommen werden. Mit www.trnd.com gibt es sogar eine eigene Online-Community, aus der Unternehmen ihre Agents rekrutieren können (siehe dazu Information 1).
Empfehlungsmarketing (online)
Zunehmend informieren sich Kunden im Internet über die Vor- und Nachteile von Produkten oder Dienstleistungen in eigenen Empfehlungs-Empfehlungsmarketing, Preis- und Testportalen wie etwa www.kelkoogroup.com oder www.hrs.de. Hier kann man sich aus erster Hand Bewertungen von Produktnutzern ansehen und selbst Bewertungen abgeben. Auch Google oder soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram erlauben zum Beispiel die Beurteilung von Produkten, Webseiten etc. durch den Like-Button. Für die Werbung kann dies ungeheuren Nutzen bringen, weil diese Empfehlungen authentisch wirken und daher sehr überzeugend sein können. Das große Risiko besteht darin, dass Nutzermeinungen auch ungeheuren Schaden anrichten können, wenn schlechte Bewertungen überwiegen. Es wundert daher kaum, dass viele Bewertungen und Empfehlungen dann gar nicht vom »authentischen« Nutzer stammen, sondern aus der Feder von raffinierten Werbern. Wenn das allerdings auffällt, kann es katastrophale PR-Folgen haben, wie etwa das Beispiel WeTab, ein deutscher Tablet-PC, zeigt. Nachdem aufgefallen war, dass die Lobpreisungen des Produktes auf www.amazon.de vom Geschäftsführer selbst stammten, der diese dort unter falschem Namen abgegeben hatte, wurde das Gerät von den potenziellen Kunden links liegen gelassen. Das Gerät floppte total.
Game Shows (TV, Radio)
Vor allem in den privaten Fernsehkanälen findet man häufig QuizsendungenQuizsendungGame-Show, die vollständig durch Werbung für die in ihnen genannten oder auftauchenden Produkte bzw. Marken finanziert sind. Die Zuschauer sollen allerdings vor allem durch die Spannung bzw. den Unterhaltungswert der Show zum Zuschauen bewogen werden und die werbliche Information eher beiläufig wahrnehmen.
Guerilla Marketing (offline)
Guerilla MarketingGuerilla Marketing ist eine gerade in Großstädten beliebte Form der Werbung, um mit möglichst geringem Aufwand viel Aufmerksamkeit zu erlangen. Ziel ist es, auf außergewöhnliche Art und Weise aufzufallen und vielleicht einen Aha-Effekt zu produzieren. Das geht von der Beschriftung ganzer Straßen oder der Plakatierung ganzer Häuserzeilen bis zu speziellen Aktionen wie etwa Flashmobs Flash-Mobs etc.
Influencer Marketing (online)
Parasoziale Interaktion
Eine relativ günstige, aber sehr wirkungsvolle Möglichkeit, für spezielle Zielgruppen zu werben, ist das sogenannte Influencer Marketing (vgl. z. B. Campbell, C./Farrell, J. R. 2020)Influencer Marketing. Influencer sind Multiplikatoren, die gezielt von werbetreibenden Unternehmen ausgesucht werden, um beispielsweise Produkte vorzustellen oder implizit oder explizit Kaufempfehlungen auszusprechen. In der Regel handelt es sich dabei um Blogger, die etwa auf Plattformen wie YouTube oder Instagram Videos, Fotos und Texte zu ganz unterschiedlichen Themen posten. Gemischt mit tatsächlich oder auch nur scheinbar privaten Informationen wirken diese Postings authentisch und sehr überzeugend, da den Bloggern keine unmittelbare Verkaufsabsicht unterstellt wird. Auch die scheinbar persönliche Beziehung, die man als Follower mit den Influencern eingeht, kann sich positiv auf das Produktgefallen auswirken, wenn man nämlich das Gefühl hat, «von einem Freund zu kaufen« (»Buying from a friend«, Auter, P. J/Moore, R. L. 1993). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von parasozialer Interaktion, um diese besondere Beziehung zu einer Medienfigur zu beschreiben. Wir haben solche Beziehungen auch zu Personen, die wir aus dem Fernsehen kennen und zu denen wir eine einseitige (und vertraute) Beziehung aufbauen, was entsprechend wieder in der Werbung genutzt werden kann.
Keyword Advertising (online)
Beim Keyword Advertising Keyword Advertising handelt es sich um eine interessengeleitete Darbietung weiterführender Informationen. In Suchportalen wie beispielsweise Google oder Bing werden in Abhängigkeit von den eingegebenen Suchanfragen des Nutzers bestimmte Webseiten bevorzugt angezeigt. Das Keyword Advertising ist Teil des Suchmaschinenmarketings.
Merchandising (offline)
Beim Merchandising Merchandising versucht man, vom positiven Produktimage auch bei anderen, mehr oder weniger verwandten Produkten zu profitieren bzw. eine Marke ganzheitlich, an so vielen Kontaktpunkten wie möglich zum Kunden zu kommunizieren. Jede größere Filmproduktion kommt heute z. B. mit einer entsprechenden Ausstattung daher, vom Kugelschreiber über das Notizbuch bis zur Kaffeetasse kann alles als Werbeträger verwendet werden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die (potenziellen) Kunden werden permanent und auch in Situationen, in denen das ursprüngliche Kernprodukt nicht verwendet wird, an das Produkt und die Marke erinnert.
Multisensorisches Marketing (offline, online)
Hinter dem multisensorischen Marketing Marketing, multisensorisches (synonym findet man auch die Begriffe multimodales oder sensorisches Marketing) steckt die Erkenntnis, dass unsere Sinne nicht isoliert zu betrachten sind, sondern miteinander vernetzt sind (zum Überblick siehe Krishna, A./Schwarz, N. 2014). Visuelle Informationen können beispielsweise auch Empfindungen in anderen Sinnen anstoßen. Wenn wir etwa ein Bild mit einer Sommerlandschaft betrachten, können wir regelrecht die Wärme spüren, die wir an einem typischen Sommertag empfinden. Als weiteres Beispiel lässt sich hier anführen, dass man etwa das Produktgewicht an der Farbigkeit festmacht. Dunkle Farbe empfinden wir als schwerer. Oder denken wir an das »Knispern« von Chips, was wir mit Frische und Knusprigkeit assoziieren. Je mehr sinnliche Informationen zur Verfügung stehen, umso eindeutiger und informativer sind die Eindrücke. Multisensorisches Marketing bietet sich daher auch an, um Produkte oder die Marke auf ganz subtile Art und Weise gegenüber Wettbewerbern zu differenzieren.
Product Placement (TV, Radio, Spiele)
Beim Product Placement Product Placement werden Markenprodukte zur Ausstattung von Film- und Fernsehproduktionen bzw. von Videospielen eingesetzt. So fährt James Bond etwa Aston Martin, Magnum einen Ferrari und Dr. House sitzt vor einem Dell-Computer. Product Placement kann im Sinne des Sponsorings offen als »Produktbeistellung« oder verdeckt (Schleichwerbung) geschehen. Letzteres ist in Deutschland verboten. Über die Wirksamkeit des Product Placements gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Es ist davon auszugehen, dass ein markiertes Produkt umso mehr in Erinnerung bleibt oder ganz allgemein in sinnvoller Weise verarbeitet wird, je mehr mit ihm durch die Protagonisten interagiert wird. Insgesamt kann man hier eher von schwachen Effekten ausgehen, die aber als ein Bestandteil einer integrierten und ganzheitlichen Werbestrategie Sinn machen können.
Public Relations (offline, online)
Unter Public Relations Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) kann man allgemein die interessengeleitete, nicht unmittelbar profitorientierte Unternehmenskommunikation verstehen. Der Adressatenkreis ist dabei sehr weit gefasst. So können neben den Kunden (Product Publicity/Produkt-PR) und Mitarbeitern (Human Relations) beispielsweise Vertreter journalistischer Massenmedien als potenzielle Multiplikatoren im Fokus stehen (Media Relations) oder Mandats- und Entscheidungsträger in Politik und öffentlicher Verwaltung (Public Affairs), Gläubiger oder Finanzanalysten (Financial/Investor Relations). Auch lassen sich unterschiedliche Themenbereiche innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden, etwa wenn es darum geht, tatsächlich diskutierte Themen zu (be-)setzen (Issues Management) oder auf eine kritische mediale Berichterstattung zu reagieren (Crisis Management).
Sponsoring (TV, Radio, Spiele, Events)
Beim Sponsoring Sponsoring möchte sich der Sponsor (Sender) seinem Publikum (Empfänger) auf andere Art und Weise als gewohnt präsentieren. Insbesondere geht es nicht unmittelbar um eine Beeinflussung des Rezipienten, etwa zum Kauf eines Produktes, sondern eher um eine Form der Imagepflege, wenn zum Beispiel regionale, nationale oder internationale sportliche Events durch Sponsoren erst ermöglicht werden (z. B. fördert die Bitburger Brauerei seit Jahren regionale wie nationale Sportereignisse). Man setzt dabei auf Transfereffekte, d. h., das Image des gesponserten Events soll auf das Image des Unternehmens abstrahlen. Gleichzeitig kann das sponsernde Unternehmen das Ereignis öffentlichkeitswirksam in seinem Interesse darstellen. Im Bereich der Fernseh- oder Radiowerbung sprechen wir von Sponsoring, wenn ein bestimmtes Programm durch Werbemaßnahmen finanziell unterstützt wird (z. B. »Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Toyota Moersdorf«). Erkennt der Zuschauer eine sinnvolle Verbindung zwischen Sendung und Sponsor, wird darin sogar ein Zusatznutzen erkannt und das Sponsoring positiv bewertet (IP Deutschland2009). Das Sponsoring nimmt in der Kommunikationspolitik einen überaus hohen Stellenwert ein. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt 3,8 Milliarden Euro dafür ausgegeben (ein leichter Corona-bedingter Rückgang im Vergleich zu 2019); der Anteil des Sportsponserings am Gesamt-Sponsoringetat beträgt etwa 75 % und ist damit deutlich größer als z. B. der Anteil des Kultursponsorings mit ca. 8 % (de.statista.com).
Storytelling (offline, online)
Storytelling Storytelling ist eigentlich eine übergeordnete Marketingmaßnahme. Dahinter steckt die begründete Annahme, dass wir Informationen interessanter finden und besser verstehen und einordnen können, wenn sie nicht isoliert und einzeln präsentiert werden, sondern Teil einer nachvollziehbaren Geschichte sind. Die Geschichten können dabei fiktional sein, etwa bei der sich über mehrere Episoden erstreckenden Werbung für das Diätprodukt Almased, bei der wir einer jungen Frau dabei zusehen können, wie sie einen Mann kennenlernt, sich verlobt und schließlich heiratet (und dabei dank Almased eine »gute Figur« macht), oder (scheinbar) real, wie das z. B. bei Erfahrungsberichten (Rezensionen, Blogs etc.) der Fall ist. Auch die Darstellung der Unternehmensgeschichte anhand von wichtigen Ereignissen oder Personen bedient sich des Storytellings.
Suchmaschinenmarketing (online)
Beim Suchmaschinenmarketing Suchmaschinenmarketing sollen durch geeignete Maßnahmen Besucher auf bestimmte Internetseiten gebracht werden. Bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) geht es z. B. darum, die Webseite durch Angabe von Schlüsselwörtern (Keywords) und andere Maßnahmen in den gängigen Suchmaschinen möglichst auf den ersten Suchergebniseinträgen zu platzieren, ein fortlaufender Prozess, weil ständige neue Informationen und veränderte Algorithmen das Ergebnisranking permanent beeinflussen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, eine gute Platzierung in Suchmaschinen zu kaufen, sogenannte Sponsorenlinks Sponsorenlinks (sponsored links).
Teleshopping/Homeshopping (TV)
Das Teleshopping/HomeshoppingTeleshopping/Homeshopping (TV) ist ebenfalls häufig im privaten Fernsehen zu finden, entweder als Programmformat oder als eigenständiger Kanal. Dem Zuschauer werden in einer meistens moderierten Sendung verschiedene Produkte angepriesen. Durch Anrufen bzw. das Versenden von SMS kann dann direkt bestellt werden. In Deutschland wurden auf diesem Weg im Jahr 2022 prognostiziert immerhin 2,3 Milliarden Euro umgesetzt (de.statista.com).