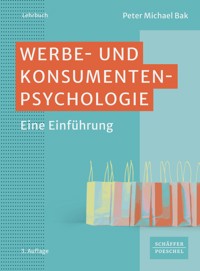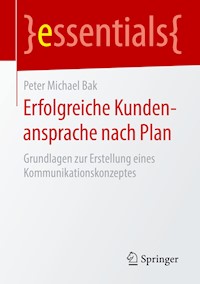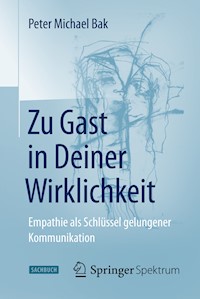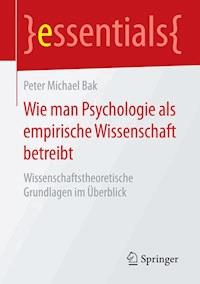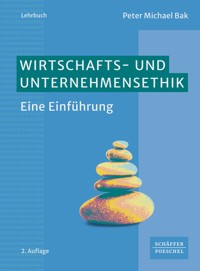
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Beschäftigung mit ethisch relevanten Fragen hat in den letzten Jahren einen neuen Stellenwert erlangt. Themen wie der menschengemachte Klimawandel, autonomes Fahren, Nachhaltigkeit, globaler Süden, Digitalisierung und Datenschutz, Geschlechterungerechtigkeit und Me-too, agiles Arbeiten, Homeoffice, die Corona-Pandemie oder künstliche Intelligenz betreffen immer auch ethische Fragen und werden gesellschaftlich breit diskutiert. Auch an Hochschulen und Universitäten sind die Themen der Wirtschafts- und Unternehmensethik mittlerweile in vielen Fächern verankert. In seiner Einführung erläutert der Autor die wichtigsten ethischen Grundbegriffe, stellt Methoden der moralischen Entscheidungsfindung vor und untersucht die Verantwortung von Konsumenten, Produzenten und Investoren. Die Entwicklung eines handlungstheoretischen Rahmenmodells ermöglicht, das eigene Verhalten sowie das Verhalten anderer unter ethischen Gesichtspunkten kritisch zu hinterfragen. Die 2. Auflage wurde umfassend aktualisiert und überarbeitet und um aktuelle Themen wie Datenschutz, Geschlechtergerechtigkeit und Künstliche Intelligenz ergänzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumVorwort zur 2. AuflageEinleitung1 Grundlagen und Grundbegriffe1.1 Moral1.2 Ethos1.3 Soziale Normen1.4 Recht und Gesetz1.5 Ethik1.5.1 Deskriptive Ethik1.5.2 Normative Ethik1.5.2.1 Deontologische Ansätze1.5.2.2 Konsequentialistische Ansätze1.5.3 Ethische Methodenlehre1.5.4 Metaethik1.6 Letztbegründung ethischer Aussagen1.7 Ausblick2 Ethische Perspektiven2.1 Gesinnungsethik2.2 Pflichtenethik2.3 Folgenethik2.4 Utilitarismus2.5 Gerechtigkeit2.6 Ausblick3 Moralisches Urteilen und Handeln3.1 Wie kommen wir zu moralischen Urteilen?3.1.1 Monologische Ethik3.1.2 Diskursethik3.2 Individuelles moralisches Verhalten3.3 Kontextuelle und soziale Faktoren moralischen Verhaltens3.4 Moralische Handlungen3.4.1 Das Prinzip der vielfältigen Handlungsbeschreibungen3.4.2 Handeln und Verantwortung3.5 Ausblick4 Moral und Wirtschaft4.1 Ökonomik4.1.1 Zweckrationalität4.1.2 Der Homo oeconomicus4.1.3 Der Homo irrationalis4.1.4 Die freie Marktwirtschaft4.2 Ökonomik oder Moral?4.2.1 Homanns und Lütges Ordnungsethik4.2.2 Peter Ulrichs Integrative Wirtschaftsethik4.2.3 Nachhaltigkeit als Mittler zwischen Ethik und Ökonomik4.2.4 Postwachstumsökonomie4.3 Ausblick5 Ethik der Wirtschaftsakteure5.1 Konsumentenethik5.2 Produzentenethik5.2.1 Unternehmensstrategie5.2.2 Personalethik5.3 Arbeitnehmerethik5.4 Investorenethik5.5 Ausblick6 Unternehmensethik6.1 Das Unternehmen als moralfähiger Akteur6.2 Das Unternehmen als Kontext individueller Entscheidungen6.3 Organisationsstruktur6.4 Shareholder-Value- und Stakeholder-Value-Ansatz6.5 Umsetzung einer Unternehmensethik6.5.1 Unternehmensleitbild6.5.2 Unternehmenskultur6.5.3 Unternehmensverfassung/Corporate Governance6.5.4 Personalauswahl6.5.4.1 Kriterien an das Auswahlverfahren6.5.4.2 Gewinnung moralisch handelnder Mitarbeiter6.5.4.3 Motivations- und Anreizsysteme6.5.4.4 Lohngerechtigkeit6.5.4.5 Personalentwicklung6.5.5 Führungsethik6.5.5.1 Das Problem der Führung6.5.5.2 Personalführung6.5.5.3 Ethische Führung6.5.5.4 Mitarbeiterethik6.5.6 Kontrollsysteme6.5.6.1 Compliance-Management-System6.5.6.2 Weitere Kontrollinstrumente6.5.6.3 Whistle Blowing6.5.7 CSR/Unternehmerische Sozialverantwortung6.5.8 Management der Verantwortung6.6 Ausblick7 Wirtschaftsethische Rahmenbedingungen7.1 Nationale und globale Rahmenordnungen7.2 Individualethische Verantwortung innerhalb der Rahmenordnung7.3 Berufsethische Richtlinien7.4 Gesetze, Verordnungen, Regelwerke7.5 Universelle Werte: das Projekt Weltethos7.6 Kontrolle7.7 Erziehung und Bildung7.8 Ausblick8 Medienethik8.1 Medienproduzenten8.1.1 Unterhaltung8.1.2 Information und Desinformation8.1.3 Datenschutz und Urheberrecht8.2 Mediennutzer8.2.1 Individualethische Perspektive8.2.2 Sozialethische Perspektive8.3 Medienkompetenz8.4 Ausblick9 Auf zu neuen Ufern: abschließende ReflexionenLiteraturDer AutorIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Version Ihres Buches zugreifen zu können
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6320-1
Bestell-Nr. 20015-0002
ePub:
ISBN 978-3-7910-6321-8
Bestell-Nr. 20015-0101
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6322-5
Bestell-Nr. 20015-0151
Peter Michael Bak
Wirtschafts- und Unternehmensethik
2. aktualisierte und überarbeitete Auflage, Juli 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Bildnachweis (Cover): © Viktor_Gladkov, iStock
Produktmanagement: Nora Valussi
Lektorat: Michael Bauer, Mainz
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Dieses Buch ist meinen Kindern Alexander und Susanna in der Hoffnung auf eine friedvolle und menschenwürdige Zukunft gewidmet.
Vorwort zur 2. Auflage
Die 1. Auflage des Lehrbuchs zur Wirtschafts- und Unternehmensethik erschien im Jahr 2014. Seitdem ist viel passiert, was mittel- oder unmittelbar mit den hier behandelten Themen zusammenhängt oder diese mehr oder weniger tangiert. Im Oktober 2017 wurden Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein publik, wonach dieser jahrzehntelang Frauen aus der Filmindustrie sexuell belästigt und genötigt hat. Eine Folge dieses Weinstein-Skandals war die Me-too-Debatte, in der weltweit Frauen auf Missbrauchserfahrungen aufmerksam machten, die oft auch im Arbeitskontext stattfanden und noch stattfinden. Im Jahr 2023 wurde Andrea Tandler, die Tochter des ehemaligen bayrischen Innenministers Gerold Tandler (CSU) zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie mit Coronamasken Riesengeschäfte machte und dabei Steuern in Höhe von beinahe 8 Millionen Euro hinterzogen hatte. Ebenfalls 2023 wurden Vorwürfe bekannt, wonach der Autohersteller BMW bei der Abgasermittlung geschummelt haben könnte. Die Yale School of Management (som.yale.edu) führt eine »Hall of Shame«, in der sie alle Unternehmen öffentlich anprangert, die sich trotz des Ukrainekriegs nicht aus Russland zurückziehen und dort weiterhin Geschäfte machen; in einer »Positivliste« werden dagegen Unternehmen aufgeführt, die den Angriff der Hamas im Jahr 2023 auf Israel verurteilt haben. Zu Beginn des Jahres 2024 blockierten zahlreiche Bauern in Deutschland Autobahnen, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren, die sie als ungerecht empfanden.
Diese Liste an Themen, die sich weiter fortsetzen ließe, zeigt, dass problematisches und unmoralisches Handeln alles andere als die Ausnahme ist. Das Interesse an ethisch-moralischer Orientierung ist angesichts solcher Problematiken gleichwohl sehr groß, die entsprechende Fachliteratur dagegen – insbesondere für Fachfremde – nur mittelbar verständlich, da dem interessierten Leser oft das entsprechende Grundlagenwissen fehlt, um die ethisch-philosophischen Diskussionen einordnen oder verstehen zu können. Zudem mangelt es häufig an konkreten und handhabbaren Beispielen, mit deren Hilfe die grundlegenden Konzepte verstehbar werden. Anliegen dieses Lehrbuchs ist es daher, einen ganz pragmatischen Zugang zu dem gesamten Themenkomplex der Wirtschafts- und Unternehmensethik anzubieten. Mir geht es weder um einen umfassenden Überblick zum genannten Themenbereich noch um eine theoretische Erweiterung eines bestimmten Konzepts, sondern eher darum, ein grundlegendes Verständnis für ethische Fragestellungen und moralische Probleme im Bereich unternehmerischen und wirtschaftlichen Handelns oder einfach nur im privaten Umfeld zu schaffen. Wie kann man »ethisch denken« und analysieren? Wie kann man ethisch argumentieren? Wo liegen mögliche Probleme? Wie kann man sich einer Lösung annähern? Was muss man dabei berücksichtigen? Warum sind diese Fragen überhaupt von Bedeutung? Das sind die Fragen, die hier im Vordergrund stehen.
Der Sinn des Buchs, das sich in erster Linie an Bachelor- und Masterstudierende, aber auch ganz allgemein an am Thema Interessierte richtet, wäre aus meiner Sicht dann erfüllt, wenn der Leser bzw. die Leserin nach der Lektüre über ein grundlegendes Verständnis ethischer Fragestellungen verfügte, ein Bewusstsein für theoretisch wie praktische Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit ethischen Themen entwickelt hätte und selbstständig in der Lage wäre, konkrete Situationen unter ethischen Gesichtspunkten zu analysieren, zu problematisieren und eine grundlegende Vorstellung davon zu entwickeln, wie ethische Probleme gelöst bzw. diskutiert werden können. Das Buch gibt nicht vor, was zu tun ist, es soll aber Möglichkeiten eröffnen, darüber sinnvoll zu sprechen.
Für die Neuauflage wurden zahlreiche Angaben aktualisiert und neue Beispiele eingefügt sowie verschiedene Themen neu aufgenommen bzw. detaillierter als bisher dargestellt. Denkanstöße, Vertiefungen sowie Reflexionsfragen und Stichpunkte am Ende jedes Kapitels sollen helfen, die Inhalte besser zu verstehen und die besprochenen Themen mit der Anwendungspraxis zu verbinden.
Und noch ein Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch häufig das generische Maskulin verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und bedeutet keine Wertung.
Mein Dank gilt an dieser Stelle noch Frank Baumgärtner und Nora Valussi vom Schäffer-Poeschel Verlag und Michael Bauer, der das Manuskript mit großer Fachkenntnis und Sorgfalt lektoriert hat.
Jetzt wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Freude und anregende Gedanken, die auch mit der kleinen Hoffnung verbunden sind, dass wir alle dazu beitragen können, unsere Welt und die unserer Kinder ein bisschen besser zu machen.
Saarbrücken, Juli 2024
Peter Michael Bak
Einleitung
Wie sollen wir handeln? Wie sollen wir entscheiden? Die Frage nach dem vernünftigen Handeln, nach dem richtigen und guten Verhalten beschäftigt Menschen vermutlich schon immer. Allein diese Feststellung mag schon als Indiz dafür reichen, dass die Fragen nach dem guten Handeln und Verhalten offenbar alles andere als einfach, nicht für jeden gleich und schon gar nicht endgültig zu beantworten sind. Es scheint mehrere und verschiedene Antworten zu geben. Betrachtet man die Komplexität menschlicher Handlungen und die Vielfalt menschlicher Beziehungen, die dazu noch in unterschiedlichsten Kontexten bzw. Kulturen und unter mannigfaltigen externen Einflüssen stattfinden, so ist die Schwierigkeit, eine Moral zu formulieren, einen einfachen und universellen Handlungskodex vorzugeben, nicht überraschend.
Moral, Werte und Normen sind immer Ausdruck einer Lebenshaltung, einer Kultur, einer Epoche.
Das, was heute als gut und richtig empfunden wird, kann morgen schon anders bewertet werden. Und dennoch, dass moralische Vorstellungen wandelbar sind, bedeutet nicht notwendigerweise, dass es keine festen moralischen Bezugspunkte gäbe. Dies gilt sowohl für die Methode, also die Frage, wie ich zu einem moralischen Urteil kommen kann, als auch für die »Inhalte« der Moral, also was wir als gut und schlecht empfinden. Wir stehen häufig und in ganz unterschiedlichen Kontexten und Rollen vor moralischen Entscheidungen, zu denen es keine fertige Antwort gibt. Was sind gerechte Gehälter? Wie kann ich den Ressourcenverbrauch bei der Herstellung eines E-Bikes rechtfertigen? Darf ich für alles Werbung machen? Ist Fleischkonsum noch ethisch vertretbar? Darf ich meinen Arbeitgeber anlügen? Ist es ok, mit dem Firmenhandy private Telefonate zu führen? Die Frage, wie wir uns im konkreten Fall als Individuum, innerhalb einer Gruppe, als Vater, Mutter, als Unternehmer, Politiker, Forscher, Medienschaffender, Werber moralisch zu verhalten haben, ist von Fall zu Fall abzuwägen. Außerdem ist es angebracht, nicht nur darüber zu reflektieren, wie wir richtig handeln können, sondern auch, wie unsere unterlassenen Handlungen moralisch zu bewerten sind.
Die Auseinandersetzung mit dem richtigen und guten Handeln hat derzeit gerade auch im Bereich der Wirtschaft angesichts solcher Themen wie Globalisierung, KlimawandelKlimawandel oder Geschlechtergleichbehandlung sowie einem allgemein gestiegenen Problem- und Verantwortungsbewusstsein, z. B. für die ökologischen Lebensgrundlagen, Konjunktur. Es gehört heute zum »guten Ton«, sich mit ethischen Fragen zu beschäftigen. Darüber hinaus haben nicht zuletzt die vielen Skandale der letzten Jahre, von diversen Bestechungsskandalen über Lebensmittelskandale, »DieselgateDieselgate«, »me tooMe too« bis hin zur großen Finanzkrise oder den menschenverachtenden Herstellungsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch und Indien zur intensiven Beschäftigung mit ethischen Fragestellungen in der Wirtschaft beigetragen, nicht zuletzt auch auf Druck der Medien und Konsumenten.
Dennoch sind wir weit davon entfernt, abschließende Antworten geben zu können oder Kriterienkataloge vorzulegen, die uns in jedem Fall die richtige Entscheidung vorgeben. Es liegt im Wesen der Auseinandersetzung mit moralischen Fragestellungen, dass sie immer wieder neu diskutiert werden. Das mag einerseits denjenigen entmutigen, der nach einer endgültigen Antwort sucht. Für denjenigen, der seine eigene Verantwortung bei der Suche nach der besten Lösung annimmt, kann es dagegen eine Herausforderung sein, sich bei der Suche nach und Annäherung an die richtige Antwort zu beteiligen; und dies wohl wissend, dass der Idealzustand nicht erreicht werden kann, sondern nur als Orientierungspunkt dient, der uns unser Handeln und das Handeln anderer bewerten lässt.
Im Folgenden wird der Fokus der Betrachtung auf das Handeln in wirtschaftlichen Kontexten gelegt. Es geht um gutes unternehmerisches Handeln, ein gutes Handeln in wirtschaftlichen Kontexten und generell eine ethische Wirtschaft. Dies betrifft also sowohl unsere Sozial- und Wirtschaftsordnung als Ganzes (Wirtschaftsethik) als auch unternehmerisches Handeln im Besonderen (Unternehmensethik) bzw. verantwortungsvolles Handeln jedes Einzelnen im wirtschaftlichen Prozess (Individualethik) und die gesellschaftlichen Auswirkungen (Sozialethik). Auch die Medien, die für alle gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Diskurse immer wichtiger sind, werden uns unter dem Stichwort »MedienethikMedienethik« beschäftigen.
Wir werden im Folgenden mit allgemeinen Betrachtungen zum Thema Moral und Ethik beginnen und uns dann Schritt für Schritt in Richtung Ökonomie bewegen. Die Kapitel des Buchs bauen aufeinander auf. In Kapitel 1 stehen zunächst ganz grundlegende Fragen im Zentrum der Betrachtung: Was ist eigentlich Moral und was Ethik? Und wie lassen sie sich begründen? Kapitel 2 widmet sich dann verschiedenen ethischen Perspektiven. Es geht um Fragen einer ethischen Gesinnung oder darum, ob es bei Entscheidungen darum geht, seine moralische Pflicht zu erfüllen oder eher auf die Handlungsfolgen zu achten. In Kapitel 3 setzen wir uns mit dem Thema moralisches Urteilen und Handeln auseinander. Wir werden einige Methoden zur Urteilsbildung kennenlernen und uns damit beschäftigen, unter welchen Umständen wir das Handeln einer Person moralisch bewerten können. In Kapitel 4 stellen wir Moral und Ökonomie gegenüber und suchen nach Möglichkeiten der Vereinbarkeit. In Kapitel 5 fragen wir nach der Bedeutung und Verantwortung der einzelnen Wirtschaftsakteure, also Konsumenten, Produzenten und Investoren. In Kapitel 6 wenden wir uns konkret der Unternehmensethik zu. Es geht um die Frage, welche ethischen Problemstellungen sich innerhalb des unternehmerischen Handelns ergeben und welche Umsetzungsmöglichkeiten es für unternehmensethische Prozesse und Strukturen gibt. In Kapitel 7 werden die wirtschaftsethischen Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln als Grenzen, innerhalb derer sich unternehmerisches Handeln abspielt, näher betrachtet. In Kapitel 8 widmen wir uns dann der Medienethik. Medien üben einen zunehmend bestimmenden Einfluss auf viele Prozesse in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft aus und sind daher in ihrer Bedeutung für wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln kaum zu unterschätzen. Kapitel 9 beschließt die hier vorgelegte Einführung zur Wirtschafts- und Unternehmensethik mit einigen allgemeinen und reflektierenden Bemerkungen.
1 Grundlagen und Grundbegriffe
Wenn über ethisches, moralisches Verhalten nachgedacht wird, so findet dies stets unter der Prämisse statt, dass menschliches Handeln frei ist, dass das Subjekt mit Willens- und Handlungsfreiheit ausgestattet ist. Wäre dem nicht so, hätten wir nicht die Wahl, was wir tun, wie sollten wir dann für das Geschehen Verantwortung übernehmen bzw. wie sollte man uns dafür zur Rechenschaft ziehen können? Menschen sind frei, dies zu tun und jenes zu lassen. Darin unterscheiden sie sich für viele vom Tier, dem keine Entscheidungsfreiheit zugeschrieben wird. Aber was bedeutet eigentlich Willens- bzw. Handlungsfreiheit? Diese Frage ist keinesfalls so einfach, wie sie sich auf den ersten Blick ausnimmt. Vielmehr gibt es dazu völlig verschiedene Perspektiven, die sich zwischen DeterminismusDeterminismus (alle Ereignisse sind zwangsweise Folgen vorhergehender Ereignisse) über die Annahme eines tatsächlich freien Willens (LibertarierLibertarier) bis hin zur Annahme nicht verursachter erster Ursachen (IndeterminismusIndeterminismus) bewegen (vgl. z. B. Walter, W. 2004). Für viele Neurowissenschaftler steht beispielsweise fest, dass wir keinen freien Willen haben, dass der freie WilleFreier Wille eine Illusion ist (Markowitsch, H. J. 2004), dass der freie Wille höchstens als Entscheidung gemäß unseren Bedürfnissen und Zuständen zu interpretieren ist (Young, J. Z. 1987) oder vielleicht noch Veto-Charakter besitzt, um schon längst und ohne unseren Willen initiierte Handlungen zu stoppen (Libet, B. 2004).
Die Diskussion darüber ist in vollem Gange. Es gibt aber ganz pragmatische Gründe, am Konzept des freien Willens und Handelns und damit am moralfähigen Subjekt festzuhalten. Zum einen unsere Sprache: Wir verwenden den Begriff »Wille« und »freie Entscheidung«, um bestimmte, subjektiv so empfundene Entscheidungen von solchen Situationen abzugrenzen, in denen wir keine Handlungsmöglichkeiten wahrgenommen und erlebt haben. Zum anderen sind wir, wie der deutsche Hirnforscher und Philosoph Henrik Walter (*1962) es beschrieben hat, im Alltag ganz gut dazu in der Lage, zwischen moralisch richtigem und falschem Handeln zu unterscheiden. Zudem können wir Verantwortlichkeit für zukünftige Handlungen zuschreiben, wir können selbst Verantwortung übernehmen und wir »können uns über klare Ausnahmen kompatibilistischer Willensfreiheit verständigen (Bewusstlosigkeit, wahrhafte Realitätsverkennung, bestimmte Formen schwerer psychischer Erkrankungen)« (Walter, H. 2004, S. 176).
Fest steht: Die Annahme einer wie auch immer gearteten Willens- oder HandlungsfreiheitHandlungsfreiheit ist die Voraussetzung, um sich überhaupt mit ethischen Fragen auseinandersetzen zu können. Vielleicht sind wir nicht frei zu wollen, was wir wollen, aber immerhin sind wir doch dazu (zumindest in vielen Fällen) in der Lage, diese und jene Entscheidung zu treffen und danach zu handeln oder es zu unterlassen. Wenn das Reden von moralischem Handeln im vorliegenden Kontext also Sinn machen soll, dann müssen wir einfach davon ausgehen, dass das handelnde Subjekt nicht notwendigerweise so oder anders handelt, sondern dass es zumindest Gestaltungsspielräume gibt, innerhalb derer sich die Handlungen bewegen, es also zwischen moralischem und nicht moralischem Handeln prinzipiell entscheiden kann. Gleichzeitig ergeben sich aus diesen Handlungsfreiräumen als weitere Prämisse, um sinnvoll über ethisches Verhalten zu sprechen, Pflichten für das Subjekt: Es muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Die Handlungsfolgen können nicht einem anderen angelastet werden, der Handelnde muss sie selbst verantworten, vor sich und anderen. Das Handeln wird also bewertet, auch moralisch.
Gehen wir also bei den folgenden Betrachtungen davon aus, dass wir Menschen grundlegend moralfähig sind, weil wir erstens frei handeln und uns von Fall zu Fall so oder anders entscheiden können und zweitens die Fähigkeit besitzen, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich Moral?
1.1 Moral
Wenn wir moralisch handeln oder wenn wir die Handlung eines anderen als moralisch ansehen, dann meinen wir damit stets auch, dass dieses Handeln gut ist. Es ist gut, jemandem in Not zu helfen, falsch, ihm Hilfe zu verweigern. Es ist gut, andere nicht auszubeuten, schlecht, sich auf Kosten Schwächerer zu bereichern. Was aber bedeutet der Begriff »gut« genau in diesem Kontext? Wann ist denn eine Handlung gut? »Wenn sie eben den moralischen Vorstellungen entspricht«, könnte man antworten. Aber dann wäre die Antwort auf die Frage ein Zirkelschluss und wir wären keinen Schritt weiter. Wir müssen »gut« durch andere, objektive Kriterien bestimmen können. Aber gibt es solche Kriterien überhaupt? Gibt es vielleicht Werte, die gut sind und die dann unseren Maßstab des Guten bilden? Oder ist doch alles nur eine Frage des Standpunkts, relativ und subjektiv? Eine alles andere als einfache Frage, der wir uns später beim Thema »Letztbegründung« nochmals zuwenden werden. Belassen wir es in diesem Moment dabei und stellen fest, dass man unter Moral in aller Regel einen Konsens darüber versteht, was moralisch gut und schlecht ist, worin auch immer die Begründung dafür liegen mag.
MoralMoral ist das, was in einer Gesellschaft, in einer bestimmten Kultur, zu einem bestimmten Zeitpunkt von der überwiegenden Mehrheit der Menschen als gut, wünschenswert bzw. schlecht und zu vermeiden angesehen wird.
Moral, das folgt aus dieser Definition, ist damit veränderlich, kulturabhängig und sozial erwünscht. Was in einer Gesellschaft als gut akzeptiert wird, kann in einer anderen Gesellschaft als schlecht angesehen werden. Denken wir dazu nur an die vielen kulturellen Normen, die auch durch die vorherrschende Religion bestimmt werden, z. B. das Tragen eines Kopftuchs, die Beschneidung oder die Frage, ab welchem Alter man arbeiten soll, muss oder darf. Was in der einen Kultur als richtig angesehen wird, wird in der anderen womöglich ganz anders beurteilt.
Moral verändert sich aber auch über die Zeit hinweg, da sich die Gesellschaften selbst ständig verändern. Was heute akzeptiert ist, war gestern noch undenkbar. Und was in Zukunft sein wird, das können wir heute kaum sagen. Beispiele für die Veränderlichkeit moralischer Anschauungen lassen sich zahlreiche finden, wie etwa beim Thema Sexualität. Was diesbezüglich heute als »normal« und »sittlich« angesehen wird, war noch vor nicht allzu langer Zeit skandalös (siehe Denkanstoß 1).
Denkanstoß 1
Hildegard Knefs Busen löst Skandal aus
In dem Film »Die Sünderin« aus dem Jahr 1951 (Regie: Willi Forst) sieht man in einer Szene kurz den Busen der bis dahin unbekannten Hauptdarstellerin Hildegard Knef. Die katholische Kirche war empört, der Katholische Filmdienst rief zum Boykott auf und die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) hielt eine Krisensitzung ab. Aus heutiger Sicht und einer sich gewaltig veränderten Sexualmoral wirken diese Proteste eher befremdlich.
Welche anderen Beispiele fallen Ihnen zu einer veränderten Moral ein? Was könnte heute ein solches »moralisches Erdbeben« auslösen und was sagt das über unsere Moralvorstellungen aus?
Der WertewandelWertewandel bedeutet aber keinesfalls, dass Werte und Moral willkürlich wären. In Gesellschaften macht nicht jeder, was er will. Im Gegenteil, allein die Tatsache, dass Menschen sich seit jeher über moralische Fragestellungen Gedanken machen und sich damit auseinandersetzen, zeigt, dass beständige Werte, Normen und Moralvorstellungen stets eine große Rolle spielen, wenn sich Menschen in sozialen Gemeinschaften organisieren. Ein Beispiel für solche breit akzeptierten moralischen Vorstellungen ist die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« (siehe Vertiefung 1). Moral ist also etwas Veränderliches unter dem »Deckmantel« des absolut Gültigen.
In Gesellschaften geht es immer auch um die Verteilung von Gütern und Ressourcen, um Gerechtigkeit, um Solidarität und Fürsorge. Moral spielt dabei insofern eine große Rolle, als damit bestimmte Verteilungsregeln und Ansprüche legitimiert werden können, ohne dass das unbedingt explizit gelehrt oder ausgesprochen werden muss. Ähnlich wie auch Kultur tradiertes Wissen, Überzeugungen, Haltungen etc. innerhalb der gleichen Deutungsgemeinschaft zur Verfügung stellt und konserviert und damit eine Grundlage für gegenseitiges Verständnis schafft, so funktioniert auch Moral als eine Art sozialer Kitt, der dafür sorgt, dass soziale Gruppen (mehr oder weniger) gut funktionieren und dass nicht jeden Tag aufs Neue verhandelt werden muss, was man tun darf und was nicht. Die Vorstellungen darüber, was gut bzw. richtig und was schlecht bzw. falsch ist, werden über Erziehung und Sozialisation an die jeweils nachfolgende Generation weitergegeben. Eltern, Schule und weitere Sozialisationsinstanzen lehren uns teilweise explizit (z. B. über Ge- und Verbote), teilweise implizit (durch ihr Verhalten), welche Werte und Normen gelten. Die Generationenübergänge sind dabei insofern interessant, als sich zwischen den Vorstellungen der Elterngeneration und den Vorstellungen der Kindergeneration Diskrepanzen ergeben, die häufig eben nicht deckungsgleich sind. Hier stellen sich dann, nach einer Periode des Übergangs, in dem es zwischen den Generationen häufig zu Auseinandersetzungen und Konflikten kommt, entsprechende Anpassungen hinsichtlich der moralischen Vorstellungen ein. Gleiches gilt für offene Gesellschaften, in denen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen. Auch hier werden dann moralische Prinzipien herausgefordert bzw. müssen neue Antworten gefunden werden.
Vertiefung 1
Allgemeine Erklärung der MenschenrechteMenschenrechte (Auszug)
Am 10. Dezember 1948 wurde die Erklärung von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris genehmigt und verkündet.
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Die gesamte Erklärung kann hier nachgelesen werden: https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
Sigmund Freud (1856-1939) sagte über Ethik einmal, sie sei »eine Art Fahrordnung für den Verkehr von Menschen« (Freud, S. 1963, S. 123). Mit anderen Worten: Moralisch sein ist funktional für soziale Gruppen, es macht das Verhalten des Einzelnen und der Gruppe in Grenzen vorhersagbar und schafft Vertrauen. Weil sich Menschen und Kontexte ändern, muss sich demnach auch die Moral ändern. Und dennoch gibt es, z. B. mit unseren grundlegenden Wertvorstellungen oder den Menschenrechten, grundlegende Eigenschaften dieses Sozialkitts »Moral«, die sich für die Organisation des menschlichen Zusammenlebens bewährt haben und die von den Veränderungen weitgehend unberührt bleiben.
1.2 Ethos
Beschreibt Moral die allgemeine Vorstellung dessen, was wir (für gewöhnlich) als sittlich gut ansehen, so ist damit noch keine Aussage über das individuelle Empfinden oder die individuelle Überzeugung formuliert. So können gültige Moral und innere Überzeugung übereinstimmen oder auch nicht. Von Ethos (sittlicher Gesinnung) ist immer dann die Rede, wenn eine Person die sittlichen Werte als verpflichtend für ihr eigenes Handeln ansieht und auch danach handelt, wenn die Person also von der Richtigkeit der moralischen Werte und Normen überzeugt ist. Das kann problematisch werden, nämlich dann, wenn ein Mensch sich gerade aufgrund seiner eigenen moralischen Grundsätze dazu genötigt sieht, gegen die herrschende Moral und das geltende Recht vorzugehen, weil er der Ansicht ist, andere würden den sittlichen Werten nicht entsprechen.
Auf den Internetseiten der Aktivistengruppe »Letzten Generation«Aktivistengruppe \“Letzte Generation\“ stehen unter der Rubrik »Wer wir sind« (letztegeneration.org) beispielsweise folgende Sätze: »Die Regierung ignoriert alle Warnungen. Immer noch befeuert sie die Klimakrise und hat uns damit an den Rand eines Abgrunds gebracht. Wir sind nicht länger bereit, dieses Verbrechen an der Menschheit widerstandslos hinzunehmen. Wir werden nicht abwarten, während ein Staat nach dem anderen kollabiert. Am Ende sind wir alle in Gefahr. Wir sind der Überlebenswille dieser Gesellschaft«. Hier liegt also die Annahme zugrunde, der Staat handle unmoralisch, ja verbrecherisch und dagegen gilt es, sich zu Wehr zu setzen und das moralisch Gute zu tun. Gleichzeitig liegt in solch einem Aufbegehren gegen vorherrschende Wertvorstellungen auch die grundlegende Möglichkeit, moralische Maßstäbe verändern zu können. Wenn niemand aufbegehrt, dann kann es auch keine Veränderung geben. Nur welche Kriterien können benannt werden, wonach wir entscheiden könnten, was jetzt gut oder nicht gut ist? Und wer darf das entscheiden? Wer ist legitimiert, geltende moralische Vorstellungen über Bord zu werfen? Ein Einzelner? Oder eine Mehrheit? Wir werden später, bei der Frage nach den ethischen Argumentationsweisen und Methoden, nochmals auf diese Fragen zurückkommen.
1.3 Soziale Normen
Welche moralischen Vorstellungen und Werte in einer Gesellschaft gelten, lässt sich besonders gut an den sozialen Normen ablesen, die unser Miteinander explizit oder implizit regeln.
Soziale Normen sind allgemein akzeptierte Regeln für unser Denken, Fühlen und Verhalten.
Eine wichtige Funktion von sozialen Normen ist es, Vertrauen zwischen den Mitgliedern der sozialen Gemeinschaft herzustellen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Wo bzw. welche Normen bestehen, fällt uns meistens dann auf, wenn sie verletzt werden. Beispiele für soziale Normen sind, dass man sich gegenseitig hilft, dass man bei Beerdigungen nicht laut redet, sich »Guten Tag« sagt, älteren oder gebrechlichen Personen den Platz im Bus anbietet oder dem Nachbarn helfen soll, wenn er in Not ist. Auch im wirtschaftlichen Kontext gibt es viele solcher Normen, z. B. darf man seinen Arbeitgeber nicht belügen und nichts vom Arbeitsplatz stehlen oder der Verkäufer einer Ware oder Dienstleitung soll redlich sein.
Normen beeinflussen und lenken unser soziales Verhalten ganz konkret, indem sie die Grenzen setzen, innerhalb derer unser Handeln stattfindet. Normen geben an, was geht und was nicht geht. Dabei kann man zwischen informellen und formellen Normen unterscheiden. Informelle NormenInformelle Normen sind »ungeschriebene Gesetze«. Es ist z. B. völlig in Ordnung, wenn eine ältere Person einen Jugendlichen duzt. Umgekehrt würde man den Jugendlichen womöglich zurechtweisen, wenn er die ältere Person duzen würde. Das wäre eine Normverletzung, die auch sozial sanktioniert wird (man wird komisch angeschaut oder auf den Fehler von anderen hingewiesen). Formelle NormenFormelle Normen sind dagegen schriftlich fixierte Regeln, z. B. eine DIN-Norm, die festlegt, welche Seitenlänge ein Standardbrief hat.
Darüber hinaus unterscheidet man weiter noch zwischen Kann-, Soll- und Mussnormen, um damit das Ausmaß der Verpflichtung anzuzeigen. Das bedeutet, es gibt Normen, deren Einhaltung man zwar erwartet, an die wir uns gewöhnt haben, deren Nichteinhaltung aber nicht zu direkten Sanktionsmaßnahmen führt. Wir reden hier von den KannnormenKannnormen. Ein Beispiel hierfür ist die Nachbarschaftshilfe. Sie wird zwar erwartet, es hat aber nicht unbedingt nennenswerte Folgen, wenn man sie unterlässt. Im unternehmerischen und organisationalen Kontext ist es eine Kannnorm, dass man z. B. in der Gemeinschaftsküche frischen Kaffee aufsetzt, wenn man gerade die letzte Tasse genommen hat. Bei anderen Normen, den SollnormenSollnormen, führt das Verletzen dagegen zu mehr oder weniger starken Sanktionen, die von sozialer Missachtung bis zum Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft gehen können. Dazu zählen z. B. die Verhaltensweisen, die öffentlich missbilligt werden, etwa an bestimmten Orten keine aufreizenden Kleider anzuziehen oder während der Theatervorstellung nicht laut zu sprechen. Im Organisationskontext können die Kleiderordnung oder die Forderung, sich kollegial zu verhalten, als Sollnormen verstanden werden. MussnormenMussnormen wiederum entsprechen rechtlichen Normen, d. h., eine (staatliche) Sanktionsinstanz überwacht bzw. garantiert ihre Einhaltung. Bei einer roten Ampel müssen wir per Gesetz anhalten. Korruption ist verboten. Solche Mussnormen sind in der Regel explizit, d. h., man kann sie beispielsweise nachschlagen.
Kann- und Sollnormen werden nicht verabschiedet, sondern entstehen in gesellschaftlichen Gruppen »von selbst«. Sie werden nicht durch staatliche Institutionen vorgegeben, kontrolliert oder sanktioniert, können aber durch nicht staatliche Autoritäten (oder auch die Kirche) verlangt, kontrolliert oder sanktioniert werden. Normen treten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft und verlieren auch nicht zu einem Zeitpunkt ihre Gültigkeit. Eher ist es ein fließender Übergang von einer zur anderen Norm.
Der häufig unverbindliche Charakter der sozialen Normen reicht häufig nicht aus, um tatsächlich gutes und sittliches Handeln zu erreichen. Dies mag zum einen daran liegen, dass viele moralische Überzeugungen kaum oder nur unzureichend explizit sind und es auch keinen Konsens darüber gibt, was eigentlich passiert, wenn gegen sie verstoßen wird. Auch kann es sein, dass die Normen so allgemein formuliert sind, dass es in der konkreten Situation Interpretationsspielraum gibt, oder aber, dass Normen an andere Normen gebunden sind, die entweder als wichtiger angesehen werden (»Ich weiß, betrügen sollte man nicht, aber ich hätte sonst niemals dem Arbeitsplatz bekommen, der für die Ernährung meiner Familie so wichtig ist!«) oder deren Nichteinhaltung als Legitimation verstanden werden kann, sich ebenfalls nicht an die Norm halten zu müssen: »Hättest Du mich nicht angelogen, dann hätte ich Dir auch geholfen!« Insbesondere in großen sozialen Gemeinschaften bedarf es daher noch anderer Vorschriften, um das Miteinander zu regeln. In staatlich organisierten Gemeinschaften übernehmen Rechtsprechung und Gesetzgebung die staatlich kontrollierte und sanktionierte Normgebung.
1.4 Recht und Gesetz
Unter dem Recht kann man ein System von Muss- oder Zwangsnormen und Sanktionsmaßnahmen verstehen, die einen Teil der gesellschaftlich akzeptierten Normen darstellen.
Im Mittelpunkt der Rechtsordnung stehen Gesetze, die von einer staatlichen Autorität nach einem regelhaften Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. Sie treten zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft und können auch wieder außer Kraft gesetzt werden. Darüber hinaus gibt es entsprechend befugte Stellen, die über die Einhaltung der Gesetzesvorgaben wachen und gegebenenfalls die Nichteinhaltung bestrafen. Bei uns sind das z. B. Polizei, Staatsanwälte und Richter. Grundlage der Rechtsprechung ist die vorherrschende Moral. Oder anders formuliert, eine Rechtsprechung, die nicht mit der gültigen Moral übereinstimmt, wird sich in einem demokratisch legitimierten Rechtswesen kaum halten können. Allerdings ist das Rechtswesen träge, d. h., veränderte Moralvorstellungen finden oft erst mit Verzögerung in der Rechtsprechung Anwendung. Beispiel Ehebruch: Faktisch gesehen waren Ehepartner wohl schon immer nicht unbedingt treu und dennoch war Untreue nicht nur moralisch verwerflich, sondern bis 1969 sogar noch eine Straftat. Andererseits können auch Gesetze vorherrschende Moralvorstellungen verändern, was allerdings unter Umständen ein sehr langsamer Prozess sein kann. Ein Beispiel dafür ist Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes: »Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.« Gesetzlich wird hier versucht, eine faktische Ungleichheit zu korrigieren, tatsächlich hat das Gesetz auch nach 75 Jahren noch keine faktische Gleichberechtigung erwirkt.
Vertiefung 2
EhebruchEhebruch
In Deutschland gilt Ehebruch zivilrechtlich als unerlaubte Handlung und als Verletzung der aus der Ehe folgenden Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemeinschaft (§ 1353 Abs. 1 S. 2 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Jedoch wird Ehebruch seit dem 1. September 1969 nicht mehr strafrechtlich sanktioniert. Auch ist seit dem Wegfall des Verschuldensprinzips zum 1. Juli 1977 Ehebruch allein kein hinreichender Scheidungsgrund mehr. In anderen Kulturen (z. B. im Islam) ist der Ehebruch dagegen nach wie vor ein schweres Verbrechen.
Seit 2017 können auch Personen des gleichen Geschlechts heiraten. Hier der genaue Wortlaut des entsprechenden Paragrafen im BGB (vgl. gesetze-im-internet.de):
§ 1353 Eheliche Lebensgemeinschaft
(1) Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung.
(2) Ein Ehegatte ist nicht verpflichtet, dem Verlangen des anderen Ehegatten nach Herstellung der Gemeinschaft Folge zu leisten, wenn sich das Verlangen als Missbrauch seines Rechts darstellt oder wenn die Ehe gescheitert ist.
1.5 Ethik
Ethik ist eine philosophische Disziplin, die sich mit der Frage nach den Kriterien des guten und schlechten Handelns beschäftigt. Sie ist die Grundlage der »Angewandten Ethik«, in der es u. a. um Fragen und Probleme aus den Bereichen Technik, Umwelt, Medien und Gesellschaft geht, der Individualethik, die sich mit den ethischen Anforderungen an das Individuum befasst, sowie der Sozialethik, in der es v.a. um Fragen eines gelingenden sozialen Lebens geht. Moral und Ethik bzw. moralisch und ethisch werden häufig synonym gebraucht. Ich möchte im Folgenden Ethik als die Wissenschaft und Theorie der (gelebten) Moral auffassen.
Die Ethik wird häufig in die folgenden Teildisziplinen unterschieden: deskriptive Ethik, normative Ethik, Methodenlehre und Metaethik (vgl. Göbel, E. 2017).
1.5.1 Deskriptive Ethik
Innerhalb der deskriptiven Ethik geht es um die empirische Frage, welche Moral in bestimmten Gesellschaften, bestimmten Gruppen oder zu bestimmten Zeiten vorherrscht. So verweist die Tatsache, dass die Zahl der nichtehelichen Kinder von 7,2 % im Jahr 1970 auf 33,5 % im Jahr 2022 gestiegen ist (de.statista.com), auf veränderte Moralvorstellungen.
Die deskriptive Ethik fragt: Was gilt als gut?
Ziel der deskriptiven Ethik ist es, die kulturabhängigen moralischen Vorstellungen möglichst genau zu beschreiben. Die deskriptive Ethik ist damit die Grundlage des ethischen Diskurses. Durch die Auseinandersetzung mit gegebenen Moralvorstellungen (auch in unterschiedlichen Gesellschaften) können geltende Moralvorstellungen kritisch beleuchtet und gegebenenfalls als unzeitgemäß bewertet oder als passend anerkannt werden. Zur Ermittlung der herrschenden Moralvorstellungen bedient man sich der Methoden der Sozialwissenschaften, der Psychologie und Soziologie. Im vorliegenden Kontext wäre beispielsweise die Frage nach den moralischen Standards von Führungskräften in Deutschland eine typische Fragestellung der deskriptiven Ethik.
1.5.2 Normative Ethik
Die normative Ethik sucht nach den richtigen sittlichen Sollaussagen. Sie will begründete und verbindliche Aussagen dazu treffen, wie der Mensch in konkreten Situationen handeln soll, was er anstreben soll und wie er sein soll.