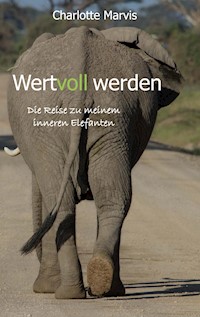
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wer kennt das nicht? Allzu oft sind wir sehr selbstkritisch, beschimpfen uns und entwerten uns. Alte Selbstbilder und hohe Erwartungen an uns selbst erzeugen Unfrieden und Abneigung. Wie können wir uns selbst wertschätzen und eine liebevolle Beziehung zu uns selbst gestalten? Charlotte Marvis erzählt humorvoll und persönlich von ihren Erfahrungen und Gedanken. Episoden aus ihrem Familienleben sind verwoben mit Konzepten aus der Psychologie und zur Persönlichkeitsentwicklung. Der innere Elefant ist ein Bild für den unbewussten und sprachlosen Teil unseres Selbst. Dieses Buch ist kein klassischer Ratgeber. Es ist ein Erfahrungsbericht, der mit vielen Impulsen zum Mitdenken und Ausprobieren anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charlotte Marvis arbeitet im IT-Bereich mit Personalführung und Teambuilding. Mit großer Leidenschaft beschäftigt sie sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstführung. „Wertvoll werden“ ist ihr erstes Buch.
Einige der zitierten Werke sind auf Schwedisch oder Englisch und wurden von der Autorin selbst übersetzt. Die angegebene Seitenzahl bezieht sich auf die fremdsprachliche Ausgabe. Der genaue Wortlaut mag von einer deutschen Ausgabe abweichen.
Für Paul und unsere Kinder Jonas, Katrin und Emil.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil 1: Bestandsaufnahme
Mein gewohnter Umgang mit mir selbst
Mahut und Elefant
Gefühl und Bewusstsein
Selbstwert und Selbstgefühl
Würde
Mir selbst bewusster werden
Wertvoll werden
Selbstvertrauen
Vertrauen
Ansätze für mehr Selbstvertrauen
Mit mir selbst ins Gespräch kommen
Unsere Schattenseiten
Selbstbild
Teil 2: Mich selbst wahrnehmen von außen nach innen
Für sich selbst sorgen
Das Konto Modell
Bedürfnisse
Eigene Bedürfnisse in einer Familie mit Kindern
Mir selbst Zeit und Aufmerksamkeit geben
Meine Grenzen
Über das „Nein“ sagen
Verantwortung
Pause machen
Über die Angst, Fehler zu machen
Wie treffe ich wertvolle Entscheidungen?
Wenn ein Tag nicht so gut läuft
Teil 3: Der Blick nach innen
Unsere Biografie
Das innere Kind
Mitgefühl mit mir selbst
Wahrnehmen und Bewerten von Gefühlen
Den Dingen einen Namen geben
Grundgefühle
Wie mit Gefühlen umgehen?
Umgang mit der inneren Vielfalt
Auf dem Weg zu einem guten Kontakt mit mir selbst
Die Gedanken „lenken“ -- Wie rede ich mit mir selbst?
Wertvoll bleiben
Übungen und Gedankenimpulse
Nachwort
Verzeichnis der Übungen und Gedankenimpulse
Literaturverzeichnis
Vorwort
"Du bist ein dummes Gespenst!", sagte Katrin zu Jonas aus heiterem Himmel. Oft waren die Zwillinge ein Herz und eine Seele und genauso oft zankten und stritten sie. Katrin hatte einen provozierenden, lauernden und neugierigen Unterton in der Stimme. "Du Knödel!", konterte er stolz, "Kackwurst!" schrie sie prompt zurück. Das war jedoch zu viel für ihn, er kam heulend und schreiend zu mir, “Mamaaa, Katrin hat ‚Kackwurst‘ zu mir gesagt, aber ich bin keine Kackwurst!". Ja, Recht hatte er. Kackwurst war neu im Sprachgebrauch und im Katalog der Beschimpfungen.
Das Zusammenleben mit vierjährigen Zwillingen ist unterhaltsam (bei gut gefüllten Geduldsvorräten), nervenaufreibend (bei Schlaf- und allen anderen Mangellagen) und lehrt mich viel über mich selbst. Jetzt zum Beispiel bringt es mich zum Nachdenken, wie ich selbst mit mir in Gedanken rede. Wir machen uns selbst oft zu Objekten unserer Erwartungen, Bewertungen und Zielvorstellung, (das, von dem wir annehmen, dass es unsere Bedürfnisse sind). Wir schimpfen mit uns, wenn wir das nicht liefern, nicht erreichen. Nicht spuren, nicht den Ansprüchen genügen.
Der Mensch solle „sich selbst [und seine Probleme] anpacken“ und seine innersten Träume und Erfolge verwirklichen. Diese Ansicht fordert uns auf, Dinge zu bewegen und zu verändern. Gleichzeitig definieren wir auch einen Mangel in uns selbst hinein (Wikström, 2006, s. 62). Ratgeber und Selbstoptimierungsdienste versprechen uns Heilung dieser Mängel, meist direkt, nachdem sie diese aufgezeigt haben. Svend Brinkman spricht von einer beschleunigten, gefühlsfokussierten Kultur, die nicht mehr von Verboten, sondern von Geboten und Pflichten geprägt ist: „Du sollst“ anstatt früher: „Du darfst nicht“ ((Brinkmann, 2018) S76ff). Das „Du sollst“ durchschwämmt alle Lebensbereiche: Du sollst passioniert sein für die Arbeit und das Putzen. Alles soll lustig sein und es soll auch zu Deiner Selbstentfaltung beitragen, den Müll rauszutragen. Diese fordernde Haltung setzt uns unheimlich unter Druck. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Hamsterrad, in dem sich viele gefangen sehen. Der Umgang mit uns selbst leidet sehr darunter. Aber wie können wir dieser Falle entgehen?
In dem Folgenden möchte ich einen Mittelweg aufzeigen. Wie schafft man es, sich weniger unter Druck zu setzen? Wie kann man eine bessere Beziehung zu sich selbst gestalten? Wie kann man mit Selbstkritik umgehen, ohne sich selbst wehzutun?
Das wesentliche Ziel ist, eine gute Balance zwischen Gefühlen und Verstand zu finden. Wertvoll sein bedeutet für mich: In mir selbst Frieden finden und mein Inneres als ruhige und glatte Wasseroberfläche zu erleben. Es bedeutet, Vertrauen zu mir und dem was in mir steckt zu haben. Ich bekämpfe mich nicht, ich lebe mit mir in Harmonie und Einverständnis. Ich begegne mir auf Augenhöhe und behandele mich wie eine gute Freundin: mit Respekt und Wertschätzung. Ich finde ein Zuhause in mir selbst.
Du bist in Dir selbst genug. Du trägst einen unerschöpflichen Reichtum in Dir. Entdecke ihn!
Der Titel des Buches heißt bewusst „Wertvoll werden“ und nicht „Wertvoll sein“. Es ist ein lebenslanger Weg, wie eine lebenslange Beziehung zu sich selbst. Brené Brown vergleicht ihren Begriff worthyness (Würdigkeit) mit dem Polarstern (Brown, 2012, S. 220), er zeigt die Richtung und gibt Orientierung. Dauerhaft ist dieser Orientierungspunkt jedoch schwer zu erreichen.
Dieses Buch ist kein Fachbuch, kein Roman und kein Faktenbericht, es ist ein Erfahrungsbuch, eine Bestandsaufnahme und vielleicht auch ein „Zukunftsplan“. Ich nehme Dich mit auf meine innere und intellektuelle Reise. Es soll Dich unterhalten und zum Nachdenken anregen.
Unsere Reise hat folgende Stationen: Der erste Teil ist der anstrengendste und der theokratischste. Es ist das intellektuelle Fundament. Ich stelle mir ganz viele Fragen, wie ein Kind. Wie können wir die Begriffe wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein verstehen. Welche Bedeutung haben sie aus der Perspektive der Selbstfreundschaft. Die zweite Station der Reise führt uns in das Gebiet mich selbst in Bezug auf meine Umwelt. Es geht um meinen Umgang mit mir in Bezug auf meine Umwelt und den Umgang mit meiner Umwelt in Bezug auf mich selbst: z. B. was sind Bedürfnisse, wie kann ich Grenzen setzen. Die dritte Etappe unserer Reise führt uns zu meinem Umgang mit mir selbst: wie kann ich mehr Frieden in mir schaffen? Welche Rolle spielen dabei Gefühle und innere Kritiker? Wie rede ich mit mir selbst? Im Anhang gibt es kleine Übungen und praktische Tipps.
Teil 1:
Bestandsaufnahme
Grundbegriffe und Hintergründe zu ich, mich, mir und mein Selbst
Mein gewohnter Umgang mit mir selbst
Was für eine Stimmung und was für ein Ton herrschen in mir? Eine schwierige Frage!
Mein Umgang mit mir selbst war, wenn ich ehrlich bin, geprägt von „es muss funktionieren“ und „erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder die Pause“. Ich war es gewohnt, von Ziel zu Ziel zu denken, von Aufgabe zu Aufgabe. Ich schaute eher nach außen, als nach innen. Für „in mich reinfühlen“ war da bis jetzt nicht so viel Platz und wie es mir geht, war nebensächlich. Es lief, so lange es eben ging.
Dann aber bekamen wir die Zwillinge Katrin und Jonas. Mit der großen Verantwortung kam auch extremer Schlafmangel und was ebenso dazugehört. Ich war gezwungen, einen neuen Weg zu finden, um nicht in einem Burnout zu landen. Plötzlich merkte ich, wie fremd ich mir selbst war, wie wenig Aufmerksamkeit ich mir schenkte. Es interessierte mich auch nicht wirklich, Hauptsache, es lief eben.
Aber, da waren nun plötzlich zwei kleine Wesen, für die ich und Paul die Verantwortung trugen: für alles, Essen, schlafen, Windeln, usw. Jedoch, wie so oft, wenn man an seine Grenzen getrieben wird, kann dies Raum für Veränderung schaffen. Umdenken oder Kollaps? Und da ging die Reise los. Ich begann nachzudenken, über mich und den Umgang mit mir. Ich begann zu lesen und mich nach und nach anders zu behandeln.
Ich denke es geht vielen so. Vielleicht ist es bei Dir auch so? Du hast bestimmt eine anspruchsvolle Arbeit und bist sehr leistungsorientiert. Vielleicht hast Du auch Kinder und vielleicht gehst Du auch oft über Deine Grenzen, bewusst oder unbewusst?
Ich habe mir viele Fragen gestellt. Wie funktioniere ich? Wie funktioniert mein Denken? Was ist Vertrauen? Was ist Freundschaft?
Katrin und Jonas fallen mir ein. „Wenn du nicht mit mir Lego spielst, bist du nicht mehr mein bester Freund.“, argumentierte Jonas gestern. So bekam er seinen Willen. Katrin verwendet das gleiche Muster. Ich höre ständig: „Wenn du nicht … [alles Mögliche einsetzbar], dann bist du nicht mehr mein bester Freund“. Und es wirkt bisher. Sie erpressen sich gegenseitig, wie Vierjährige das so tun. So soll es bei mir selbst aber nicht sein!
Mich auf diesen Weg zu machen und eine andere Beziehung zu mir selbst aufzubauen, hat mir eine neue Freiheit gegeben, in mir selbst aber auch in Bezug auf meine Umwelt. Ich konnte alte Selbstbilder und daran gekoppelte Verhaltensweisen loslassen und fand den Mut, Neues auszuprobieren. Ich möchte Dich, wie versprochen, mit auf diese Reise nehmen. Dieser erste Teil mag etwas theoretisch und trocken sein. Er ist mir wichtig für das Verständnis, das Fundament. Denn wir verwenden viele Begriffe, ohne sie zu hinterfragen. Und hier lernen wir meinen inneren Elefanten kennen
Mahut und Elefant
Ich möchte ein Bild verwenden, das mir sehr gefallen hat (geliehen von Nisse Simonson, (Simonson, 2019, s. 28) ). Stell Dir einen indischen Arbeitselefanten vor und einen Elefantenführer (Mahut). Der Mahut und der Elefant haben eine sehr tiefgehende Beziehung. Der Mahut sitzt auf dem Elefanten und soll ihn leiten. Wenn der Elefant nicht will, dann geht nichts. Schließlich ist ein Elefant kein kleines Schoßhündchen, das man im Notfall einfach an der Leine hinter sich herziehen kann.
Ich habe am Anfang meiner Reise dieses Bild viel verwendet. Es hilft mir, aus meinen gewohnten Denkmustern auszubrechen und Abstand zu gewohnten Identifikationen zu finden. Es ist weniger verkorkst und abstrakt, mit dem Elefanten kann ich mich leichter beschäftigen, als mit mir selbst. Vielleicht geht es Dir auch so? Vielleicht spricht Dich eher ein anderes Tier an, ein Schmetterling oder eine Schildkröte. Wenn du möchtest, suche Dir ein eigenes inneres Bild. Vielleicht eine Schildkröte oder ein Schmetterling?
Der Elefant in diesem Bild ist der innere Elefant, das Selbst und alles Unbewusste. Der Mahut ist das kleine bewusste Ich. Das Selbst, also unser innerer Elefant redet nicht viel. Wenn man ganz genau hinhört, kann man manchmal eine leise Stimme hören, die sich zaghaft meldet, Zweifel anmeldet. Das Bauchgefühl wird es auch oft genannt oder das Unbewusste.
Dieser Vergleich gibt ein anschauliches Bild für CG Jungs Beschreibung, in der er das Selbst als Ganzheit und Zentrum der menschlichen Psyche definiert. Es umfasst das Bewusste und das Unbewusste. Ein Neugeborenes hat z. B. schon ein Selbst, obwohl es sich dessen noch nicht bewusst ist (die Ichidentität ist noch nicht ausgebildet).
Das kleine bewusste Ich als das Menschlein Mahut und der große und schwere innere Elefant als der Rest. Friedemann Schulz Von Thun bringt es auf den Punkt: „Das, was uns (noch) nicht bewusst ist, hat großen Einfluss darauf, wie wir andere Menschen wahrnehmen und wie wir uns verhalten.“ (Miteinander reden von A bis Z, 2012, s. 39). Doch meist beschränken wir uns auf den kleinen Mahut und vergessen den großen Elefanten in uns. Wir haben gelernt, wegzusehen, wollen möglichst rational sein und ihn ignorieren. Wenn ich mich mit mir selbst anfreunden möchte, braucht der Elefant Raum und Aufmerksamkeit, das ist mir klar. Wie können wir den Elefanten bewusst wahrnehmen?
Die Selbstwahrnehmung funktioniert wie ein Scheinwerfer: Wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Atmung lenkt, nimmt man sie bewusst wahr, sonst läuft sie automatisch und unbewusst im Hintergrund ab. Mir hilft dieses Bild, es drückt ein mehrdimensionales Machtverhältnis aus und es macht mir auch das Gewicht meiner Anteile bewusst.
Ich würde mich selbst als einen sehr verkopften Menschen beschreiben. Rationalität und Zahlen zählen, das kann ich messen und berechnen. Mein innerer Elefant spricht diese Sprache nicht. Deshalb haben wir kaum geredet. Der Mahut schlägt den Elefanten, wenn er nicht spurt. Manchmal bis er blutet. Deshalb stelle ich mir Fragen, wie ein Kind und versuche mich mit dem Kopf zu verstehen. Was ist Bewusstsein?
Gefühl und Bewusstsein
Für mich persönlich ist das Hervorheben eines Gefühls besonders wichtig. Mein Weltbild zu Anfang der Reise könnte man beschreiben mit: „Ich denke, also bin ich – und alles andere ist nicht“. Darum finde ich die Theorie von dem Hirnforscher Antonio Damasio, die das Gefühl, als das Non-Verbale und nicht-Rationale, als Grundpfeiler für das Denken und das Bewusstsein aufstellt, so unheimlich wertvoll.
Der Hirnforscher Antonio Damasio hat die Grundthese, dass Gefühle grundlegend sind für unser Bewusstsein („Bewusstsein ist Gefühl“). Für ihn handelt es sich um „eine Dreiheit von Wachzustand, Geist und Selbst“ (Damasio, 2013, s. 169). In seinem Buch The feeling of what happens. Body and emotion in the making of consciousness. (Deutsche Übersetzung: Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins, (Damasio, 1999)) beschreibt er drei Niveaus, die dazu beitragen. Seiner Theorie nach entsteht ein „Gefühl von uns selbst“, wenn das Gehirn registriert, dass unser innerer körperlicher Zustand sich verändert dadurch, dass wir ein Signal von außen erfassen oder etwas im Körper passiert. Das Gehirn registriert und verarbeitet diesen Reiz mithilfe von Aktivitäten in verschiedenen Bereichen des Gehirns. So entsteht ein zweites Gefühl, nämlich das Gefühl, dass „etwas passiert ist“.
Das Merkwürdige ist, dass unser Gehirn uns eine Erfahrung von einem Selbst gibt, das etwas erfährt. Damasio erklärt das durch die Gehirnzentren, die gleichzeitig den inneren und den äußeren Körperzustand überwachen und auch das, was der Körper gerade tut. Diese doppelte Erfahrungsmöglichkeit erschafft unser komplexes Selbsterleben. Normalerweise kriegen wir davon nicht so viel mit. Aber, wenn wir bewusst unsere Aufmerksamkeit darauf richten, können wir es leicht wahrnehmen.
„Das Bewusstsein entsteht dadurch, dass das Gehirn die Fähigkeit hat, wortlos die Geschichte unseres Lebens zu erzählen“, wie es Damasio poetisch ausdrückt1.
Es gibt dem Elefanten ein Zuhause und gleichzeitig die ihm angemessene Bedeutung. Für mich war der Schlüssel, eine gemeinsame Sprache mit meinem inneren Elefanten zu finden, meine Gefühle besser wahrzunehmen und verstehen zu lernen. Gleichzeitig muss ich rational begreifen, was Gefühle eigentlich sind und was sie sollen. Ich muss mir selbst erklären und veranschaulichen, wie sie funktionieren und wozu sie da sind.
Damasios Theorie der Somatischen Marker2 zeigt wie die Entscheidungsfindung funktioniert. Anders herum gesagt: ohne die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden, können wir keine Entscheidungen treffen. Emotionen sind eine Bewertung der aktuellen Ereignisse und gleichzeitig eine Art, Informationen zu speichern und zu kategorisieren3.
Richard David Precht hat eine griffige Antwort auf diese Frage und gibt auch eine weiterreichende Erklärung: „Leiden, Triebe, Instinkte und Affekte haben eine große biologische Bedeutung. Sie dienen dem Überleben des einzelnen Menschen und helfen dem Zusammenhalt in der Gruppe. Egal, ob es sich um Hunger, Schlaf- oder Wärmebedürfnis handelt, um Flucht oder Angriff oder Sex – immer gelten für die elementaren Gefühle nur zwei Dinge: Entweder strebe ich nach etwas oder ich möchte etwas vermeiden. Und das gilt nicht nur für äußere Erlebnisse. Auf der einen Seite helfen mir die Emotionen auf angemessene Weise auf einen äußeren Reiz zu reagieren, auf der anderen Seite sorgen sie dafür, meinen inneren Zustand zu regulieren.“ (Precht, 2009, s. 67). Wir können Gefühle also gut mit einer Signallampe vergleichen. Die Signallampe macht uns auf etwas aufmerksam („Tank ist bald leer“) und hilft uns, für Gleichgewicht zu sorgen (vgl. Wahrnehmen und Bewerten von Gefühlen s. → und Vom Umgang mit inneren Kritiker s. →).
Aber, wie verhält es sich mit den Gefühlen in Relation zu unserem Ich? Oft hat sich mein innerer Elefant die Macht genommen, er trampelt einfach los. Precht schreibt hierzu: „Es ist nicht leicht, die Gefühle zu kontrollieren, es ist eher so, dass sie uns kontrollieren. Genauso wenig wie wir das Gehirn nur als ein Werkzeug ansehen können, sondern dass wir selbst praktisch eine Art Zustand in unserem Gehirn sind, so gilt hier ähnliches: Auf eine gewisse Art und Weise sind wir unsere Gefühle“. (Precht, 2009, s. 67). Diese Formulierung gefällt mir: wir sind unsere Gefühle. Wer schon einmal einen tobenden Zweijährigen vom Spielplatz weggetragen hat, hat sofort ein Bild vor Augen. „Katrin wir gehen jetzt“ sagte ich zu ihr einmal, als ich nur mit ihr unterwegs war. Es war einer der ersten warmen Frühlingstage. „NEIN! Mehr pielplaz!“ schrie sie, der ganze kleine Körper bebte, kochte, als sie aufstampfte, um ihren Worten mehr Gewicht zu verleihen. Ich hatte keinen Wagen dabei, also konnte ich sie nur tragen. Was mir so deutlich in Erinnerung geblieben ist, ist wie das ganze Kind das Gefühl war. Von Kopf bis Fuß. NEIN! Leider war es ein Termin, der entschied, dass wir nicht länger bleiben konnten.
Wer entscheidet bei uns? Ich, der Mahut oder mein innerer Elefant? Es ist wohl unterschiedlich, situationsabhängig. Gleichzeitigt frage ich mich, warum man über Macht und Kontrolle reden muss. Denn das impliziert sofort eine Hierarchie, einer steht oben und der andere unten. Wir sind unsere Gefühle. Warum können wir nicht in Harmonie mit ihnen sein? Warum Kontrolle, Macht und Unterdrückung? Kann man Elefant und Mahut eigentlich trennen?
Selbstwert und Selbstgefühl
Mahut und Elefant vertrauen einander nicht. Mein innerer Elefant vertraut mir nicht und ich ihm nicht. Wie soll er denn auch, frage ich mich dann? Diese Frage führt auf den Weg der Selbstanschuldigungen, und das bringt mich nicht weiter.
Ich denke weiter darüber nach. Der Mahut bringt gegenüber dem Elefanten oft sehr wenig Wertschätzung. Wenn ich diesen Gedanken festhalte, und Mahut und Elefant wie in einer mathematischen Gleichung ersetze, komme ich auf den Begriff des Selbstwert oder der Selbstwertschätzung. Früher einmal habe ich versucht, den Begriff Selbstwert zu fassen. Ich hatte ein Gedankenspiel versucht, jede Stunde eine Zahl aufzuschreiben, eine Summe Geld, die ich für mich selbst bezahlen würde. Ich habe mir schon oft gewünscht, dass dieses Gefühl sich mal deutlich ausdrücken und mir eine gescheite Summe nennen könnte, so dass ich mein Selbst verkaufen und mir ein neues zulegen könnte: Weniger nörgelig, endlich zufrieden. Weniger zappelig, endlich mehr Durchhaltevermögen. Weniger ängstlich, endlich tun und einfach tun. Das wäre einfach und schön. Auf diese Weise funktioniert das aber nicht. Es zeigt auch die Begrenzungen in meinem alten, verkopften Denken.
Aber Spaß beiseite. Wie definiert sich mein Wert? Ich habe versucht das aufzudröseln: Also ich arbeite und bekommen einen Monatslohn. Den kann ich herrunterrechnen auf einen Stundenlohn. Ich bin Ehefrau und Mutter. Für diese komplexen Rollen liegen keine Zahl bei der Hand. Es lassen sich jedoch Aufgaben und Rollen aufzählen, die ich erfülle: Gesprächspartnerin, Zuhörerin, Spielkameradin, Trösterin, Essenmacherin, Aufräumerin, Einkäuferin. Die Liste ist lang. Eine Stimme in meinem Kopf schreit auf während ich weitere Rollen aufliste: "Aber das könnte ja auch jemand anderes machen!" Stimmt. Bei meinem Arbeitsplatz wird es noch deutlicher, wie austauschbar ich bin. Nehmen wir an ich kündige und die Firma stellt jemand Neues ein, plop! Aber stimmt auch nicht.
All das beschreibt das Äußere. Trotzdem hat die Stimme nicht vollkommen Recht: Als enge Freundin, Partnerin und Mutter könnte jemand anderes wohl kaum meinen Platz einnehmen.
Wenn ich in mich hineinfühle, kann ich ein Theaterensemble voller Figuren entdecken. Da ist ein kleines Mädchen, der rebellische Teenager. Der eiserne General, der mich immer zu neuen Aufgaben antreibt. Der faule Schweinehund, der Schokolade und Sofas liebt. Und vieles mehr gibt es in diesem Universum. Es ist zart und zerbrechlich, unbekannt und gleichzeitig so nah und vertraut. Komplex und kompliziert, miteinander auf das Engste vernetzt.
Ich möchte den Begriff Selbstwertgefühl neu verhandeln. Es soll nicht darum gehen, dass ich mich selbst mit anderen vergleiche, mich analysiere, hier und jetzt eine Inventur mache, zähle und aufschreibe: welche guten Eigenschaften kann ich finden? Was kann ich dafür bekommen? Es soll kein Gefühl sein, dass bewertet, auf mein Selbst ein Preisschild klebt und es auf den Ladentisch legt. Zahlen sind hier nicht hilfreich. Denn dann fällt mir meistens als erstes auf was ich nicht kann, was ich nicht geschafft habe, wo ich nicht gewonnen habe.
Was aber möchte ich am liebsten in den Begriff Selbstwertgefühl packen? Wie möchte ich ihn verstehen? Eva Wlodarek findet, dass Selbstwertgefühl sehr dynamisch sein kann. „Was Selbstwert bedeutet erklärt bereits das Wort: es geht um den Wert, den wir uns selbst beimessen. [...] Festgeschrieben ist der Selbstwert keineswegs. Ein niedriges Selbstwertgefühl lässt sich durch positive Erfahrungen erhöhen, ein ursprünglich hohes Selbstwertgefühl kann durch äußere Umstände verringert werden.“ (Wlodarek, 2019, s. 83)
Das Gefühl für meinen Wert darf gerne dynamisch sein. Ich möchte wertvoll werden in mir, und ein Gefühl dafür entwickeln. Vor allem möchte ich ein stabiles Grundgefühl in mir haben, ein Fundament, das nicht einfach verschwindet und in den Keller fällt. Ein dickes Kissen aus Vertrauen in mich.
Ich wünsche mir eine Beziehung zwischen Mahut und Elefant, die tierschutzgerecht ist und harmonisch. Dass der Mahut den Elefanten verstehen lernt, ihn fühlen lernt und ihn nicht mehr schlagen wird. Der Mahut darf nicht mehr mit all seinem Gewicht im Nacken des Elefanten sitzen.
Mia Törnblom (Törnblom, 2011, s. 29) findet eine deutliche Unterscheidung: Das Selbstbewusstsein ist das, was wir sind und das Selbstwertgefühl ergibt sich aus dem, was wir tun. Sie stellt fest, dass es problematisch wird, wenn wir diese beiden Positionen verwechseln: Wenn ich glaube, dass ich nur das bin, was ich tue, dann habe ich nicht nur einen Fehler gemacht, sondern dann bin ich im schlimmsten Fall auch der Fehler.
Sie ist der Überzeugung, dass sich das Selbstwertgefühl wie ein Muskel trainieren lässt (Törnblom, 2011, S. 108). Sie spricht von innerem und äußerem Training. Übungen, wie das gute Buch (27), Meditationen und Affirmationen sollen dabei helfen. Man beginnt dort, wo man steht. Alle Menschen sind unterschiedlich und haben eine unterschiedliche Geschichte.
Petra Krantz Lindgren (Lindgren, 2019) gibt dem Begriff Selbstwertgefühl zwei Dimensionen: zum ersten das, worüber ich mir selbst bewusst bin, eine Art Selbstgefühl: meine Fähigkeiten, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Bedürfnisse, meine Gelüste und meine Träume. Wenn ich mich also als ein geschlossenes Universum betrachte, umfasst dieses Selbstgefühl alles, was in mir ist: Mit meinen Stärken und Schwächen, mit allem, worauf ich gerade Lust habe und was ich nicht mag. Abstrakt gesagt, enthält dies also eine Bestandsaufnahme meiner Selbst und verschwimmt ein bisschen mit dem Begriff „Selbstbewusstsein“.
Die zweite Dimension handelt davon, welche Akzeptanz ich gegenüber dem habe, was ich von mir selbst wahrnehme. Hier mache ich eine Bewertung meiner Außenwirkung und meines Potenzials. Das Idealbild ist ein ganz gesundes Selbstwertgefühl. Die betreffende Person akzeptiert sich, mag sich, genau wie sie ist, fast immer. Man muss sich nicht verändern und verbiegen, um von anderen und vor allem sich selbst gemocht zu werden.
Das Ideal des gesunden Selbstwertgefühls kann im Übertriebenen auch negativ werden: Selbstkritik ist ein Weg zu Veränderung und Wachstum. Eine Abwesenheit von Selbstkritik macht uns selbstverliebt, statisch und blind. Natürlich bewerten wir Situationen, unser eigenes Handeln, unsere Reaktionen. Je nach Lebenssituation können sich auch Änderungen ergeben. Bewertungen können sich verschieben, in Frage gestellt oder gar verworfen werden. Das sollte aber das stabile „Fundamentsgefühl“ in uns selbst nicht ins Wanken bringen.





























