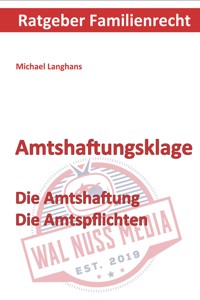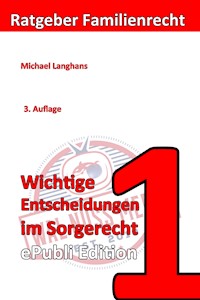
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Ratgeber kann man jedem Richter im Gerichtssaal die richtigen Textpassagen aus den maßgeblichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs, des Europäi- schen Gerichtshofs für Menschenrechte und von Oberlandesgerich- ten entgegenhalten: Relevant, auf den Punkt gebracht, prägnant. Dies ist die 3, erheblich überarbeitete und erweitere Auflage mei- nes 2016 erschienenen Buches. Sorgerechtsverfahren, insbesondere Inobhutnahmen durch das Jugendamt sind die Materie, die Eltern am stärksten belasten: Der Kampf um das eigene Kind, gegen den Staat... Man fühlt sich hilflos und wird bisweilen unzureichend beraten. Anwälter und Richter reden eine Sprache, die man nicht versteht. In diesem Ratgeber lernen Sie das Wichtigste kurz und knapp in einfacher Sprache erläutert. Knapp 20 neue Textstellen und Entscheidungen sind mit aufge- nommen und haben das Buch nochmal erheblich erweitert. Insgesamt sind nun 57 Entscheidungen und Textstellen vorhanden. Erweitert wurde der Bereich Umgang. Neu eingefügt sind auch Entscheidungen zum Wechselmodell. Die Epubli Edition erhält zwei Extrakapitel sowie drei Kapitel der Biographie "Robenlos" aus dem Familienrecht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wichtige Entscheidungen im Sorgerecht ePubliEdition
Titel SeiteWidmungEinleitung 3. Auflage1. Sorgerecht Allgemein2. Sorgerecht3. Was nicht zum Sorgerechtsentzug reicht4. Verhältnismäßig und geeignet5. Rückführung6. Entscheidungen zur Begutachtung7. Umgang und Vormundschaft8. Wechselmodell9. Kind trotzdem weg – was tun?10. Robenlos - Erinnerungen aus meiner Zeit als RechtsanwaltWerbung Ratgeber FamilienrechtTitel Seite
Wichtige Entscheidungen im Sorgerecht - ePubliEdition
Ratgeber Familienrecht #1 – Wichtige Entscheidungen im Sorgerecht - ePubliEdition - 3. Auflage 2020
Impressum:
© Copyright 2020 Wal Nuss Media, Krefeld
Alle Rechte der Veröffentlichung und Verbreitung, per Druck oder Digital, der Vermarktung per Social Media und Video, liegen beim Verlag.
Die Rechte am Text liegen beim jeweiligen Autor.
3. Auflage 2020
Verlag:
Wal Nuss Media, Inhaber Michael Langhans, Bleichpfad 76, 47799 Krefeld
Autor und Rechteinhaber der Texte: Michael Langhans
Das Werk einschließlich von Teilen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Widmung
Für meine Frau
der ich alles verdanke
Einleitung 3. Auflage
Einleitung zur 3., erweiterten und überarbeitete Auflage
Sorgerechtsverfahren sind diejenigen, die Menschen am Stärksten belasten: Wenn (frühmorgens) die Polizei klingelt und der Gerichtsvollzieher die Kinder mitnimmt, ist dies für alle Beteiligten eine traumatisierende Erfahrung. Wir kennen die Bilder, die sich auf YouTube und in Nachrichtensendungen wiederholen: Schreiende Kinder, überforderte Beamte und schweigende Jugendamtsmitarbeiter. Kaiserslautern, Helbra, all diese Szenerien werden wir nie vergessen, die aber nur Dank Videoaufnahmen überhaupt die Öffentlichkeit erreicht haben.
Wenn der Fall eingetreten ist, dann gilt es, schnellstmöglich die Kinder dorthin zurückzuholen, wo es ihnen am Besten geht: Zu den Eltern, nach Hause. Wenn der Fall bevorsteht, ist es besser schnellstmöglich gegenzusteuern.
Doch wie gegen den Beschluss des Gerichtes vorgehen?
Dieses Buch soll nicht die kompetente juristische Beratung ersetzen, aber häufige rechtliche Fehler (auch in der anwaltlichen Beratungspraxis) anhand von höchstrichterlicher Rechtsprechung aufzeigen. Die wichtigsten Entscheidungen, die man in beinahe jeder Sorgerechtsentscheidung benötigt, werden aufgezeigt, zitiert und kritisch erläutert. Betroffene Eltern sollen so in die Lage versetzt werden, rechtliche Rahmenbedingungen zu erfahren. Mit diesem Buch soll in einem gerichtlichen Verfahren alles an Basiswissen vorhanden sein, das man benötigt, um dem gegnerischen Anwalt, dem Gericht oder dem Jugendamt ausreichend fundiert erwidern zu können.
Dies heißt freilich nicht, dass damit jeder Fall bereits gewonnen ist. Aber rechtliche Argumente fernab der emotionalen Belastung zu haben ist ein wichtiger Schritt nach vorne.
Freilich ist es mir bereits untergekommen, dass diese Argumentation anhand (bindender!) Verfassungsrechtsprechung von einer Richterin in München als „Kräftemessen mit dem Gericht“ bezeichnet wurde. Das kann man so sehen, wirft aber kein wirklich gutes Licht auf die Arbeitseinstellung mancher Richter. Natürlich ist damit auch noch nicht das Problem von Falschbehauptungen von Nachbaren oder Lehrern, Falschaussagen von Familienhelfern und Falschgutachten von sogenannten Experten aus der Welt geschaffen. Zwar werde ich auch hierzu einen Teil meines zwölfjährigen Erfahrungsschatzes beisteuern, aber hier ist das Vorgehen individuell zu bestimmen.
Anwaltliche Unterstützung ist daher immer eine gute Wahl.
Ich hoffe gleichwohl mit diesem Werk ein wenig helfen zu können, damit rechtliche Zusammenhänge und Regeln verständlicher werden und damit häufige Fehler, oft aus Bequemlichkeit geboren, schnell erkannt und gegebenenfalls beseitigt werden.
In dieser Ausgabe sind einige neue Entscheidungen eingefügt sowie die bisherigen Begründungen überarbeitet und besser verständlich formuliert. Knapp 20 neue Textstellen und Entscheidungen sind mit aufgenommen und haben das Buch nochmal erheblich erweitert. Insgesamt sind nun 57 Entscheidungen und Textstellen vorhanden.
Diese ePubli Edition ist mit exklusiven Inhalten ausgestattet, zwei zusätzliche Kapitel und drei Kapitel aus meiner Autobiographie „Robenlos“.
Krefeld, im April 2020
Michael Langhans
1. Sorgerecht Allgemein
1.1. Das Sorgerechtverfahren
Das Sorgerechtsverfahren ist eigentlich recht einfach aufgebaut. Es gibt nur eine handvoll Paragraphen, eine Handvoll Entscheidungen. Nur diese muss man kennen - als Richter, Anwalt, Jugendamtler. Natürlich gibt es da noch eine Handvoll Verhaltensweisen und Verfahrensnormen. Und ein wenig Psychologie und Pädagogik. Und trotzdem ist das meiste recht übersichtlich und einfach.
Zudem besteht die sogenannte Amtsermittlungspflicht. Im normalen Zivilprozess gilt das Darlegungsprinzip, nur das, was vorgetragen und unter Beweis gestellt ist, muss und darf der Richter berücksichtigen.
Im Familienverfahren ist dies anders. Dort muss der Richter selbst alle notwendigen Beweise erheben und ermitteln, bis er zu einem Ergebnis kommt. Man muss keine Beweisanträge stellen, man muss auch keine Anträge stellen. Diese vermeindliche Arbeitserleichterung für Betroffene führt aber oft dazu, dass sich Anwälte blind hierauf verlassen und nur das nötigste Schreiben. Es sei tunlichst jedem angeraten, soviel Beweisanträge wie möglich, und zwar in einer formellen Form angelehnt an den strafrechtlichen Beweisantrag zu stellen, damit die Hürden für das Gericht, diese Anträge nicht zu beachten, hoch sind. Man benennt also
Beweistatsache
„Zum Beweis der Tatsache, dass ich mein Kind nicht geschlagen habe am 01.01.2020“,
Zeugenmittel
„benenne ich Michael Langhans als Zeuge”,
Inhalt
„der Zeuge Langhans wird belegen, dass es am 01.01.2020 zwischen 10 Uhr und 14 Uhr anders als vom Jugendamt geschildert keinen Streit und keine tätliche Auseinandersetzung gab”
und warum dies für das Verfahren relevant ist
„damit wird die anonyme Aussage des Jugendamtes widerlegt”,
„die Aussage des Kinderarztes beweist, dass keine Kindswohlgefährdung vorliegt”,
“die Behauptungen des Kindsvaters werden damit als falsch belegt”.
Die Verfahren im Sorgerechtsbereich können vom Gericht von Amts wegen eingeleitet werden (wenn es von Gefahren für ein Kind erfährt), auf Anregung oder Antrag eines Elternteils/beider Eltern oder von einem Dritten, insbesondere dem Jugendamt.
Das Gericht kann sowohl quasi sofort in einer einstweiligen Anordnung entscheiden oder in einer Hauptsache. Erstere fordert geringeren Beweismaßstäbe, geringere Beweiswahrscheinlichkeiten. Letztere fordert zwar auch nicht den Vollbeweis einer Gefahr für das Kind, es reichen hier gewisse Wahrscheinlichkeiten. Trotzdem sollte Eure Strategie darauf angelegt sein, jeden Beweis zu entkräften, und zwar vollständig.
Ich würde immer Beweisurkunden vorlegen, also schriftliche Zeugenaussagen, da solche Beweismittel berücksichtigt werden müssen, während über eine Zeugenanhörung das Gericht entscheidet.
Klassisches Beweismittel ist das Sachverständigengutachten zu der Frage, welche Entscheidung dem Kindeswohl am Besten dient. Hier solltet ihr sorgfältig die Beweisfrage prüfen, ob diese ergebnisoffen ist. Der Sachverständige muss sich an den Beweisbeschluss halten, er kann niemals darüber hinaus gehen.
An einem Gutachten muss man nicht teilnehmen. Denn hierzu, für eine solche Pflicht, gibt es keine gesetzliche Grundlage. Trotzdem gibt es Fälle, in denen man an einem Gutachten nur schwer vorbeikommt: Wenn Eltern über ein Kind streiten, muss der Richter entscheiden, wo es dem Kind besser gehen wird.
Dies ist zwar grundsätzlich auch ohne ein Gutachten möglich, aber das Gutachten ist für einen Richter schön bequem: Das Verfahren löst sich quasi von alleine.
Auch wo es Beweise für Misshandlungen gibt, mag ein Gutachten die Möglichkeit sein, diese Vorwürfe für die Zukunft zu entkräften.
Kämpft man gegen das Amt, ist es wichtig, dass Eltern zusammenhalten. Denn wenn sich Eltern untereinander streiten, freut sich in der Regel das Jugendamt als Drittes. Da werden Türen für Inobhutnahmen geöffnet, die vorher nicht da waren. Also Vorsicht! Wenn sich zwei streiten, kann es sein, dass am Ende beide Eltern ohne Kind dastehen.
Das FamFG Verfahren ist einfach strukturiert: Hauptsache endet mit Beschluss, dagegen gibt es die Beschwerde. Eine Revision ist nur möglich, wenn vom OLG zugelassen.
Für das Beschwerdeverfahren ist das Oberlandesgericht zuständig und trotzdem gibt es keinen Anwaltszwang - im Sorgerecht.
Nach der Beschwerde stehen nur noch die Wege zum BVerfG und danach dem EGMR offen oder zur UN.
Im einstweiligen Verfahren um das Sorgerecht (nicht bei Umgang!) kommt es drauf an, ob das Gericht ohne Anhörung oder mit entschieden hat. Nach Anhörung der Eltern entscheidet es per Beschluss und es bleibt in Sorgerechtssachen die Beschwerde zum OLG. Entschied es ohne Anhörung, muss diese auf Antrag nachgeholt werden, danach kann ggf. Beschwerde erhoben werden. Das Gesetz sieht vor, dass das Gericht über die Rechtsschutzmöglichkeiten aufklärt, aber das geschieht oft genug falsch.
Das Kind hat ab 14 Jahren eigene Rechte. Es kann einen eigenen Anwalt beauftragen und am Verfahren teilnehmen. Sein Wille ist ein gewichtiges Argument. Hierüber werden Kinder selten aufgeklärt. Auch für kleinere Kinder können Eltern einen Anwalt dem Kind besorgen, dann ist man nicht von den vom Gericht benannten Verfahrensbeistand abhängig, der vielleicht dem Richter gefallen will. Ich habe es in der Vergangenheit erlebt, dass Verfahrensbeistände keine neuen Aufträge bekamen, weil sie anderer Meinung als der Richter/die Richter waren. Statt also einen Beistand ablösen zu lassen, ist es einfach einen eigenen Anwalt zu besorgen. So löst man das Problem der Voreingenommenheit elegant.
Man kann beinahe jederzeit eine Abänderung einer falschen oder richtigen Entscheidung beantragen. Freilich muss man schon eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse belegen, es reicht nicht aus mit der bisherigen Entscheidung unzufrieden zu sein. Freilich kann eine solche Änderung auch neue Beweismittel sein, die in der Vergangenheit übersehen wurden oder falsch bewertet wurden. Inzident muss dann auch der alte Beschluss geprüft werden. Das wollen Richter aber ungern tun. Hier muss man am Ball bleiben.
Entscheidungen hat der Gerichtsvollzieher auf Auftrag des Gerichtes zu vollstrecken, nicht das Jugendamt. Daher darf auch die Polizei nur unterstützen, nicht ein Kind angreifen. Wir alle kennen die Videos, in denen das nicht eingehalten wird. Das ergibt sich aus den Landespolizeirechten. Denn erstens ist Amtshilfe nur möglich, wenn die Behörde (hier die Justiz) selbst personell nicht in der Lage zur Klärung ist (Justizwachtmeister). Zweitens ist nun mal nach dem Gesetz der Gerichtsvollzieher der vollstreckende. Und drittens ist leider auch die Polizei nicht in der Lage, ein Kind schonend mitzunehmen, dazu bräuchte es wenn dann Pädagogen oder Psychologen.
Formell müssen Beschlüsse zugestellt werden, vor Wirksamkeit und in manchen Fällen auch erst danach. Gewalt gegen Eltern und das Kind muss ebenso genehmigt werden wie Betreten eines oder mehrerer Häuser. All das sind Fehlerquellen, die passieren. Das Kind muss dem Ergänzungspfleger ausgehändigt werden, ist der nicht da darf das Kind nicht weggenommen werden. Teils gibt es hier landesspezifische Regeln, die vorgehen.
Obwohl das Sorgerecht einfach ist, steckt der Teufel im Detail. Im Zweifel nehmt einen guten Juristen. Und hütet Euch vor allzu tollen Beratern, die ohne irgendeine Qualifikation die Hand aufhalten.
Natürlich sind mancherlei Berater gut, aber einige eben auch nur Schaumschläger, die mehr schaden als nutzen. Was nichts kostet, ist auch nichts wert, sagt man in meiner bayrischen Heimat. Wer also kein Geld investieren will, in die Rückholung seiner Kinder, hat schon fast verloren.
Denn es gibt viele Möglichkeiten und Unterstützungen für Eltern, ich erinnere hier nur an das Elternschutzkonzept, das Activinews begründet hat. Aber wenn sich Profis eben engagieren, kostet das eben auch – wie bei Waschmaschinenreparaturen und Co.
1.2. Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen finden sich im Grundgesetz (GG), der UN Kinderrechtskonvention (Übereinkommen über die Rechte des Kindes), der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über Verfahren in Familiensachen (FamFG) und auch dem SGB VIII (Jugendhilferecht). Bei Behinderungen ist ggf. noch auf die UN Behindertenkonvention abzustellen.
Nur wenigen Paragraphen und Normen regeln, ob und wie der Staat in Familien eingreift. Eigentlich also ein überschaubarer Rechtsbereich, der einfach zu handeln wäre.
Wenn die einfach gesetzlichen Regeln oftmals wenig aussagekräftig sind, finden sich Erklärungen und Erläuterungen oft in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts.
Während also die einfach gesetzlichen Regelungen und das Grundgesetz durch ihre Allgemeinheit dem Richter eine Möglichkeit an die Hand geben, viele Möglichkeiten der Interpretation zuzulassen, grenzen diese genannte Rechtsprechung den Richter wieder erheblich ein, weshalb dieses Buch sich hauptsächlich mit dieser entscheidenden Rechtsprechung auseinandersetzt. Das ändert aber nichts daran, dass zur Rechtsanwendung auch der relevante Gesetzestext gekannt werden muss:
Art 6 GG:
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
Art. 6 des Grundgesetzes ist die Grundlage aller anderen Regelungen der elterlichen Sorge. Auf ihn muss jede Gesetzesanwendung und jede einfach gesetzliche Regelung zurückzuführen sein. Jede Regelung oder Entscheidung, die Familie nicht besonders schützt und insbesondere nicht den Eltern das natürliche Recht auf Pflege und Erziehung zugebilligt, ist verfassungswidrig. Es heißt natürlich nicht, dass diese Rechte schrankenlos zugebilligt würden. Dies heißt aber, dass der Regelfall davon ausgeht, dass Eltern Kinder erziehen und hierzu auch in der Lage sind. Weil die Gemeinschaft hier überwacht, kann man hieraus schließen dass nur bei Verstößen gegen diese Erziehung der Kinder zu deren Wohl den Staat zum Handeln legitimiert.
Weiter erfolgt die Ausgestaltung dieser verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere im bürgerlichen Gesetzbuch.
§1626 BGB
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.
§1631 BGB
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.