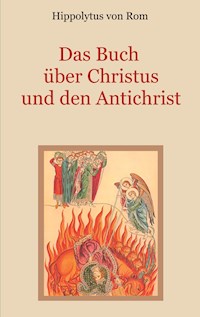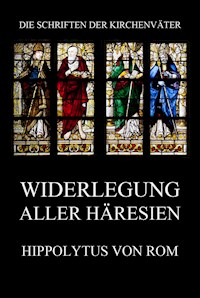
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Die Schriften der Kirchenväter
- Sprache: Deutsch
Die "Widerlegung aller Häresien", auch "Elenchus" oder "Philosophumena" genannt, ist ein umfassendes christliches polemisches Werk aus dem frühen dritten Jahrhundert. Es katalogisiert sowohl heidnische Glaubensvorstellungen als auch 33 gnostische christliche Systeme, die als häretisch gelten, und ist damit eine wichtige Informationsquelle für die zeitgenössischen Gegner der katholischen Orthodoxie. Das erste Buch, eine Synopse der griechischen Philosophie, zirkulierte separat in mehreren Manuskripten und war als "Philosophoumena" bekannt, ein Titel, den einige auf das gesamte Werk ausdehnen. Die Bücher IV-X wurden 1842 in einem Manuskript auf dem Berg Athos wiedergefunden, während die Bücher II und III verloren sind. Das Werk wurde lange Zeit dem frühchristlichen Theologen Origenes zugeschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Widerlegung aller Häresien
HIPPOLYTUS VON ROM
DIE SCHRIFTEN DER KIRCHENVÄTER
Widerlegung aller Häresien, Hippolytus von Rom
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849660635
Cover Design: Basierend auf einem Werk von Andreas F. Borchert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35892522
Der Text dieses Werkes wurde der "Bibliothek der Kirchenväter" entnommen, einem Projekt der Universität Fribourg/CH, die diese gemeinfreien Texte der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Die Bibliothek ist zu finden unter http://www.unifr.ch/bkv/index.htm.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Buch I.2
Buch IV.22
Buch V.55
Buch VI.92
Buch VII.128
Buch VIII.151
Buch IX.162
Buch X.182
Fußnoten. 202
Widerlegung aller Häresien
Bibliographische Angaben:
Titel Version: Widerlegung aller Häresien (BKV) Sprache: deutsch Bibliographie: Widerlegung aller Häresien (Refutatio omnium haeresium) In: Des heiligen Hippolytus von Rom - Widerlegung aller Häresien. Aus dem Griechischen übersetzt von Dr. Theol. Graf Konrad Preysing. (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 40) München 1922. Unter der Mitarbeit von: Ursula Schultheiß und Rudolf Heumann.
Buch I.
Inhalt
Der Inhalt des ersten Buches der Widerlegung aller Häresien ist folgender:
Die Namen und die Lehren der Naturphilosophen, die der Ethiker und die der Dialektiker.
Naturphilosophen sind Thales, Pythagoras, Empedokles, Heraklitus, Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Archelaos, Parmenides, Leukippos, Demokritus, Xenophanes, Elephantos und Hippo.
Ethiker sind Sokrates, der Schüler des Naturphilosophen Archelaos, und Plato, des Sokrates Schüler. Plato vereinigt die drei Fächer der Philosophie.
Dialektiker ist Aristoteles, Platos Schüler; er schuf ein System der Dialektik; Stoiker sind Chrysippos und Zeno.
Epikur arbeitete ein fast allen anderen Philosophen entgegen gesetztes Lehrsystem aus.
Der Akademiker Pyrrho; er lehrte die Unbegreiflichkeit aller Dinge.
Die Brahmanen bei den Indern, die Druiden bei den Kelten und Hesiodos.
Man darf keine von den Lehren, die bei den Griechen in Geltung sind, mißachten. Denn selbst ihre unwissenschaftlichen Anschauungen erscheinen noch wahrscheinlich, wenn man sie mit der grenzenlosen Tollheit der Häretiker vergleicht, die nur durch Verschweigung ihrer Geheimnisse sich den Ruf der Gottesfurcht erhalten. Ihre Lehrsätze haben wir schon früher1 dargelegt, sie aber, ohne in Einzelheiten einzugehen, nur obenhin widerlegt; denn wir hielten es nicht für angezeigt, ihre Geheimnisse ans Licht zu ziehen; wir hofften, sie würden sich schämen, wenn wir andeutungsweise ihre Anschauungen berührten, und würden ihre unvernünftigen Ansichten und ihr unrechtes Beginnen aufgeben aus Furcht, wir könnten ihre Geheimnisse ganz bloßlegen und sie so der Gottlosigkeit überführen. Doch sie achten meine Rücksicht nicht, noch bedenken sie, daß Gott nur darum ihre Lästerungen mit Langmut erträgt, damit sie sich schämen und bekehren oder damit sie als Verstockte ihr gerechtes Urteil erhalten. So gehe ich denn notgedrungen weiter und enthülle die Geheimnisse, die sie ihren Jüngern mit großer Überzeugungskraft anvertrauen; doch darf sie keiner inne werden, bevor sie ihn nicht lange Zeit in Spannung gehalten, zum Gotteslästerer herangebildet und sich ganz unterwürfig gemacht haben und er dann vor Neugierde nach ihren Aufschlüssen brennt. Wenn sie dann überzeugt sind, er sei in die Sünde verstrickt, eröffnen sie ihm den Abgrund der Verworfenheit, weihen ihn ein und verpflichten ihn eidlich, nichts auszusagen oder einem anderen mitzuteilen, wenn sich dieser nicht gleichfalls knechten läßt; ergibt er sich nur einmal, dann war der Eid freilich nicht nötig. Denn wer wirklich ihre tiefsten Geheimnisse über sich ergehen läßt und erlernt, der ist durch diese Tatsache selbst auf Grund seines Schuldbewußtseins gebunden, anderen gegenüber zu schweigen. Denn wenn er einem Menschen dies zügellose Treiben verriete, würde er nicht mehr zu den Menschen gerechnet werden und wert gehalten werden, das Licht zu schauen, [er stünde unter]2 dem unvernünftigen [Tier]3, das solche Frevel, von denen am einschlägigen Ort die Rede sein wird, nicht wagt. Da wir nun aus zwingenden Gründen in eine abgrundtiefe Untersuchung uns einlassen, so wollen wir nichts verschweigen, vielmehr die Lehren aller ausnahmslos darstellen. Wir wollen die Untersuchung, so lang sie auch dauern mag, nicht aufgeben. Wir können den Menschen einen guten Schutz gegen den Irrtum bieten dadurch, daß sie die geheim gehaltenen Kulthandlungen der Häretiker klar sehen, die diese wie einen Schatz hüten und nur den Eingeweihten offenbaren. Es wird sie aber niemand anderer des Irrtums überführen als der in der Kirche gespendete Hl. Geist, den zuerst die Apostel empfangen haben und den sie dann den Rechtgläubigen mitteilten. Da wir als deren Nachfolger an derselben Gnade, Hohenpriesterwürde und Lehre teilhaben und zu den Hütern der Kirche gehören, so halten wir die Augen offen und verkündigen die wahre Lehre. Wir wollen, auch wenn wir mit allen Leibes- und Seelenkräften arbeiten müssen, nicht ermüden, sondern in würdiger Weise Gott, unserm Wohltäter, zu vergelten suchen; können wir ihm doch nicht anders in geziemender Weise danken als dadurch, daß wir in der uns anvertrauten Arbeit fortfahren, die uns zugemessene Zeitspanne ausnützen und die Gaben des Hl. Geistes allen neidlos mitteilen. Wir wollen nicht nur Irriges feststellen; es soll auch all das, was die Wahrheit durch die Gnade des Vaters empfangen und den Menschen dargeboten hat, klar gemacht, aus der Schrift bewiesen und rückhaltlos verkündet werden. Wir wollen also die Gottlosigkeit der Häretiker in ihrer Denkart, ihrem Charakter und ihrer Handlungsweise aufzeigen, sowie die Quellen, aus denen sie ihre Erfindungen schöpften. Sie sind ans Erfinden gegangen ohne Anlehnung an die Hl. Schrift, und ohne sich auf einen Heiligen berufen zu können; ihre Lehren stammen aus der Griechenweisheit, aus philosophischen Anschauungen, aus Mysterien4 und aus der Irrwege gehenden Astrologie. Wir legen also zuerst die Lehren der griechischen Philosophen dar und werden unsern Lesern beweisen, daß diese Lehren älter und Gottes würdiger sind als die der Häretiker; dann wollen wir die einzelnen Sekten miteinander vergleichen und sehen, wie sich die Sektenstifter über die griechische Philosophie hermachten, deren Grundlagen für sich verwerteten und immer tiefer sinkend ihre Lehre zusammenschmiedeten. Freilich ist dies Beginnen mühevoll und bedarf eingehender Forschung; doch wollen wir nicht nachlassen; später wird es uns Befriedigung gewähren, wie dem Wettringer der mühsam errungene Kranz, dem Kaufmann der trotz gewaltiger Seenot erzielte Gewinn, dem Landmann die mit vielem Schweiße eingeheimsten Früchte oder wie dem Seher die Erfüllung seiner Weissagungen nach erlittener Schmähung und Mißhandlung.
Wir stellen nunmehr die Frage, wer bei den Griechen zuerst Naturphilosophie gelehrt hat. Denn gerade von den Naturphilosophen haben die Sektengründer ihre Lehren gestohlen, wie wir durch Vergleichung feststellen werden. Dadurch, daß wir jedem sein geistiges Eigentum zuteilen, werden wir die Häresiarchen in ihrer schamlosen Nacktheit an den Pranger stellen.
1.
Thales aus Milet, einer der sieben Weisen, soll sich zuerst mit Naturwissenschaft befaßt haben. Er behauptete, Ursprung und Ende des Alls sei das Wasser; denn aus Wasser, sei es in festem, sei es in flüssigem Zustande, bestehe das Universum, und es schwebe auf dem Wasser; hievon kämen auch die Erdbeben, die Wechsel der Winde und die Bewegungen der Gestirne; alles sei in der Schwebe und im Flusse, wie es die Natur der ersten Werdensursache mit sich bringe; das, was weder Anfang noch Ende habe, sei Gott. Thales widmete sich auch der Lehre und der Forschung über die Gestirne und ist so für die Griechen der erste Begründer der diesbezüglichen Wissenschaft. Da er eines Tages zum Himmel hinaufschaute, um die Dinge oben genau beobachten zu können, wie er sagte, fiel er in einen Brunnen. Eine Magd, namens Thratta, lachte ihn aus und sagte: „Da er die Dinge am Himmel sehen will, übersieht er, was vor seinen Füßen ist.“ Thales lebte zur Zeit des Krösus.
2.
Ungefähr um dieselbe Zeit begründete Pythagoras, der Samier, wie ihn einige nennen, eine andere philosophische Schule. Man nannte sie die Italische, weil Pythagoras auf der Flucht vor dem Tyrannen von Samos, Polykrates, sich in einer Stadt Italiens niederließ und dort sein Leben beschloß. Seine Schüler blieben im allgemeinen bei seinen Anschauungen. Auch er forschte über naturwissenschaftliche Fragen und verband Astronomie, Geometrie, Musik und Zahlenkunde. Er bezeichnete die Einheit (Monas) als Gott, und auf Grund seiner Forschungen über das Wesen der Zahl behauptete er, der Kosmos gebe Klänge von sich und beruhe auf Harmonie; als erster schrieb er die Bewegung der sieben Gestirne dem Rhythmus und der Musik zu. Er wollte, daß seine Schüler aus Ehrfurcht vor der Weltordnung im Anfang Stillschweigen übten, da sie zur Welt gekommen seien, um sich in die Geheimnisse des Alls einweihen zu lassen. Wenn sie dann anscheinend hinreichend Unterricht genossen hatten und mit Sachkenntnis über die Gestirne und die Natur Forschungen anstellten, so erklärte er sie für rein und gestattete ihnen zu reden. Er teilte seine Schüler in zwei Klassen und nannte die einen Esoteriker, die andern Exoteriker. Erstere führte er in die vollkommenere Wissenschaft ein, letztere in die gewöhnliche. Er soll auch Magie getrieben haben und erfand die Physiognomik.
Indem er Zahl und Maß zugrunde legte, behauptete er, das Prinzip der Arithmetik begreife die Philosophie synthetisch folgendermaßen in sich: Prinzip ist die Urzahl, das Unbegrenzte nämlich und Unfaßliche; sie begreift alle Zahlenfülle in sich, die bis zum Unendlichen fortschreiten kann. Die erste Einheit ist wesenhaft das Prinzip der Zahlen; sie ist männlich und erzeugt nach Vaterart alle anderen Zahlen. Dann kommt die Zweiheit, eine weibliche Zahl, die von den Zahlenkundigen auch gerade genannt wird. Hierauf folgt die Dreiheit, eine männliche Zahl, die bei den Zahlenkundigen auch eine ungerade heißt. Zu all diesen kommt die Vierzahl, eine weibliche Zahl, die wiederum als weibliche gerade genannt wird.
Die sämtlichen Zahlen, nach ihrem Genus genommen — die Urzahl ist ihrem Genus nach unbestimmt — sind also vier; aus ihnen besteht die vollkommene Zahl, die Zehnzahl; denn eins, zwei, drei und vier ergeben addiert zehn, wenn jede Zahl ihren eigenen wesenhaften Namen (Wert) behält. Diese heilige Vierzahl, sagt Pythagoras, ist „die Quelle, die die Wurzeln der ewigen Natur“ in sich „enthält“, und diese Zahl ist das Prinzip aller Zahlen; denn die Zahlen elf und zwölf usw. hätten ihr Daseinsprinzip aus der Zehnzahl. Die vier Bestandteile der Zehnzahl, der vollkommenen Zahl, heißen: Zahl, Einheit, Quadrat, Kubus. Durch deren Verbindungen erfolgt Vermehrung und wird in der Natur die zeugungskräftige Zahl gebildet. Denn wenn das Quadrat mit sich selbst multipliziert wird, wird es Quadrat im Quadrat; wenn das Quadrat mit dem Kubus, wird es Kubus im Quadrat; wenn aber der Kubus mit dem Kubus, so gibt es Kubus im Kubus. So entstehen alle sieben Zahlen, aus denen das Werden quillt: Zahl, Einheit, Quadrat, Kubus, Quadrat-Quadrat, Kubus-Quadrat, Kubus-Kubus.
Pythagoras lehrte auch die Unsterblichkeit der Seele und die Seelenwanderung; dementsprechend sagte er von sich, er sei vor der trojanischen Zeit Äthalides gewesen, in der trojanischen Zeit Euphorbus, hierauf Hermotimos aus Samos, dann Pyrrhus aus Delos und an fünfter Stelle Pythagoras. Diodoros aus Eretria und der Musiker Aristoxenos berichten, Pythagoras habe den Chaldäer Zaratas5 aufgesucht; dieser habe ihm dargelegt, das Seiende habe von Anbeginn zwei Ursachen, Vater und Mutter; der Vater sei das Licht, die Mutter die Finsternis, die Teile des Lichtes seien das Heiße, das Trockene, das Leichte und das Schnelle, die Teile der Finsternis das Kalte, das Flüssige, das Schwere und das Träge; daraus bestehe die ganze Welt, aus Weib und Mann. Die Welt sei wesenhaft musikalische Harmonie, deshalb vollführe auch die Sonne ihre Umdrehung nach harmonischen Gesetzen. Bezüglich der Erden- und Weltdinge soll Zaratas gelehrt haben, es gebe zwei Gottheiten, eine himmlische und eine irdische; die irdische verursache das Wachstum aus der Erde; sie sei das Wasser; die himmlische sei das Feuer; es sei mit der Luft verbunden, Warmes mit Kaltem6. Somit beflecke oder vernichte keines dieser Dinge die Seele; denn sie seien das Wesen aller Dinge. Pythagoras hat, wie berichtet wird, verboten, Bohnen zu essen auf Grund des Ausspruches des Zaratas, daß die Bohne zu allererst, bei der Vermengung aller Dinge, beim Gerinnen und Zusammengären der Erde entstanden sei. Zum Beweise führt er an, daß, wenn man die Bohne mit den Zähnen enthülst und eine Zeitlang an die Sonne legt — diese übe dann gleich ihre Wirkung aus —, sie den Geruch menschlichen Samens von sich gebe. Ein anderer Beweis sei noch überzeugender, meint er; wenn man eine Bohnenblüte7 nimmt, in einen Topf legt und diesen verpicht in den Boden vergräbt und nach einigen Tagen öffnet, so sieht man, wie sie auf den ersten Blick die Gestalt etwa einer weiblichen Scham hat; bei genauerem Zusehen zeigt sich die eines frisch gebildeten Kinderkopfes.
Pythagoras starb den Feuertod zu Kroton in Italien zugleich mit seinen Schülern. Bei ihm war es Brauch, daß, wer zu ihm kam, um sein Schüler zu werden, sein Hab und Gut verkaufte und das Geld versiegelt bei ihm hinterlegte. Ein solcher hatte dann bald drei, bald fünf Jahre Stillschweigen zu halten und zu lernen. Nach Ablauf dieser Probezeit durfte er entweder weiterhin Schüler bleiben, an der Gesellschaft der anderen und am gemeinsamen Tisch teilnehmen, oder aber er erhielt sein Eigentum zurück und wurde entlassen. Die Esoteriker hießen Pythagoreer, die anderen (die Exoteriker) Pythagoristen. Aus dem Brande entkamen des Pythagoras Schüler Lysis und Archippos sowie sein Diener Zamolxis, der die keltischen Druiden die pythagoreische Philosophie gelehrt haben soll. Die Kenntnis der Zahlen und der Maße soll Pythagoras von den Ägyptern gehabt haben. Er empfing von der gut begründeten, blendenden und schwer zugänglichen Weisheit der ägyptischen Priester einen tiefen Eindruck, führte nach ihrem Vorgang Stillschweigen bei seinen Schülern ein und ließ sie in unterirdischen Räumen ein zurückgezogenes Leben führen.
3.
Auf die Schüler des Pythagoras folgte zeitlich Empedokles; er gab eine ausführliche Dämonologie, behauptete, die Dämonen seien sehr zahlreich und bewegten und lenkten die irdischen Dinge. Als Prinzipien des Alls bezeichnete er Haß und Liebe; das vernunftbegabte Feuer der Monade sei Gott, und aus Feuer bestehe alles, und alles werde im Feuer aufgelöst werden. Auch die Stoiker erwarten in Übereinstimmung mit dieser Auffassung den Weltenbrand. Am nachdrücklichsten von allen verfocht Empedokles die Seelenwanderung; er sagte:
„Knabe und Mädchen und Strauch bin ich vor Zeiten gewesen. Und auch Vogel, auch Fisch, der aus der Salzflut emportaucht.8
Nach ihm verwandeln sich die Seelen in alle möglichen Lebewesen; so behauptete ja auch Pythagoras, das Haupt dieser Schule, von sich, er sei Euphorbos gewesen, der gegen Troja zu Felde zog, und gab an, er kenne dessen Schild. Soviel also von Empedokles.
4.
Heraklitus, der Naturphilosoph, pflegte über alles zu weinen, klagte über die Rätselhaftigkeit des ganzen Lebens und die Unwissenheit der Menschen und war voll Mitleid mit dem Leben der Sterblichen. Von sich behauptete er, daß er alles wisse; die anderen wüßten nichts. Auch lehrte er ungefähr wie Empedokles, Zwietracht und Liebe seien das Prinzip aller Dinge, das vernunftbegabte Feuer sei Gott, alles sei in ständiger Bewegung und bleibe nie in Ruhe. Heraklitus teilte auch die Ansicht des Empedokles, all der Raum um uns sei voll des Bösen; es erstrecke sich aus den Erdenräumen bis zum Mond; weiter aber dringe es nicht, da der gesamte Raum über dem Mond ziemlich rein sei. Das waren die Ansichten des Heraklitus.
5.
Es traten dann noch andere Naturphilosophen auf, deren Anschauungen nicht von denen der Vorgenannten abwichen, so daß es überflüssig ist, sie anzuführen. Doch ist diese Schule an sich nicht unbedeutend, und es sind später Naturforscher daraus hervorgegangen, die auseinandergehende Ansichten über die Natur des Alls vertraten. So wollen wir denn nach Darlegung der Pythagoreischen Philosophie der Reihenfolge nach bis auf die Ansichten der auf Thales folgenden Denker zurückgehen. Wenn wir dies erledigt haben, wollen wir auf Ethik und Logik zu sprechen kommen. Begründer der Ethik war Sokrates, Begründer der Dialektik Aristoteles.
6.
Anaximander war also des Thales Schüler. Er war der Sohn des Praxiades aus Milet. Als Prinzip des Seienden bezeichnete er das Unendliche9, aus dem die Himmel und die Welten in ihnen entstanden seien. Dies Unendliche sei ewig und nicht alternd und umfasse alle Welten. Er sagt, es sei allen Dingen die Zeit ihrer Entstehung, ihres Daseins und Untergangs bestimmt10. Er hat also als Prinzip und Grundstoff des Seienden das Unendliche angegeben und zuerst die Bezeichnung „Prinzip“11 gebraucht. Ewig ist auch die Bewegung, und durch sie sind die Himmel entstanden. Die Erde schwebt in der Mitte, durch nichts gestützt, und verharrt in dieser Lage wegen des gleichmäßigen Abstandes aller Dinge; sie ist gewölbt, rund, wie eine Säulentrommel. Auf der einen Kreisfläche stehen wir, die andere liegt dieser gegenüber. Die Sterne sind ein Feuerkreis, vom Feuer, das die Welt umschließt, geschieden, aber von Luft umgeben. Die Sterne werden durch röhrenförmige Öffnungen, Durchsichten sichtbar. Durch Verstopfung der Öffnungen entstehen die Finsternisse. Der Mond erscheint bald voll, bald verkleinert, je nachdem die Öffnungen verschlossen oder offen sind. Der Sonnenkreis ist siebenundzwanzigmal größer als der Mondkreis und ist zu oberst, zu unterst die Kreise der Fixsterne. Die Lebewesen entstehen [aus dem Feuchten]12 infolge der Ausdünstung durch die Sonnenwärme. Der Mensch ist ursprünglich einem anderen Lebewesen, nämlich dem Fische, ähnlich gewesen. Die Winde entstehen durch die Ausscheidung der ganz feinen Dünste aus der Luft und durch deren Bewegung, wenn sie zusammenströmen; der Regen entsteht aus dem Dunst, der von der Erde zum Himmel13 aufsteigt; es blitzt, wenn sich der Wind auf die Wolken stürzt und sie trennt. Anaximander ist im Jahr 3 der 42. Olympiade geboren.
7.
Anaximenes, gleichfalls aus Milet, Sohn des Eurystratos, bezeichnete die unbegrenzte Luft als Prinzip. Ihr entstammten die gegenwärtigen, die vergangenen und die zukünftigen Dinge sowie die Götter und die göttlichen Wesen; die anderen Dinge kämen von diesen her. Die Eigenart der Luft bestehe in folgendem: Wenn sie ganz homogen ist, ist sie für das Auge unsichtbar; Kälte und Wärme, Feuchtigkeit und Bewegung macht sie sichtbar. Sie ist aber immer in Bewegung; denn ohne Bewegung wären die durch sie hervorgebrachten Veränderungen nicht möglich. Ihre Verdichtung und ihre Verdünnung ergeben verschiedene Phänomene. Wenn sie sich nämlich ausdehnt und verdünnt, wird sie zu Feuer; Winde hingegen sind verdichtete Luft14; durch Verdichtung bilden sich aus der Luft auch die Wolken, bei noch stärkerer Verdichtung das Wasser; aus weiterer Verdichtung entsteht die Erde, aus der stärksten der Stein. Die Hauptbedingungen des Werdens sind also Gegensätze: Wärme und Kälte. — Die Erde ist eine auf der Luft schwebende Scheibe; Sonne, Mond und Sterne, die alle aus Feuer bestehen, schweben durch ihren Umfang gleichfalls auf der Luft. Die Sterne sind aus der Erde entstanden dadurch, daß Feuchtigkeit aus ihr aufgestiegen und dann verdünnt zu Feuer geworden ist. Aus diesem Feuer bestehen die Sterne. Es gibt aber auch erdartige Körper im Sternenraum, die sich mit den Sternen bewegen. Doch bewegen sich nach Anaximenes die Sterne nicht unter der Erde, wie andere angenommen haben, sondern rings um die Erde so, wie wenn ein Hut um unsern Kopf gedreht wird. Die Sonne wird nicht dadurch unsichtbar, daß sie unter der Erde verschwindet, sondern weil sie von den höheren Teilen der Erde verdeckt wird und weil ihr Abstand von uns sich vergrößert. Wegen des großen Abstandes, in dem sie sich von uns befinden, geben die Sterne keine Wärme. Die Winde entstehen durch Verdichtung und stoßweise Bewegung der Luft. Bei stärkeren Zusammenstößen und stärkerer Verdichtung der Luft entstehen Wolken und verwandeln sich in Wasser. Wenn das von den Wolken herabströmende Wasser gefriert, so hagelt es; wenn es, weil es zu flüssig ist, nur gerinnt, so schneit es; es blitzt, wenn gewaltige Stürme die Wolken teilen; denn wenn sich diese teilen, wird der Himmel licht und feurig. Der Regenbogen zeigt sich, wenn die Sonnenstrahlen auf angesammelte Luft fallen; es entsteht Erdbeben, wenn sich auf der Erde infolge von Erwärmung und Abkühlung stärkere Veränderungen ergeben. Soviel von Anaximenes. Er blühte um das Jahr 1 der 58. Olympiade.
8.
Auf Anaximenes folgt Anaxagoras aus Klazomenä, des Hegesibulos Sohn. Er bezeichnete als Prinzip des Alls Geist und Stoff, den Geist als aktives, den Stoff als passives Prinzip. Der Geist hat die vorhandene Masse geordnet. Die Urstoffe sind unendlich zahlreich und unendlich klein15. Alles wird vom Geist bewegt und Gleiches kommt zu Gleichem. Auch die Himmelskörper bewegen sich in geordneter, kreisförmiger Bewegung. Das Feste, das Flüssige, das Dunkle, das Kalte und alles Schwere sammelt sich in der Mitte und bildet einen festen Körper, die Erde. Was diesen entgegengesetzt ist, das Warme, das Lichte, das Trockene und das Weite, strebt in die Ätherferne. Die Erde hat eine platte Form und bleibt in der Schwebe infolge ihrer Größe und weil es keinen leeren Raum gibt. Und so erhält die Luft mit ihrer starken Tragfähigkeit die Erde in der Schwebe. Aus der Feuchtigkeit und aus dem Wasser auf der Erde ist das Meer entstanden; durch dessen Ausdünstungen und durch die niederströmenden Flüsse hat die Erdoberfläche ihre Gestalt erhalten16. Die Flüsse haben sich durch die Regengüsse und durch das Erdwasser gebildet; die Erde ist nämlich hohl und enthält in den Höhlungen Wasser. Der Nil schwillt zur Sommerzeit an, wenn die Wasser aus dem antiarktischen Schneegebiet herabfließen. Sonne, Mond und Sterne sind feurige Steine, die die Umdrehung des Äthers mitmachen. Unterhalb der Sterne sind für uns unsichtbare Himmelskörper, die sich mit Mond und Sonne bewegen. Die Wärme der Sterne empfindet man wegen ihrer großen Entfernung von der Erde nicht, auch sind sie nicht ebenso heiß wie die Sonne, weil sie sich in einer kälteren Region befinden; der Mond befindet sich unterhalb der Sonne, in geringerem Abstand von uns. Die Sonne übertrifft den Peloponnes an Größe. Der Mond hat kein eigenes Licht, sondern er erhält es von der Sonne. Die Umdrehung der Gestirne erfolgt unter der Erde. Der Mond verfinstert sich, wenn sich die Erde oder ein anderer unter ihm befindlicher Himmelskörper (zwischen Sonne und Mond) stellt, die Sonne aber beim Neumond, wenn der Mond sich zwischen Sonne und Erde stellt. Die Sonnen- und Mondwenden treten dadurch ein, daß diese Gestirne durch die Luft zurückgestoßen werden. Der Mond wende sich oft, weil er der Kälte nicht Herr werden könne. Anaxagoras setzte zuerst die Lehre von den Verfinsterungen und der Helle fest. Er sagte, der Mond bestehe aus Erde und habe Täler und Schluchten. Die Milchstraße ist nach ihm eine Brechung des Lichtes der Sterne, die von der Sonne nicht belichtet werden17. Die Wandelsterne bilden sich wie abspringende Funken infolge der Bewegung des Pols. Die Winde entstehen, wenn sich die Luft unter dem Einfluß der Sonne verdünnt und die erhitzten Teile zum Pole ziehen und in entgegengesetzter Richtung zurückströmen. Donner und Blitz entsteht durch die Wärme, die in die Wolken eindringt. Erdbeben entstehen, wenn die Luft oben auf die Luft unter der Erde stößt; denn wenn die Luft unter der Erde in Bewegung kommt, wankt auch die auf ihr schwebende Erde. Die Lebewesen sind aus der Feuchtigkeit, später durch Zeugung entstanden; männliche Individuen bilden sich, wenn sich der aus den rechtsliegenden Teilen abgesonderte Same mit dem rechten Teil des Muterschoßes verbindet, im anderen Fall weibliche. Dieser blühte…. [und starb]18 im Jahre 1 der 88. Olympiade, in welche Zeit auch die Geburt Platos fallen soll. Anaxagoras soll auch die Zukunft vorausgewußt haben.
9.
Archelaos, ein Athener, Sohn, des Apollodoros, äußerte sich ähnlich wie Anaxagoras über die Mischung der Materie und die Prinzipien. Im denkenden Geist entsteht nach ihm sofort eine Art Mischung. Prinzip der Bewegung ist die Trennung des Warmen vom Kalten, das Warme bewegt sich, das Kalte bleibt in Ruhe. Das schmelzende Wasser strömt in der Mitte zusammen. Dort verdampft es und wird zu Luft und zu Erde; die Luft schwebt aufwärts, die Erde bleibt unten, ist unbeweglich und kühlt deswegen ab19; sie liegt in der Mitte und ist sozusagen kein Teil des Alls; die Luft, die durch die Verdampfung entstanden ist, beherrscht das All. Durch deren Verbrennung entstehen die Sterne, deren größter die Sonne, deren zweitgrößter der Mond ist. Die anderen Sterne sind teils klein, teils ziemlich groß. Der Himmel ist über die Erde gespannt, und so kann die Sonne auf der Erde leuchten, die Luft durchsichtig und die Erde trocken machen; diese ist anfänglich ein See gewesen, da sie an der Peripherie erhöht, gegen die Mitte aber vertieft ist. Als Beweis für ihre Konkavität führt er an, daß die Sonne nicht überall zu gleicher Zeit untergeht, was der Fall sein müßte, wenn die Erde flach wäre. Er behauptet, daß bei der Erwärmung der Erde, die zuerst im tieferen Teil, wo sich Warm und Kalt vermischten, erfolgte, viele Lebewesen und unter ihnen auch Menschen entstanden seien, alle hätten die gleiche Nahrung, nämlich Schlamm gehabt; diese Wesen seien aber kurzlebig gewesen; späterhin seien die Lebewesen durch Zeugung entstanden. Die Menschen hätten sich dann abgesondert. Sie wählten sich Fürsten, gaben sich Gesetze, betrieben die Künste, bauten Städte usw. In allen Lebewesen waltet in gleicher Weise denkender Geist; auch das Tier betätigt Verstand, das eine denkt langsam, das andere schnell.
10.
Die Epoche der Naturphilosophie reichte von Thales bis Archelaos; des letzteren Schüler war Sokrates. Freilich gibt es noch sehr viele, die mannigfaltige Meinungen über das Göttliche und das All vertraten. Wollte man alle diese Anschauungen widerlegen, so müßte man eine Unzahl Bücher verfassen. Nur die sind erwähnt, bei denen es nicht umgangen werden konnte, die einen Namen haben und sozusagen die geistigen Führer der anderen geworden sind, dadurch, daß sie dieselben zu Forschungen anregten. Nunmehr gehen wir weiter.
11.
Auch Parmenides nimmt das All als Einheit an, als ewig, ungezeugt, kugelförmig; auch er lehnte die von sehr vielen Philosophen vertretene Anschauung nicht ab und erklärte Feuer und Erde als die Prinzipien des Alls, die Erde als Stoff, das Feuer als Ursache und Wirksamkeit. Er gab an, die Welt werde untergehen, ohne die Art und Weise des Untergangs anzugeben. Er behauptete, das All sei ewig, ungezeugt, kugelförmig, homogen, ohne (leeren) Raum, unbeweglich und begrenzt.
12.
Leukippos, der Genosse Zenos’, blieb dessen Lehre nicht treu, sondern behauptete, es gebe ein Unendliches, ewig Bewegtes, das fortwährend im Werden und in Veränderung sei. Das Volle und das Leere sind die Elemente. Die Welt ist nach ihm folgendermaßen entstanden: in der großen Leere sammeln sich aus dem Umkreis viele Körper, stoßen aneinander; das Gleichartige verbindet sich, und so entstehen die Sterne; sie wachsen und schwinden nach Naturgesetz. Was das für ein Naturgesetz ist, hat er nicht auseinandergesetzt.
13.
Demokritos, ein Schüler des Leukippos, Sohn des Damasippos aus Abdera, hatte mit vielen Gymnosphisten20 bei den Indern , mit vielen ägyptischen Priestern, Astrologen und babylonischen Magiern Verkehr. Er äußert sich wie Leukippos über die Elemente, über das Volle und das Leere, und nennt das Volle existierend, das Leere nicht existierend. Er lehrt, daß sich die Dinge ständig im Leeren bewegen, daß es zahllose, verschieden große Welten gebe; in einigen Welten gebe es weder Sonne noch Mond, in anderen hätten sie einen größeren Umfang, in wieder anderen seien sie mehrfach vorhanden. Die Abstände der Welten voneinander seien ungleich, bald größer, bald kleiner; die Welten seien zum Teil im Wachsen, zum Teil stünden sie auf dem Höhepunkt, zum Teil seien sie am Vergehen, hier bildeten sich solche, dort verschwänden sie; ein Zusammenstoß vernichte sie. Es gebe Welten ohne Lebewesen, ohne Pflanzen und ohne jede Feuchtigkeit. In unserem Weltsystem sei die Erde vor den Sternen entstanden; der Mond habe die unterste Lage, dann komme die Sonne, dann die Fixsterne. Die Planeten hätten verschiedene Höhenlagen. Die Welt sei in der Entwicklung, bis sie nichts mehr von außen aufnehmen könne. Er lachte über alles, als ob alles Menschliche lächerlich wäre.
14.
Xenophanes aus Kolophon, Sohn des Orthomenes, lebte bis zur Zeit des Cyrus. Er lehrte zuerst die Unbegreiflichkeit aller Dinge und sagte:
„Sagte auch einer das Allervollkommenste zufällig einmal, Weiß er es selber doch nicht, denn Wahn nur ist allen beschieden“21.
Er behauptet, nichts entstehe, nichts vergehe, nichts bewege sich, das All sei eine Einheit ohne jede Veränderung. Nach ihm ist Gott ewig, einer, durchaus homogen, begrenzt, kugelförmig und in all seinen Teilen empfindungsfähig. Die Sonne besteht aus einer Tag für Tag erfolgenden Ansammlung kleiner Feuerteilchen; die Erde ist unbegrenzt und wird weder von der Luft noch vom Himmel umschlossen; es gibt zahllose Sonnen und Monde, alles aber ist aus Erde. Das Meer ist salzig, weil viel Gemengsel darin zusammenfließt; nach Metrodoros kommt der Salzgehalt des Meeres davon, daß es durch die Erde sickere. Xenophanes aber glaubt, daß eine Vermischung der Erde mit dem Meere stattfinden werde und sie mit der Zeit sich im Flüssigen auflösen werde. Als Analogiebeweis führt er an, daß mitten im Lande und auf den Bergen sich Muscheln fänden; auch gebe es in den Steinbrüchen bei Syrakus Fisch- und Robbenabdrücke, auf Paros in der Tiefe des Marmorbruches den Abdruck einer Sardelle, in Malta Platten mit allen möglichen Meertieren. Dies komme daher, daß in der Urzeit alles verschlammt gewesen, die Abdrücke dann im Lehm festgeworden seien. Wenn die Erde ins Meer sänke und zu Lehm würde, würden die Menschen zugrunde gehen; dann beginne ein neues Werden, und eine solche Umwälzung träte in allen Welten ein.
15.
Ein gewisser Ekphantos aus Syrakus stellte die Möglichkeit, eine wahre Erkenntnis der Dinge zu erlangen, in Abrede. Jeder bilde sich eine lediglich subjektive Auffassung22. Die Körper seien von Anbeginn an unteilbar und sie hätten drei Wesensmerkmale: Ausdehnung, Gestalt und Kraft; hieraus entständen die wahrnehmbaren Dinge, deren Zahl begrenzt, nicht unendlich23 ist. Die Bewegung der Körper erfolge nicht durch das Schwergewicht noch durch Stoß, sondern durch göttliche Kraft, die Ekphantos als Vernunft und Seele bezeichnet. Deren Erscheinungsform sei der Kosmos, daher auch seine durch die göttliche Kraft verursachte Kugelform. Die Erde als Weltzentrum bewege sich um ihren Mittelpunkt ungefähr in östlicher Richtung.
16.
Hippo aus Rhegion bezeichnete Kälte, Wasser, Wärme und Feuer als Prinzipien. Das Feuer, das aus dem Wasser entstanden sei, habe seinen Erzeuger trotz seiner Kraft überwunden und die Welt gebildet. Die Seele ist nach ihm bald Gehirn, bald Wasser. Auch der für uns sichtbare Same entstehe aus dem Flüssigen, aus dem die Seele stammt.
17.
Dies alles dürfte ausführlich genug dargelegt sein. So wollen wir denn nach Erörterung der Ansichten der Naturforscher auf Sokrates und Plato zu sprechen kommen, die sich hauptsächlich mit der Sittenlehre beschäftigten.
18.
Sokrates war des Naturforschers Archelaos Schüler. Sein Wahlspruch war das Wort: Erkenne dich selbst. Er gründete eine große Schule; Plato war sein fähigster Schüler; er selbst hinterließ keine Schriften. Plato bildete dessen gesamte Philosophie aus und verband in der von ihm gegründeten Schule Naturwissenschaft, Ethik und Dialektik. Platos Lehre ist folgende:
19.
Er bezeichnet als Prinzipien des Alls Gott, Stoff und Urbild; Gott hat dies Weltall gebildet, geordnet und trägt dafür Sorge; der Stoff liegt allem zugrunde — er nennt ihn24 auch die Empfangende und die Amme —; aus dessen Teilung sind die vier Weltelemente Feuer, Luft, Erde, Wasser entstanden. Aus ihnen bestehen auch alle anderen, die sogenannten Mischwesen, Tiere und Pflanzen. Die Vernunft Gottes ist das Urbild, das Plato auch Idee nennt, gewissermaßen ein Bild, das Gott in seiner Seele schaute, da er das All schuf. Plato bezeichnet Gott als unkörperlich, unsichtbar und nur für weise Männer faßbar; der Stoff sei potentiell Körper, nicht aber aktuell, denn er sei gestalt- und eigenschaftslos und werde zum Körper erst, wenn er Gestalt und Eigenschaften annehme. — Der Stoff also sei ein Prinzip, und zwar ein mit Gott gleichzeitiges; in dieser Hinsicht sei auch die Welt ungeworden. Denn sie bestehe aus dem Stoff. Aus dem Nichtgewordensein folgt nach ihm auch durchweg die Unvergänglichkeit. Insofern aber der Körper aus vielen Eigenschaften und Ideen zusammengesetzt ist, insofern ist er geworden und vergänglich. Einige Platoniker haben beide Momente unter Anwendung folgenden Vergleiches verbunden: Wie ein Wagen, wenn Teil für Teil ersetzt wird, doch bestehen bleibt, und auch wenn ein Teil nach dem anderen zugrundegeht, doch selber als Ganzes weiterexistiert, ebenso vergeht die Welt immer in einzelnen Teilen, und doch bleibt sie ewig bestehen, da die verschwundenen Teile wieder ersetzt werden. Die einen sagen, Plato habe einen ungewordenen und unvergänglichen Gott anerkannt, wie er in den „Gesetzen“ sagt: „Gott hat also, wie auch der alte Spruch lautet, aller Wesen Anfang und Ende und Mitte in sich“25; so nenne er ihn den einen Alldurchdringer. Andere sagen, er nehme eine unbestimmte Vielheit von Göttern an, denn er sage: „Ihr Götter der Götter, deren Schöpfer und Vater ich bin“26; nach anderen wieder meint er bestimmte Gottheiten mit den Worten: „Der gewaltige Zeus im Himmel, der den geflügelten Wagen lenkt“27, oder wenn er den Stammbaum der Kinder des Uranos und der Ge wiedergibt. Andere sind der Meinung, er habe angenommen, daß die Götter entstanden seien, und diese müßten wegen ihres Gewordenseins an und für sich vergehen; nach dem Willen Gottes seien sie aber unsterblich; dies habe er durch einen Zusatz zum Ausdruck gebracht: „Götter der Götter, deren Schöpfer und Vater ich bin, unvernichtbar, wenn ich es will“28, als ob sie leicht der Vernichtung anheimfielen, wenn er es so wollte. Plato nimmt dämonische Wesen an, die teils gut, teils böse sind.
Er nennt, wie die einen meinen, die Seele ungeworden und unvergänglich, wenn er sagt: „Jede Seele ist unsterblich, denn was sich immer bewegt, ist unsterblich“29, und wenn er sie als sich selbst bewegend, als Prinzip der Bewegung erweist. Nach anderen nennt er sie geworden, aber durch Gottes Willen unvergänglich, nach anderen zusammengesetzt, geworden und vergänglich; denn er nimmt einen Mischkrug für sie an30, auch habe sie einen lichtartigen Leib; das, was geworden, gehe naturnotwendig unter. Diejenigen, die für die Unsterblichkeit der Seele sind, stützen ihre Ansicht auf alle jene Stellen, an denen Plato von einem Gericht nach dem Tode und von Gerichtshöfen in der Unterwelt, vom Lohn der Guten und von der Bestrafung der Bösen spricht. — Einige sagen, er nehme die Seelenwanderung an, und zwar gingen die abgeschiedenen Seelen in verschiedene Leiber ein, je nach Verdienst, und würden nach gewissen bestimmten Zeiträumen wieder in diese Welt hinaufgesandt, um eine Probe ihrer Gesinnung abzulegen. Andere stellen dies in Abrede und behaupten, jeder erhalte seinen (endgültigen) Platz nach Verdienst, und berufen sich zum Beweise dafür auf die Stelle, wo Plato sagt, von den Seelen der guten Männer weilten einige bei Zeus, andere bei den anderen Göttern; alle aber, die schlimme Frevel verübt hätten, erlitten ewige Strafen.
Plato, so lehrt man, bezeichnet die Dinge teils als solche ohne Mittelbegriff [amesa]* (ἄμεσα), teils als solche mit Mittelbegriff [eumesa] (ἒυμεσα), teils als Mittelbegriffe [mesa] (μέσα)*. Wachsein und Schlaf und dergleichen bezeichnet er als mittelbegrifflos, Gut und Böse z. B. als einen Mittelbegriff habend und als Mittelbegriffe das Grau zwischen Weiß und Schwarz oder sonst eine Farbe. Gut im eigentlichen Sinne nennt er nur das Gute, das auf die Seele Bezug hat; das, was den Leib und die Außenwelt angeht, nennt er nicht eigentlich gut, sondern uneigentlich gut; vielfach auch soll er es als in der Mitte liegend bezeichnet haben, denn man könne einen guten und einen schlechten Gebrauch davon machen. Die Tugenden stehen dem Werte nach am höchsten, ihrem Wesen nach sind sie das richtige Mittelmaß. Es gibt ja nichts Wertvolleres als die Tugend. Im Exzeß oder im Defekt wird sie schließlich zum Laster. Er zählt vier Tugenden auf: Weisheit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Starkmut. Jeder entsprechen nach der Seite des Zuviel oder des Zuwenig je zwei Laster: der Klugheit die Unklugheit nach der Seite des Defektes, Verschlagenheit als Übertreibung, der Mäßigkeit Unmäßigkeit als Defekt, Stumpfsinn als Übermaß, der Gerechtigkeit übertriebenes Verzichten als Defekt, Selbstsucht als Exzeß, der Starkmut Feigheit als Defekt, Tollkühnheit als Exzeß. Wer diese Tugenden hat, ist vollkommen und glücklich. Das Glück aber ist die größtmögliche Verähnlichung mit Gott; die Verähnlichung mit Gott besteht aber darin, daß einer heilig und gerecht und klug ist. Dies ist nach Plato das Ziel höchster Weisheit und Tugend. Die Tugenden stehen miteinander im Zusammenhang, sind wesensgleich und nie im Gegensatz zueinander; die Laster dagegen sind vielfältig, und bald entsprechen sie sich, bald sind sie einander entgegengesetzt.
Plato nimmt ein Fatum an, doch geschehe nicht alles nach dem Fatum, sondern manches hänge von unserer Entscheidung ab. So sagt er: „Ursache ist der Wollende; Gott ist nicht Ursache“31, und: „Dies ist das Gesetz der Adrasteia“32. So faßt er das Schicksal und die Selbstbestimmung auf. Die Sünden hielt er für unfreiwillige Taten; denn in das Beste, was wir haben, nämlich in die Seele, werde wohl keiner das Böse, d. i. die Ungerechtigkeit, einlassen. Nur aus Unwissenheit oder aus Irrtum in bezug auf das Gute, im Wahn, etwas Gutes zu tun, mache man sich an das Böse. Hierfür gibt es einen sehr klaren Beleg im „Staate“33: „Ihr sagt wiederum, daß das Laster schändlich und gottverhaßt ist. Wie sollte nun einer ein solches Übel wählen? Wer den Gelüsten unterliegt, sagt Ihr. Also ist dies unfreiwillig, während der Sieg Sache des freien Willens ist. Somit beweist die Vernunft, daß Unrechttun aus was immer für einem Grunde unfreiwillig ist.“ Einer macht ihm nun den Einwurf: „Wenn sie unfreiwillig fehlen, warum werden sie gestraft?“ Er antwortet34: „Damit ein solcher möglichst bald von seiner Schlechtigkeit befreit werde und Sühne tue.“ — Sühne zu tun, sei kein Übel, sondern etwas Gutes, wenn anders es eine Reinigung vom Bösen geben soll — und damit die anderen, die davon hören, nicht sündigten, sondern sich vor solchem Irrtum hüteten. Das Wesen des Bösen stamme nicht von Gott noch habe es ein selbständiges Dasein, sondern rühre aus der Gegensätzlichkeit und aus dem Zusammenhang mit dem Guten her, sei es nach der Seite des Zuviel oder nach der des Zuwenig, wie wir oben bezüglich der Tugenden sagten. Dies ist Platos Philosophie, der, wie erwähnt, die drei Teile der gesamten Philosophie verband.
20.
Sein Schüler Aristoteles brachte die Philosophie in ein System und — schärferer Denker, der er war — nahm er als Grundlagen des Alls Substanz und Akzidens an. Die Substanz, die jedem Ding zugrunde liege, sei eine, Akzidenzien gebe es neun: Größe, Beschaffenheit, Beziehung, Ort, Zeit, Haben, Lage, Tun, Leiden. Substanz sei z. B. Gott, Mensch und alles, was unter einen und denselben Begriff fallen kann. Was die Akzidenzien anlangt, so kommt in Betracht die Beschaffenheit, z. B. weiß, schwarz; die Größe, z. B. zwei, drei Ellen lang; die Beziehung, z. B. Vater, Sohn, der Ort, z. B. in Athen, in Megara; die Zeit, z. B. in der zehnten Olympiade; das Haben, z. B. Besitzen; das Tun, z. B. Schreiben und überhaupt jede andere Tätigkeit; die Lage, z. B. auf dem Boden liegen; das Leiden, z. B. Geschlagenwerden. Auch er nimmt an, daß einige Dinge einen Mittelbegriff haben, andere nicht, wie wir es schon von Plato sagten. Er stimmt mit Plato meistens überein, die Seelenlehre ausgenommen. Plato hält die Seele für unsterblich, nach Aristoteles besteht sie eine Zeitlang nach dem Tode fort und verflüchtigt sich hiernach zum fünften Körper, den er neben den anderen vier annimmt; dieser Körper ist dünner als Feuer, Erde, Wasser und Luft, etwa wie ein Hauch. Während Plato als eigentliche, für die Glückseligkeit ausreichende Güter nur die seelischen anerkennt, spricht Aristoteles von drei Gattungen des Guten und behauptet, wer nicht auch die leiblichen und die äußeren Güter habe, sei kein vollkommener Weiser. Die leiblichen Güter seien Schönheit, Stärke, gesunde Sinne, gerade Glieder; die äußeren Reichtum, Adel, Ruhm, Macht, Friede, Freundschaft. Die inneren, seelischen Güter seien, wie auch Plato annahm, Klugheit, Mäßigung, Gerechtigkeit, Starkmut. Auch er sagt, daß die Übel aus dem Gegensatz zum Guten entstünden. Übel gebe es nur im Raume unterhalb des Mondes, über dem Monde gebe es keine. Die Weltseele sei unsterblich und die Welt selbst ewig; die einzelne Seele aber verflüchtige sich, wie schon gesagt. Er hielt seinen philosophischen Unterricht im Lyzeum, Zeno in der bunten Halle. Von dieser Örtlichkeit erhielten Zenos Schüler ihren Namen, d. h. nach der Stoa (Halle) wurden sie Stoiker genannt; die Schüler des Aristoteles erhielten ihren Namen von ihrem Gehaben; da sie im Umhergehen35 im Lyzeum Wissenschaft trieben, wurden sie Peripatetiker genannt. Soviel von Aristoteles.
21.
Die Stoiker bereicherten die Philosophie hinsichtlich des Schlußverfahrens und bestimmten ihren Umfang beiläufig durch Definitionen. Chrysippos und Zeno, die in ihren Lehren übereinstimmten, nahmen an, das Prinzip aller Wesen sei Gott, der der reinste Körper sei; seine Vorsehung walte überall. Auch sie versicherten, daß alles vom Schicksal abhänge und gebrauchten dabei folgenden Vergleich: Ein an einen Wagen gebundener Hund wird, wenn er folgen will, zu gleicher Zeit mitgezogen und läuft freiwillig mit; er setzt dabei den freiwilligen Akt mit Notwendigkeit, gleichsam nach Schicksalsschluß; will er nicht folgen, so wird er doch unter allen Umständen zum Mitlaufen genötigt. So geht es auch bei den Menschen; auch wenn sie nicht sich fügen wollen, werden sie doch jedenfalls gezwungen, sich dem Schicksalsschlusse zu unterwerfen. Weiter lehren sie, daß die Seele unsterblich sei; doch sei sie körperlich und entstehe aus abgekühlter Luft, weshalb sie auch Psyche36 heiße. Sie nehmen auch eine Seelenwanderung nach der Trennung der Seele vom Leibe, einen künftigen Weltbrand und eine künftige Weltreinigung an, die nach den einen eine vollständige, nach den anderen eine teilweise sein wird, wobei Teil um Teil gereinigt werde; auch pflegen sie das Vergehen eines Dinges wie sein Neuentstehen Reinigung zu nennen. Nach ihnen ist alles Körper; ein Körper kann den anderen nicht37 durchdringen, sondern sie liegen nebeneinander38, so daß aller Raum erfüllt ist und es keinen leeren Raum gibt. So lehren die Stoiker.
22.
Epikur hat in fast allem eine entgegengesetzte Ansicht. Prinzipien des Universums sind nach ihm die Atome und das Leere. Das Leere ist gleichsam der Raum für die künftigen Dinge, die Atome aber der Stoff, aus dem alles besteht. Aus der Vereinigung der Atome sind Gott, die Elemente, [die Welten]39 und alles, was darin ist, die Lebewesen und alles übrige entstanden, so daß jegliche Existenz aus den Atomen stammt. Die Atome sind die kleinsten Teile der Körper ohne Mittelpunkt, ohne jede Ausdehnung, ohne Teilungsmöglichkeit; deshalb nannte er sie auch Atome40. Gott ist nach ihm ewig und unvergänglich, doch sorgt er für nichts, auch gibt es keine Vorsehung und kein Schicksal, sondern alles geschieht durch Zufall. Denn Gott thront in den Zwischenwelten, wie Epikur sie nennt; er nahm eine Wohnstätte Gottes, Zwischenwelt genannt, außerhalb der Welt an. Gott freut sich und ruht in höchster Seligkeit, hat selbst keine Sorgen und macht sie keinem anderen. Dementsprechend hat sich Epikur in philosophischen Erörterungen dahin ausgesprochen, daß die Lust das Ziel der Weisheit sei. Der Begriff Lust wurde verschieden aufgefaßt; die einen verstanden darunter die Lust, die den irdischen Begierden entspricht, die anderen die Lust an der Tugend. — Die menschlichen Seelen verfallen nach ihm der Auflösung mit den Leibern, wie sie auch mit ihnen erzeugt werden. Denn sie sind Blut; wenn dies austritt oder sich zersetzt, geht der ganze Mensch zugrunde. Hieraus folgt, daß es weder Urteil noch Gericht in der Unterwelt gibt; somit gibt es keine Rechenschaft für was immer für Taten, sofern sie nicht ans Tageslicht kommen. Dies lehrt Epikur.
23.
Eine andere Philosophenschule hieß die Akademische, weil ihre Anhänger ihre Untersuchungen in der Akademie anstellten. Ihr Haupt Pyrrho, nach dem sie Pyrrhonische Philosophen heißen, lehrte als erster die Unbegreiflichkeit aller Dinge in der Art, daß er zwei entgegengesetzte Anschauungen entwickelte, ohne eine von ihnen mit Bestimmtheit zu vertreten. Denn weder eine geistige noch eine sinnliche Wahrnehmung sei wahr; sie scheine nur den Menschen so. Alles sei im Fluß, in der Veränderung, und nichts bleibe in demselben Zustand. Ein Teil der Akademiker lehrt, man solle bezüglich keines Dinges ein Prinzip feststellen, sondern es einfach untersuchen und dann die Untersuchung aufgeben. Andere fügten das „Nicht mehr“ bei und sagten, das Feuer sei nicht mehr Feuer als irgend etwas anderes. Sie definierten nicht die Wesenheit, sondern die Beschaffenheit.
24.
Bei den indischen Brahmanen gibt es eine Schule von Philosophen, die ein einfaches Leben führen, sich tierischer und am Feuer bereiteter Nahrung enthalten, mit Baumfrüchten vorlieb nehmen, aber auch diese nicht pflücken, sondern nur die zu Boden gefallenen sammeln und damit ihr Leben fristen und aus dem Flusse Tagabena41 trinken. Sie tragen keine Kleider mit der Begründung, der Leib sei zur Kleidung für die Seele von Gott geschaffen. Sie sagen, Gott sei Licht, nicht ein sichtbares, wie die Sonne oder das Feuer, sondern ihnen ist Gott Logos (Wort), nicht das artikulierte, sondern das Wort der Erkenntnis, durch das die Weisen die Geheimnisse der Natur schauen. Dies Licht kennen die Brahmanen allein, weil sie allein den eitlen Schein von sich getan haben, welcher das oberste Kleid der Seele ist. Sie achten den Tod für nichts. Unaufhörlich loben sie Gott unter dem schon erwähnten eigenartigen Namen42 und lassen Hymnen erklingen; sie haben keine Frauen und zeugen keine Kinder. Diejenigen, die ebenso leben wollen wie sie, kommen vom jenseitigen Flußufer herüber, bleiben bei ihnen, um nicht mehr zurückzukehren; auch sie heißen dann Brahmanen. Doch ist ihre Lebensführung nicht die gleiche. Denn es gibt auch Frauen in dem Lande, von denen die dortigen Bewohner stammen und durch die sie sich fortpflanzen. Der Logos, den sie Gott nennen, ist nach ihnen körperlich, außen von einem Körper umgeben, wie wenn einer eine Hülle aus Schaffell trägt; wenn er aber seine Körperhülle ablegt, wird er den Augen sichtbar. Die Brahmanen behaupten ferner, es finde ein Kampf in ihrem Leibe statt, ja daß ihre Leiber voller Kämpfe seien; sie müßten wie gegen Feinde in Reih und Glied kämpfen, wie wir es schon dargetan haben43. Alle Menschen sind, wie sie sagen, Gefangene der ihnen angeborenen Feinde, des Bauches, der Scham, der Kehle, des Zornes, der Freude, des Schmerzes, der Begierde und dergleichen. Der allein kommt zu Gott, der den Sieg über sie davongetragen hat. Deshalb nennen die Brahmanen den Dandamis, zu dem Alexander, der Makedonier, kam, Gott, weil er in dem Kampf mit dem Körper Sieger geblieben ist, und setzen den Kalanos herab, weil er ruchlos ihrer Weisheit den Rücken gekehrt hat. Haben die Brahmanen den Leib von sich getan, so schauen sie, wie auftauchende Fische, die Sonne in ihrer Klarheit.
25.
Die Druiden bei den Kelten verlegten sich mit Feuereifer auf die pythagoreische Philosophie. Den Anstoß zu diesen Bestrebungen gab Zamolxis, ein Sklave des Pythagoras, der Nationalität nach ein Thrazier. Er kam nach dem Tode des Pythagoras zu ihnen und ward für sie der Begründer dieser Philosophie. Die Kelten verehren die Druiden als Propheten und Seher, weil sie ihnen aus Steinchen und Zahlen mit Hilfe pythagoreischer Wissenschaft manches voraussagen. Wir werden die Anfangsgründe dieser Wissenschaft auch berühren, da einige bei ihrer Sektengründung von ihr ausgingen. Die Druiden geben sich auch mit Zauberei ab.
26.
Auch der Dichter Hesiod redet44 von der Natur und will von den Musen Kunde erhalten haben. Die Musen sind Töchter des Zeus, so sagt er. Zeus verkehrte neun Tage und neun Nächte ununterbrochen in ausschweifender Leidenschaft mit Memnosyne, und diese ward in jeder Nacht schwanger und empfing diese neun in ihrem Schoße. Hesiodos rief also die neun Musen von Pieria, d. i. vom Olymp herbei und bat um Belehrung45:
„Wie Götter und Erde zu Anfang geworden, Ströme und unermeßliches Meer mit den brausenden Wogen, Droben die leuchtenden Sterne, der weit sich dehnende Himmel, Wie sie das Weltall geteilt und allen Ehren gegeben Und verkündet uns, wie sie zuerst den Olympos gewannen.“ Das meldet mir, sagt er, ihr Musen,
„Gleich vom Beginn, und sagt, was zuerst von allem geworden. Allererst ist das Chaos entstanden, es folgte nach diesem Gaia mit breiter Brust, der Unsterblichen ewiger Wohnsitz, Aller, welche das Haupt des beschneiten Olympos bewohnen, Und die des Tartaros Dunkel umgibt tief unter der Erde. Eros ferner, der schönste von allen unsterblichen Göttern, Welcher die Glieder uns löst und allen, Göttern und Menschen, Bändigt das Herz in der Brust und verständige Sinne betöret. Erebos und das nächtliche Dunkel dem Chaos entsprossen: Aber der Nacht entstammten das Licht und die Helle des Tages; Gaia gebar nun zuerst den bunt gestirneten Himmel, Welcher ihr gleich ist, auf daß er sie überall rings, umhülle, Ihn, der seligen Götter in Ewigkeit dauernden Wohnsitz, — Zeugte die hohen Gebirge, der Göttinnen liebliche Plätze, Welche die Schluchten der Berge bewohnen und Nymphen genannt sind. Ferner gebar sie das Meer, das öde mit brausenden Wogen, Pontos genannt, nicht pflag sie der Liebe: und weiterhin gab sie, Uranos’ Lager genaht, Okeanos’ Tiefen das Dasein Kolos und Kreios sodann, Hyperion, Japetos ferner, Theia weiter und Rheia, Mnemosyne ferner und Themis; Phoibe im goldenen Schmuck und Tethys voll lieblicher Anmut. Nach ihnen endlich, als jüngster, ward Kronos geboren, voll Arglist, Weitaus der schrecklichste Sohn: ihn haßte der blühende Vater, Auch die Kyklopen gebar sie, die Übermut hegen im Herzen.“
Dann zählt er alle anderen Nachkommen des Kronos auf, dann sei auch Zeus aus Rhea entsprossen. — Alle diese Männer haben sich also in der geschilderten Weise über Natur und Entstehung des Alls geäußert. Keiner von ihnen stieg bis zum wahren Gotte auf, sondern sie beschäftigten sich damit, das Wesen der gewordenen Dinge zu untersuchen und hielten, voll Staunen über die Größe der Schöpfung, diese selbst für die Gottheit, wobei der eine diesen, der andere jenen Teil der Schöpfung höher einschätzte; ihren Gott und Schöpfer erkannten sie nicht46.
Die Ansichten der griechischen Philosophen dürften nunmehr genügend dargelegt sein. Von ihnen gingen die Häretiker aus, deren Lehren wir bald besprechen werden. Vorher will ich noch Geheimlehren und geschäftige Erdichtungen über die Sterne und die Größenverhältnisse darlegen. Auch von solchen nahmen die Häretiker ihre Ausgangspunkte, und so gelten sie in den Augen der Menge als Wunderlehrer; hernach werden wir der Reihenfolge nach ihre Lehren in ihrer Nichtigkeit dartun.
Buch IV.
1.
….47 Grenzen der Sterne aber nennen sie bei jedem Zeichen das Gebiet, worin der einzelne Stern von Abschnitt zu Abschnitt den stärksten Einfluß hat. Darüber herrscht bei ihnen große Meinungsverschiedenheit je nach ihrer Sternkarte. Ein Gefolge aber haben die Sterne, wie sie sagen, wenn sie mitten zwischen andern innerhalb der Sternbilder stehen; z. B, vom gleichen Zeichen hat der eine Stern die erste Stelle, ein anderer die letzte, ein dritter befindet sich in der Mitte, dann heißt es, der in der Mitte hat ein Gefolge, nämlich die Sterne, die am Rande stehen. Sie sehen aufeinander und stimmen miteinander überein, so diejenigen, welche im Dreieck oder Viereck erscheinen. Im Dreieck formieren sich die Sterne und schauen aufeinander, die einen Zwischenraum von drei, im Quadrat die einen solchen von zwei Tierkreiszeichen haben48. Der Kopf zieht die unteren Teile in Mitleidenschaft und die unteren Teile den Kopf, ebenso auch die Teile über dem Monde die irdischen. Doch gibt es einen Unterschied darin und ein Nichtmitleiden, z. B. wenn sie nicht ein und dieselbe Einigung haben.
2.
Der Peratiker Euphrates und Akembes aus Karystos und ihr übriger Reigen benützen diese Aufstellungen, benennen sie nach dem Worte der Wahrheit und reden vom Weltaufruhr und vom Abfall der guten Kräfte zum Bösen und von einer Eintracht des Guten mit dem Bösen; sie sprechen von Toparchen49 und Proastiern50