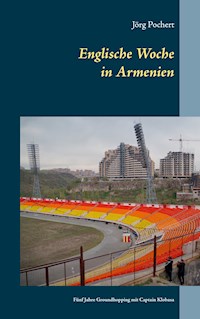Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die BSG Stahl Brandenburg ist einer der Fußballvereine, die in der DDR-Oberliga Geschichte schrieben. Als einzige Mannschaft nie aus jener Liga abgestiegen, schaffte Stahl sogar den Sprung in den Europapokal und konnte sich nach dem Ende der DDR auch für den gesamtdeutschen Profifußball qualifizieren. Es folgte ein steiler sportlicher Abstieg, der den Verein mehrfach an den Rand seiner Existenz brachte. Der jedoch die Mitglieder auch eng zusammenrücken ließ, was den Grundstein dafür legte, dass die Havelstädter noch heute über ein wunderschönes Stadion, eine exzellente Nachwuchsarbeit und eine enthusiastische Fanszene verfügen. "Wie aus STAHL FEUER wurde" ist das erste Buch über die BSG Stahl Brandenburg. Es erzählt ausführlich deren Geschichte, versehen mit zahlreichen Anekdoten, gesellschaftspolitischen Einordnungen, etlichen Fotos und ausführlichen Statistiken. Zudem verdeutlicht das Buch, warum auch heutige Fangenerationen die "Faszination Stahl Brandenburg" jedem Bundesliga-Spiel vorziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Jeske gewidmet, dem Idol meiner Kindheit. Auch 29 Jahre nach Deinem Tod bist (und bleibst) Du unvergessen.
Teilnehmer am UEFA-Cup 1986/87 DDR-Oberliga 1984/85 bis 1990/91 Meister der DDR-Liga, Staffel B 1982/83 und 1983/84 DDR-Liga 1970/71 bis 1983/84 2. Bundesliga 1991/92 Bezirksmeister Potsdam 1967/68 und 1969/70 Regionalliga Nordost 1994/95 (Gründungsmitglied) 22maliger Teilnehmer am FDGB-Pokal 3maliger Teilnehmer am DFB-Pokal Bezirkspokalsieger Potsdam 1981/82 (2. Mannschaft) Landespokalsieger Brandenburg 1993/94 Landesmeister Brandenburg (Frauen) 2016/17 und 2021/22 Landespokalsieger Brandenburg (Frauen) 2021/22 Teilnehmer am DFB-Pokal (Frauen) 2022/23
Dieses Buch steht in keiner offiziellen Verbindung zur BSG StahlBrandenburg e.V.. Es erscheint ohne finanzielle Unterstützung und ohne redaktionellen Einfluss des Vereins. Geäußerte Meinungen und Ansichten entsprechen nicht zwangsläufig denen des Vereins. Die Genehmigung für die Nutzung des Vereinswappens auf dem Buchcover wurde erteilt.
Herzlich Willkommen im
Graffito von Stahl-Fans auf dem ehemaligen Stahlwerksgelände
Inhalt
Vorwort
Vereinsgeschichte, Teil 1: Saison 1991/92
Vereinsgeschichte, Teil 2: 1930 bis 1950
Das Stahl- und Walzwerk Brandenburg
Vereinsgeschichte, Teil 3: 1950 bis 1960
Unsere Heimat: Das Stadion am Quenz
Vereinsgeschichte, Teil 4: 1960 bis 1970
Das Brandenburger Derby
Vereinsgeschichte, Teil 5: 1970 bis 1980
Die Entwicklung des Stahl-Wappens
Vereinsgeschichte, Teil 6: 1980 bis 1984
Die Fans der BSG Stahl
Vereinsgeschichte, Teil 7: Saison 1984/85
Betriebssportgemeinschaften, Clubs und Schwerpunktclubs
Vereinsgeschichte, Teil 8: Saison 1985/86
Vom Kokillenmann zum Profi: Stahl-Spieler in der Arbeitswelt
Vereinsgeschichte, Teil 9: Saison 1986/87
Stahl im Europapokal
Vereinsgeschichte, Teil 10: Saison 1987/88
Der Stadion-Kurier im Wandel der Zeit
Vereinsgeschichte, Teil 11: Saison 1988/89
Stahl in der Junioren-Oberliga
Vereinsgeschichte, Teil 12: Saison 1989/90
Handball am Quenz
Vereinsgeschichte, Teil 13: Saison 1990/91
Vereinsgeschichte, Teil 14: Relegation zur 2. Bundesliga
Wendejahre: Interview aus dem Zeitspiel-Magazin
Vereinsgeschichte, Teil 15: 1992 bis 1998
Freundschaftsspiel gegen Bayern München
Vereinsgeschichte, Teil 16: 1998 bis 2006
Sieg oder Spielabbruch
Vereinsgeschichte, Teil 17: 2006 bis 2009
Die Stahl-Frauen
Vereinsgeschichte, Teil 18: 2009 bis 2022
Vom Fanblock aufs Spielfeld und zurück
Die BSG ist wieder da (Oder: Vereinsgeschichte, Teil 19)
Anhang 1: Alle Stahl-Spieler in der DDR-Oberliga im Portrait
Anhang 2: Statistiken Herren
Anhang 3: Statistiken Frauen
Der Autor
Schlusswort
Danksagungen,
Quellenangaben
Fotonachweise
Vorwort
Ein Buch über Stahl Brandenburg aus meiner Feder, das hätte ich mir zu keinem Zeitpunkt der letzten Jahre vorstellen können. Denn seit 2010 bin ich persönlich nicht mehr regelmäßig zu Gast am Quenz und auch kein Vereinsmitglied mehr, sondern verfolge die Entwicklung nur noch aus der Ferne, von 2-3 Spielbesuchen pro Jahr abgesehen. Vorher in meinen gut 25 Jahren bei Stahl war ich Fan gewesen, Fanclubmitglied und -vorsitzender, Fanzinemacher, Webmaster, alleiniger Redakteur der Stadionzeitung, Vorstandsmitglied, Pressesprecher, Geschäftsstellenleiter und irgendwann alles Mögliche auf einmal. Nur kein Fan mehr. Denn neben der vielfältigen Verantwortung, die ich übernehmen durfte und die ich stets als Ehre begriffen hatte, musste ich auch die Schattenseiten erfahren, die zwangsweise offenkundig werden, wenn man das Innere eines Vereins kennenlernt. Ich hatte nicht nur in menschliche Abgründe geblickt oder war an meine gesundheitlichen und finanziellen Grenzen gestoßen, sondern es gab auch mehr oder wenige unverhohlene Bedrohungen, mit dem negativen Höhepunkt der Ankündigung des Vereinsausschlusses durch den damaligen Vorsitzenden, wohlgemerkt während meiner Zeit als aktives Vorstandsmitglied.
Der ab 2010 gewonnene Abstand von Stahl Brandenburg tat mir gut. Als Groundhopper besuchte ich weiterhin viele Fußballspiele, beruflich folgten erfolgreiche Jahre und privat eine seit 2014 andauernde Beziehung. Stahl ließ mich jedoch trotzdem nie ganz los. Beispielsweise der Abriss der Flutlichtmasten schmerzte genauso wie der erneute Landesliga-Abstieg, denn trotz meiner gewonnenen Distanz verfolgte ich das Geschehen rund um den Verein noch immer mit großem Interesse und ungebrochener Sympathie. Dennoch gibt es im Umfeld des Vereins viele Menschen, die für das Schreiben dieses Buchs deutlich prädestinierter gewesen wären als ich. Warum ich es trotzdem gemacht habe? Zum einen, weil ich nach der Veröffentlichung meiner ersten beiden Bücher immer mal wieder danach gefragt wurde. Zum anderen, und das ist das eigentlich Traurige: Weil es kein anderer gemacht hat. Denn ehrlich gesagt hätte ich es mir lieber in einem plüschigen Sessel bequem gemacht und dieses Buch gern einfach nur gelesen. Stattdessen bescherte mir dieses Werk monatelange Abende und Nächte vor dem PC, Online- und Offlinerecherchen oder Fahrten in Archive und Bibliotheken, wofür ein Viertel des 2023er Jahresurlaubs drauf ging. Ergänzt vom Sichten aller möglichen (und unmöglichen!) Quellen und dem Beschaffen von Fotos zur Illustration. Wohlgemerkt neben einem 40-Wochenstunden-Job, etwas Privatleben und anderen Hobbys.
Begonnen mit dem Schreiben hatte ich, weil dieses Buch Teil der Fußballfibel -Serie werden sollte, die seit 2015 im Neuruppiner Culturcon - Verlag erschien und von der ich jede einzelne der etwa 70 Ausgaben im heimischen Regal stehen habe. Stahl hier in einer Reihe zu sehen mit den großen Vereinen Deutschlands, das war mein Wunsch und mein selbst gestecktes Ziel. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass das, was ich zu Papier brachte, nicht so recht zu den anderen Fibeln passen sollte. Nicht nur, weil bereits nach wenigen Wochen beharrlichen Schreibens klar war, dass ich die maximale Wort- und Seitenzahl der bisher erschienenen Bände um mehr als das Doppelte überschreiten würde, ich allerdings nicht bereit war, etwas in meinen Augen Relevantes wegzulassen. Sondern auch, weil ich keine Lust darauf hatte, das Geschriebene darauf auszurichten, dass es für Leser aus dem gesamten deutschen Sprachraum interessant ist.
Mein Buch soll hauptsächlich ein „Geschenk“ an alle Stahl-Fans werden und jene, denen der Verein am Herzen liegt. Dass auswärtige Leser nicht alle Stellen im Buch super spannend finden werden, nahm ich dafür gern in Kauf. Das Nacherzählen einer Saison incl. Torschützen beispielsweise ist für jemanden aus Aachen oder Zittau sicherlich weniger interessant als für einen eingefleischten Fan. Dieser „Längen“ war ich mir im gesamten Entstehungsprozess des Buchs bewusst. Genauso wenig stören mich die sicherlich deutlich geringer ausfallenden Verkaufszahlen eines selbst verlegten Buchs gegenüber denen einer bekannten, über einen Verlag erscheinenden Reihe. Somit kalkulierte ich auch jederzeit ein, am Ende froh darüber zu sein, wenn die Verkäufe meine während der Entstehungsphase angefallenen Kosten wieder einspielen, ohne mit dem Buch Geld zu verdienen. (Von der Insolvenz des Culturcon-Verlags erfuhr ich übrigens erst kurz vor der Veröffentlichung dieses Buchs.)
Wichtig ist es mir vor allem, die Geschichte der BSG Stahl zu erzählen. Sicherlich nicht komplett lückenlos, aber zweifelsohne in einer bislang noch nicht ansatzweise vorliegenden Ausführlichkeit und mit vielen der Allgemeinheit bislang unbekannten Fakten und Anekdoten. Denn da es bis dato keine einzige über die BSG Stahl erhältliche Chronik gibt, war es für dieses Buch allerhöchste Zeit. Aus der Generation der BSG-Gründungsväter lebt schließlich niemand mehr und selbst zahlreiche Protagonisten der erfolgreichen Entwicklung der 1980er Jahre wie Sektionsleiter Armin Siedel (†2019) oder Geschäftsführer Siegfried Ziem (†1998) sind mittlerweile genauso verstorben wie die späteren Vereinspräsidenten Manfred Stengel (†2005), Bernd Kuhlmey (†2019) und Wolfgang Juchert (†2020). Und mit Frank Jeske (†1994) und Marco Ziem (†2013) leider auch bereits zwei Spieler, die für die BSG Stahl in ihrer erfolgreichsten Epoche auf dem Platz standen.
Das Herzstück dieses Buchs stellt der Rückblick auf jene sieben DDR-Oberligajahre dar. Selbst wenn vorher und nachher ebenfalls zahlreiche interessante Dinge passiert sind und natürlich auch aufgeschrieben wurden: Diese Zeit, in welche auch die Europapokalteilnahme fällt, ist und bleibt der absolute Höhepunkt unserer Historie und verdient daher eine besonders umfangreiche Würdigung. Und nicht nur das: Der DDR-Oberliga-Aufstieg 1984 als Beginn dieser Ära jährt sich in Kürze bereits zum vierzigsten (!!!) Mal.
Es war also wahrlich an der Zeit, die alten Geschichten einmal aufzuschreiben, von ihrem Ursprung an. Und somit den Fans, die heute jünger sind als 40 Jahre, nicht nur davon zu berichten, dass in Brandenburg vor gar nicht allzu langer Zeit nationaler Spitzenfußball gespielt wurde. Sondern auch, diesen mit umfassenden Schilderungen nachträglich möglichst intensiv erlebbar zu machen. Und dadurch den nachfolgenden Generationen mit auf den Weg zu geben, dass die Vereinsgeschichte der BSG Stahl ein sehr stolzes und erfolgreiches Vermächtnis darstellt, welches es zu bewahren und weiterzugeben gilt. Damit das „Stahl Feuer“ auf ewig weiter brennt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Jörg Pochert
Vereinsgeschichte, Teil 1: Saison 1991/92
Es roch ungewohnt auf der Berliner Heerstraße in den frühen Nachmittagsstunden des 5. Oktober 1991. In jenen Jahren waren die Zweitliga-Heimspiele von Hertha BSC alles andere als Straßenfeger und auch heute sollten nur 7.800 Besucher die Tore des Olympiastadions passieren. Erstmals war eine Mannschaft aus den neuen Bundesländern zu einem Punktspiel zu Gast bei der „Alten Dame“, der BSV Stahl Brandenburg. Dessen Fans, die größtenteils zur Arbeiterklasse gehörten (insofern sie nach dem Zusammenbruch der DDR nicht gänzlich ohne Job dastanden), hatten sich keine zwei Jahre nach dem Mauerfall noch nicht alle ein West-Auto leisten können und reisten daher mehrheitlich mit ihren PKW Trabant oder Wartburg an, deren Benzingemisch schwer in der Charlottenburger Luft hing.
Etwa 1.500 Havelstädter waren mit nach Berlin gekommen. Zwar hatten ihre Lieblinge erst eine Woche zuvor an gleicher Stelle gespielt, allerdings gegen die eher unattraktive Mannschaft von Blau-Weiß 90. Das Auswärtsspiel bei der großen Hertha aber war für den Brandenburger Anhang einer der Höhepunkte der Saison. Die Monate vor dem Anschluss des DDR-Fußballs an das Ligensystem des DFB hatten sich in der kurz zuvor abgewickelten sozialistischen Republik vielerorts als Berg- und Talfahrt dargestellt, so auch in der Stadt Brandenburg. An den meisten Spieltagen der Saison 1990/91 hatte Stahl einen der ersten sechs Tabellenplätze der DDR-Oberliga belegt und hätte sich somit direkt für die 2. Bundesliga qualifiziert. Und noch am drittletzten Spieltag betrug der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz, der sogar für den Sprung in die 1. Bundesliga berechtigen würde, ganze zwei Punkte. Am Ende der Saison jedoch standen die Blau-Weißen mit leeren Händen da. Zur Halbzeit des letzten Spiels hatte man in Erfurt noch mit 1:0 geführt und hätte sich somit für den vierten Platz und zugleich den UEFA-Cup-Platz qualifiziert, nach der 1:2-Niederlage wiederum war man sogar auf Platz 8 zurück gefallen. Zwar sollte Stahl anschließend in einer Relegationsrunde gemeinsam mit dem ehemaligen Serienmeister BFC Dynamo (bzw. dessen Nachfolger FC Berlin), dem 1. FC Magdeburg sowie Aufsteiger 1. FC Union Berlin noch einen weiteren
Michael Kaiser stürmt im Heimspiel gegen Hannover 96 (3:0) nach vorn
Meppens Torwart Kubik stoppt Andreas Lindner. Stahl gewann dennoch mit 1:0
Zweitligaplatz ausspielen, doch halt mit einer geringen Chance von nur 1:4. Aber der Husarenritt gelang, nach einem 2:0-Sieg in der Köpenicker Wuhlheide stand der Sprung in die 2. Liga fest. Brandenburg war somit auf der gesamtdeutschen Fußball-Landkarte angekommen.
Eröffnet wurde die Zweitbundesligasaison mit einem Heimspiel gegen die Berliner Hertha. Nach der Aufnahme der DDR-Mannschaften in den gesamtdeutschen Spielbetrieb war die 2. Bundesliga in eine Nord- und Südstaffel mit jeweils zwölf Mannschaften aufgeteilt worden. Die qualifizierten Ostclubs Erfurt, Halle, Chemnitz, Jena und VfB Leipzig trafen sich in der Süd-Staffel wieder und durften, neben aufregenden Reisen ins Altbundesgebiet, weiter ihrer Rivalitäten frönen. Einzig Stahl Brandenburg hatten die DFB-Verantwortlichen in die Nordstaffel gesteckt. Elf vollkommen neue Gegner warteten somit auf die Brandenburger. Daran, dass Fans aus der ehemaligen DDR zu beispielsweise Remscheid oder Oldenburg keinerlei Verbindung hatten und diese Mannschaften auch weniger Fans mitbrachten als Halle oder Erfurt, wurde angesichts der neuen Herausforderung zunächst kein Gedanke verschwendet.
Viel mehr entsprach es dem Zeitgeist jener Jahre, dass alles aus dem Osten Kommende als langweilig und miefig angesehen wurde und man keine zwei Jahre nach dem Mauerfall noch immer vorrangig nach Westen schaute. Dies zeigte sich nicht nur beim geänderten Einkaufsverhalten, aufgrund dessen zahlreiche Unternehmen aus der ehemaligen DDR die Segel streichen mussten, sondern auch beim Fußball. Jena, Chemnitz, Erfurt oder Halle wollte fast niemand mehr sehen. Stattdessen lockten Fahrten nach Uerdingen, St. Pauli oder eben zu Hertha BSC. Eben zu jenen Mannschaften, die man jahrelang nur heimlich in der Sportschau sehen konnte, aber sich niemals zu glauben traute, in die Grotenburg-Kampfbahn, ans Millerntor oder eben ins Olympiastadion einmal selbst reisen zu können. Und dann auch noch zu einem Auswärts-Punktspiel mit Stahl!
Das Abenteuer Profifußball begann am 24. Juli 1991. Vor 10.500 Zuschauern im heimischen Stadion am Quenz boten die Brandenburger der „Alten Dame“ lange die Stirn und mussten sich nur durch einen Gegentreffer eines gewissen Mario Basler knapp mit 0:1 geschlagen geben. Zwei Wochen später, nach jeweils unnötigen Niederlagen in Remscheid und Braunschweig, war die Euphorie in Brandenburg fast schon wieder vorüber. Stahl stand punktlos am Tabellenende und zum Heimspiel gegen den VfB Oldenburg waren nur noch 3.333 Zuschauer gekommen, also nicht mal mehr ein Drittel der Kulisse drei Wochen zuvor.
Jene wurden aber für ihr Erscheinen belohnt, denn durch das 1:0 des alten Helden Eberhard Janotta gelang Stahl der erste Pflichtspielsieg im gesamtdeutschen Fußball. Und nicht nur das: In den kommenden sieben Spielen sollte nur noch beim späteren Meister Bayer Uerdingen unglücklich mit 1:2 verloren werden. Die anderen Ergebnisse: 4:2 bei Fortuna Köln, 3:0 gegen Hannover 96, 4:0 gegen den FC St. Pauli, 1:1 beim VfL Osnabrück, 1:0 gegen den SV Meppen.
Mit breiter Brust reiste Stahl also am elften Spieltag zur ersten der beiden Partien im Berliner Olympiastadion binnen einer Woche. Bei Blau-Weiß 90 wurde zur Halbzeit mit 1:0 geführt und Stahl stand dadurch in der imaginären Tabelle auf Platz 1 der 2. Bundesliga Nord! Doch in der Halbzeitpause kam es zu einem Bruch, der nicht nur fürs Spiel gelten sollte, sondern für den gesamten Saisonverlauf, und mit weiterem Blickwinkel sogar für die Vereinsgeschichte der kommenden Jahrzehnte. Die Partie bei den Exil-Mariendorfern ging mit 1:3 verloren, in der eine Woche später mit dem Spiel bei Hertha BSC beginnenden Rückrunde wurden anschließend noch ganze sechs Punkte eingefahren. Neben dem einzigen Sieg (2:0 gegen Fortuna Köln) gab es lediglich noch drei Auswärtspunkte (in Oldenburg, St. Pauli und Meppen). Stahl musste als Tabellenvorletzter in die Abstiegsrunde und war in dieser nicht mehr wettbewerbsfähig, so dass der Gang in die Oberliga bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende feststand. Passenderweise wurden, nachdem der Abstieg feststand, die letzten beiden Spiele gegen Eintracht Braunschweig und beim FC Remscheid mit jeweils 1:0 gewonnen, am letzten Platz änderte dies nichts mehr.
Unterm Strich blieb eine enttäuschende Saison einer Mannschaft, die angesichts ihrer nominellen Zusammensetzung nie hätte absteigen dürfen, aber nicht nur an ihren Erwartungen, sondern auch an permanenter Unruhe im Umfeld und neuen gesellschaftlichen Realitäten gescheitert war. So gab es beispielsweise gleich drei Trainerwechsel, und am Saisonende holte man mit Eckhard Düwiger genau jenen Mann wieder zurück, der weniger als ein halbes Jahr zuvor geschasst worden war. Mit dem sensationellen 4:0 gegen St. Pauli, dem 3:0 gegen Hannover oder dem Skandalspiel gegen Bayer 05 Uerdingen (das Stahl nach drei Platzverweisen und zwei Verletzungen mit fünf Feldspielern beendete und zwei der drei Gegentreffer dennoch erst in den letzten fünf Minuten kassierte) hatte die Saison den Fans aber auch einige unvergessliche Erlebnisse beschert, die auch über 30 Jahre später nicht vergessen sind.
Eine letzte, wie die Faust aufs Auge passende, Anekdote hatte dieses Seuchenjahr für die Brandenburger übrigens noch parat: Das chronisch klamme Blau-Weiß 90 Berlin ging nach dem Saisonende in Konkurs und wurde auf den letzten Tabellenplatz gesetzt. Hätte Stahl nicht ausgerechnet beim 0:3 gegen Fortuna Köln in der Abstiegsrunde seine wohl schlechteste unter zahlreichen miesen Saisonleistungen gezeigt und dieses Spiel stattdessen gewonnen, wären die Brandenburger sportlich Vorletzter geworden und hätten in einer kurzfristig angesetzten Dreierrunde mit dem TSV 1860 München und dem TSV Havelse den freigewordenen Zweitligaplatz ausgespielt. Es versteht sich ironischerweise fast von selbst, dass Fortuna Köln, das in der regulären Saison zweimal mühelos geschlagen worden war, diese Runde souverän gewann und sich dadurch den verspäteten Klassenerhalt sichern konnte.
Chancenlos: Stahl (hier Christian Beeck) verlor bei Hertha BSC mit 0:3
Skandalspiel: Drei Brandenburger flogen, Uerdingens Laeßig hingegen nicht
Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ein Verein aus einer Provinzstadt mit weniger als 100.000 Einwohnern den Sprung in den gesamtdeutschen Profifußball schaffen konnte, während ihn die großen Clubs aus (Ost-) Berlin und Magdeburg oder traditionelle Fußball-Standorte wie Aue, Zwickau, Babelsberg oder Cottbus verpassten? Antworten darauf gibt dieses Buch. Es ist Zeit, die komplette Geschichte der BSG Stahl Brandenburg zu erzählen, von Anfang an. Legen wir los…
Stahl-Trainer Düwiger ist nach der Niederlage bei Blau-Weiß 90 Berlin bedient
4:0 gegen St. Pauli im „Hinspiel“: Janotta trifft zum 1:0
Hell‘s Bells und Bengalfackeln beim Rückspiel: Stahl holte ein 2:2 in Hamburg
Einwurf: Stahl im Europapokal 1991/92
Jeder Stahl-Fan wird sich angesichts der Überschrift an den Kopf fassen und fragen, was er bitte verpasst hat, denn Europapokalspiele gab es am Quenz bekanntlich nur in der Saison 1986/87. Zumindest offiziell. Inoffiziell aber auch fünf Jahre später, denn die Fans des FC St. Pauli hatten die beiden Zweitbundesligaduelle mit Stahl als „Europapokal“ ausgerufen, weil es die allerersten Punktspiele der Braun-Weißen gegen eine Mannschaft aus der ehemaligen DDR waren.1 Allzu lang dauerte der Auftritt auf dem „internationalen“ Parkett für die Hamburger jedoch nicht. In Brandenburg setzte es eine 0:4-Klatsche, welche am heimischen Millerntor nicht mehr egalisiert werden konnte. Im Gegenteil: Auch dort überzeugten die Havelstädter und holten ein beachtliches 2:2-Unentschieden.
Während sich St. Pauli nach dem „Erstrundenaus“ bis heute nie für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren konnte, man aber immerhin einmal Weltpokalsiegerbesieger wurde, kann man nur phantasieren, wie für Stahl die Europapokalreise in der Saison 1991/92 weiter gegangen wäre. Ein wenig Losglück hätte es sicher gebraucht. Immerhin gegen den späteren Vizemeister VfB Oldenburg, Hannover 96, den SV Meppen und Fortuna Köln hatte Stahl unterm Strich ebenfalls eine positive Saisonbilanz und wäre noch eine Runde weiter gekommen. Gegen alle anderen Mannschaften wäre die 2. Runde Endstation gewesen. Unterm Strich ist der imaginäre Europapokal 1991/92 nicht mehr als eine statistische Spielerei, verbunden mit zwei Erkenntnissen: Zum einen, dass Stahl den Hamburgern eine reale Europapokalteilnahme voraus ist. Und zum anderen, dass der FC St. Pauli nie gegen Stahl gewinnen konnte. Vielleicht kommen die Braun-Weißen ja mal zu einem Freundschaftsspiel an den Quenz, um diese Bilanz zu korrigieren?
Mehr von den realen Europapokalspielen der BSG Stahl ist im Buch ab Seite → zu finden.
Heiliger Boden: Hier wurde am 14.12.1930 der SC Walzwerk gegründet
Vorgängerverein BSV 1921 (Etwa 1933-35). Zweiter von links: Karl Lüder, Kassenwart und Urgroßvater des heutigen D-Jugendtrainers Michael Wolf
Vereinsgeschichte, Teil 2: 1930 bis 1950
Auch wenn die Geschichte der BSG Stahl Brandenburg offiziell erst 1950 beginnt und sich die BSG in ihrer Tradition auf keinen Vorgängerverein beruft, so gab es diese(n) durchaus, denn im Westen der Havelstadt wurde schon deutlich früher von Arbeitern der Stahlindustrie gegen das runde Leder getreten. Und am 14.12.1930 der SC Walzwerk ins Leben gerufen! Ort der Vereinsgründung war die Gaststätte Behrs , später Gaststätte Glück Auf , in der Magdeburger Landstraße 104 (Ecke Bayernstraße).2 Der 55-jährige Gastronom Gustav Behrs, aus Grebs im Landkreis Zauch-Belzig (heute zur Gemeinde Kloster Lehnin gehörend) zugewandert, hatte den fußballbegeisterten Walzwerkern mit seinem Lokal nicht nur den Gründungsort, sondern auch ihr erstes Vereinsheim gegeben.
Zum ersten Vereinsvorsitzenden des SCW wurde der Bauzeichner Hugo Hallmann gewählt, wohnhaft in der Magdeburger Landstraße 100.3 Und somit in unmittelbarer Nachbarschaft der Gaststätte Behrs, weswegen Hallmann, der auch Initiator der Vereinsgründung gewesen war, in die Gaststätte Behrs geladen hatte. Sein Stellvertreter war der Arbeiter Otto Karge, wohnhaft am Neuendorfer Sand 41. Von Beginn an war der SC Walzwerk also ein Verein vom Quenz, geleitet von Männern vom Quenz. Und er war ein reiner Arbeiterverein, denn Bedingung für die Mitgliedschaft war es, im Walzwerk tätig zu sein.
Drei Jahre später schlossen sich die Walzwerker dann mit dem SV Neuendorf 21 zur Brandenburger Spielvereinigung 1921 zusammen. Formell waren die Neuendorfer der ältere Verein, so dass in der Überschrift dieses Kapitels eigentlich die Jahreszahl 1921 statt 1930 stehen müsste. Jedoch existierte der SV 21, der über die Sektionen Fußball und Boxen verfügte, zwischenzeitlich nur noch auf dem Papier. Zwar galten die 21er als inoffizielle Sportgruppe des Stahlwerks, wurden von jenem jedoch nicht mehr finanziell unterstützt, nachdem Friedrich Flick, seinerzeit der größte Stahlproduzent Deutschlands, 1926 das Werk übernommen hatte. Die Werksleitung hatte fortan kein Interesse mehr an den Sportlern und stellte ihnen nicht mal mehr Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung, sondern der betriebseigene Sportplatz hätte gegen Entgelt angemietet werden müssen. Dass sich einige Jahre später „nebenan“ der SC Walzwerk gegründet hatte, war für die Neuendorfer also eine Chance, ihr Vereinsleben vereint neu aufleben zu lassen.
Da der Zusammenschluss aus dem Jahr 1933 datiert, darf gemutmaßt werden, dass jener auf Initiative des Freizeitwerk des Dritten Reichs Kraft durch Freude (KdF) erfolgt war, zu dessen Aufgaben es unter anderem gehörte, Sportangebote für Arbeiter und Angestellte zu organisieren. Aufgrund sehr weniger aus der NS-Zeit vorliegenden Quellen finden sich hierfür allerdings keinerlei Belege. Zwar gab es seit der Machtübernahme der Nazis Ende Januar 1933 in beiden Werken umfangreiche, zweifelsfrei nachgewiesene KdF-Aktivitäten. Jedoch eben keine Belege für die Initiative zum Zusammenschluss der Vereine, und auch das genaue Datum der Fusion ist nicht mehr ermittelbar. Sportlich spielte die BSV 1921 bis zur kriegsbedingten Einstellung des Spielbetriebs im September 1944 innerhalb der Stadt im Übrigen keine bedeutende Rolle und kam nie über ein Kurzintermezzo in der zweitklassigen Bezirksklasse hinaus.
Bevor wir uns der Entwicklung des Fußballsports nach dem Zweiten Weltkrieg widmen, blicken wir auf die Stadt Brandenburg: Jene war vor Kriegsbeginn ein wichtiger Industriestandort. In den 1871 gegründeten Brennabor -Werken waren zunächst nur Kinderwagen, später aber auch Fahrräder und Automobile produziert worden. In einer innenstädtischen Werft (und einer weiteren im Vorort Plaue) wurden Schiffe gebaut, darüber hinaus gab es Eisengießereien sowie Fabriken für Blechspielwaren, Möbel und Textilien. Ab 1912 schließlich entstanden auf dem Quenz das Stahl- und das Walzwerk. Ein Jahr später wurde im westlich der Stadt gelegenen Briest die Brandenburgische Flugzeugwerke GmbH erbaut, in der Flieger des Typs Etrich Traube , ein Schul- und Aufklärungsflugzeug, produziert wurden. Durch ihre verkehrsgünstige Lage und nicht zuletzt dem vor Ort ansässigen
Eine in Brandenburg hergestellte Arado AR 79 über dem Wendsee bei Plaue
Der Wehrmachts-LKW Opel Blitz vor dem Brandenburger Werk
Stahlwerk wurde die Stadt nach der Machtergreifung der Nazis im Jahre 1933 zu einem zunehmend wichtigeren Standort der Lkw- und Flugzeugproduktion ausgebaut. Brennabor produzierte neben Fahrrädern und Autos fortan auch Rüstungsgüter, beispielsweise die 2-cm-Flak 38 , eine Flugabwehrkanone der Wehrmacht. Im ab 1935 an der Gördenbrücke entstandenen Opel -Werk wurde der Wehrmachts-LKW des Typ Blitz gefertigt. Und der Flugzeugbauer Arado war nach Briest fortan auch am Standort Neuendorf aktiv, neben Schulflugzeugen für Luftwaffenpiloten wurden im neuen Werk militärische Wasserflugzeuge hergestellt. Auch sämtliche anderen Industriestandorte dienten in den letzten Kriegjahren hauptsächlich der Aufrechterhaltung der Kriegsmaschinerie. Und die Rohstoffe dafür kamen größtenteils aus den beiden Werken auf dem Quenz.
Neben der industriellen hatte die Stadt durch drei hier ansässige Regimente und ein Pionier-Bataillon auch eine große militärische Bedeutung. Nicht nur deshalb war Brandenburg ein strategisch wichtiges Angriffsziel. Sondern auch, weil es im Stadtteil Görden ein berühmt-berüchtigtes Zuchthaus gab sowie eine Euthanasie-Tötungsanstalt auf dem Gelände des Nikolaiplatzes, unmittelbar vor der historischen Stadtmauer. Zwischen April 1944 und dem Kriegsende war Brandenburg insgesamt acht Luftangriffen der 8. US-Luftflotte ausgesetzt. Mehr als 2.000 Tonnen Bomben fielen auf das Stadtgebiet, wobei tausende Menschen starben. Weitere erhebliche Beschädigungen gab es im letzten Kriegsmonat während der Bodenkämpfe im Zuge des Ringschlusses der Roten Armee um Berlin.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag die über 1000 Jahre alte Havelstadt größtenteils in Trümmern. Die Stadt hatte seit dem Kriegsbeginn mehr als ein Achtel ihrer zuvor gut 79.000 Einwohner verloren. Über 10.000 von den 23.800 in der Stadt existierenden Wohnungen waren zerstört worden sowie mehr als 70% der zuvor existierenden Industrie. Und was die Kriegswirren überstanden hatte, wurde im großen Stil seitens der Alliierten abgebaut und als Reparationsleistung in die Sowjetunion verschifft, beispielsweise das Stahl- und Walzwerk oder die Opelfabrik.
Kurfürstenhaus, Katharinenkirche und Neustädtisches Rathaus um 1930
Die gleiche Ecke im Sommer 1945
Im Jahr 1945 hatten die Menschen also komplett andere Sorgen als die Ausübung ihres Lieblingssports. Zu groß war die Trauer über gestorbene oder gefallene Angehörige, Freunde und Vereinskameraden. Zu bürdevoll der Wiederaufbau. Und zu existenziell der tägliche Überlebenskampf in einer zerstörten Stadt. Zudem hatten die Sportler auch kaum noch Möglichkeiten, ihren Aktivitäten nachzugehen. Nicht nur, weil fast sämtliche Sportanlagen zerstört waren und Trainingsutensilien oder Sportkleidung fehlten. Sondern auch, weil nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Direktive Nr. 23 des Alliierten Kontrollrats vom 17. Dezember 1945 alle bislang bestehenden Sportvereine verboten worden waren, da diese als Hort der Körperertüchtigung und damit der Erlangung der Wehrkraft angesehen wurden und deren Wiederbelebung um jeden Preis verhindert werden sollte. Wörtlich hieß es in jener Direktive u.a. wie folgt: „Allen vor der Kapitulation in Deutschland bestehenden sportlichen, militärischen oder paramilitärischen athletischen Organisationen (Klubs, Vereinigungen, Anstalten und andere Organisationen) wird jede Betätigung untersagt, und sie sind bis zum 1. Januar 1946 spätestens aufzulösen.“ , aber auch: „Das Bestehen nichtmilitärischer Sportorganisationen örtlichen Charakters auf deutschem Gebiet ist gestattet. Diese Organisationen dürfen das Niveau eines Kreises nicht übersteigen und von keiner über dem Kreisniveau stehenden öffentlichen oder privaten Körperschaft überwacht, angeleitet oder finanziell unterstützt werden, außer mit der Erlaubnis des Zonenbefehlshabers. Diese Erlaubnis beschränkt sich streng auf solche Sportarten, denen in keiner Weise eine militärische Bedeutung zukommen kann.“4
Selbst wenn die Direktive auch die letzten Reste der nach dem Krieg (falls überhaupt) noch bestehenden Sportstrukturen endgültig zerstört hatte, bot sie zumindest eins: Rechtssicherheit. Dadurch, dass dem Mannschaftssportart Fußball keine militärische Bedeutung beigemessen wurde, durfte gemäß der Direktive schließlich wieder gekickt werden, wenn auch unter vollkommen veränderten Rahmenbedingungen. Wenigstens konnte an einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb gedacht werden. Freilich erst nach Beantragung und unter scharfer Beobachtung durch die Alliierten, aber immerhin.
Der Fußballbetrieb war in den Nachkriegsmonaten zunächst durch unregelmäßige, inoffizielle Freundschaftsspiele zwischen den einzelnen Stadtteilen oder sogar Straßenzügen wieder aufgenommen worden. Das erste stadtübergreifende Spiel nach dem Kriegsende hatte es im August 1945 gegeben, als eine Brandenburger Stadtmannschaft die Auswahl des Berliner Stadtbezirks Schöneberg auf der Musterwiese empfing und mit 3:1 gewann. Den Spielball stiftete seinerzeit übrigens Max Herm, der damalige Brandenburger Bürgermeister.
Nachdem das Verbot der bisherigen Vereinsstruktur zum 1. Januar 1946 endgültig in Kraft getreten war, hatten die bislang bestehenden Vereine in der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone (Berlin ausgenommen) die Möglichkeit, ihre Wiederzulassung zu beantragen, was vielerorts auch relativ zügig vonstatten ging. Beispielsweise im Landkreis Eschwege im neu entstandenen „Zonenrandgebiet“ waren bis zum 30. Juni 1946 bereits 39 Vereine seitens der US-Behörden wieder zugelassen worden.5
In der sowjetischen Besatzungszone hingegen war das Vereinsverbot endgültig und ein vollkommen neues Sportswesen wurde aufgebaut. Um gar nicht erst inoffizielle Nachfolgevereine entstehen zu lassen, bildeten sich nun Sportgruppen, welche ausschließlich nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellt wurden. Maßgeblich für die Zugehörigkeit zu einer Sportsgruppe war einzig und allein die private Meldeadresse der Spieler. Dadurch kam es zu der grotesken Situation, dass vormalige Vereinskameraden gegeneinander antreten mussten, eben weil sie schlichtweg im falschen Stadtgebiet oder teilweise sogar in der falschen Straße lebten. Dass die Kicker in den meisten Fällen durchaus dazu bereit gewesen wären, weite Wege in andere Stadtteile zu ihren bisherigen Sportskameraden auf sich zu nehmen, angesichts der Zerstörungen durch den Krieg sogar meist zu Fuß, war hierfür vollkommen irrelevant. Das Zerschlagen des bisherigen Vereinswesens stand für die Alliierten, die bereits wenige Monate nach dem Kriegsende zunehmend als Besatzer wahrgenommen wurden, über allem.
In der Stadt Brandenburg entstanden 1946 zunächst die SG Branden-
burg-West und die SG Brandenburg-Nord, wobei die SG Nord am ehesten als Einheit- (und somit langfristig auch als Stahl-) Vorgängerverein anzusehen ist, obwohl in der Mannschaft aus besagten Gründen zahlreiche ehemalige Spieler des Brandenburger SC 05 kickten. (Anm. Kurios hierbei ist, dass die spätere BSG Stahl im Westen der Stadt ansässig sein sollte und die BSG Motor Süd im Norden der Stadt und man somit annehmen könnte, dass sich die BSG Einheit (und damit langfristig auch Stahl) aus der SG West entwickelte und die BSG Motor Süd aus der SG Nord. Die Wirrungen der Nachkriegsjahre und die kommenden wiederholten, auf politisches Geheiß geschehenen, Umorganisierungen des Sportsbetriebs bedingten jedoch eine gegenteilige Entwicklung, die im Folgenden skizziert wird.)
Neben den beiden Sportgruppen der Stadt gab es auch einige Kicker, die in den ersten Nachkriegsjahren für die sogenannten „Kartoffelmannschaften“ auf umliegenden Dörfern aufliefen. Die beste Kartoffelmannschaft stammte 1946/47 aus Hohenferchesar. Entlohnt wurden die Brandenburger Akteure dort für jedes Spiel mit einem Rucksack voller Kartoffeln, der in der damaligen Zeit oft entscheidend dafür war, dass die Familien der Fußballer bis zum nächsten Wochenende genug zum essen hatten. Darüber hinaus waren Kartoffeln ein Gut, das auf dem Schwarzmarkt beispielsweise gegen Fleisch oder Kohlen eingetauscht werden konnte. Und während des „Hungerwinters“ (zwischen November 1946 und März 1947) war ein einzelner Sack Kartoffeln oft sogar überlebenswichtig. Denn im kältesten Winter des gesamten 20. Jahrhunderts war monatelang die Lebensmittel-Versorgung zusammengebrochen und die Ernährung von staatlicher Seite pro Kopf auf täglich 1.500 kcal reglementiert worden. So beugten 1-2 Kartoffeln mehr pro Tag oftmals der Unterernährung vor, welche letztlich zum Tod von 2 Millionen Menschen in Mittel- und Osteuropa geführt hatte. Darunter waren auch hunderttausende Opfer in Deutschland.6
Noch im Gründungsjahr 1946 benannte sich die SG Nord in SG Polizei Brandenburg um. In der erstmals nach dem Krieg in der Saison 1946/47 ausgetragenen Brandenburgischen Landesmeisterschaft wurde die SG Polizei Sieger der Vorrundengruppe 1, scheiterte im Viertelfinale aber mit 2:4 am späteren Meister SG Cottbus-Ost. Die SG West hingegen war Zweiter der Vorrundengruppe 2 geworden, unterlag im Viertelfinale aber der SG Neuruppin mit 0:4. In der Saison 47/48 wiederum berechtigte nur noch der erste Vorrundenplatz für eine Teilnahme an der Endrunde. Die SG Polizei als Zweiter und die SG West als Vierter verpassten diese somit.
In der Saison 1948/49 gab es erstmals wieder so etwas wie einen ansatzweise saisonweisen Spielbetrieb. Die Landesklasse Brandenburg wurde fortan in zwei Gruppen mit jeweils zehn Teilnehmern ausgetragen. Beide Mannschaften der Stadt trafen in der Staffel West aufeinander. Die SG West belegte einen guten vierten Tabellenplatz, während die auf Rang 9 ins Ziel laufende SG Polizei, die in der zweiten Saisonhälfte nach einer politischen Verordnung zur BSG-Gründung als BSG Konsum firmierte, in die Bezirksklasse absteigen musste. Vor dieser Saison war übrigens das Gebot, dass die Spieler nach Wohngebieten den Sportgemeinschaften zugeordnet wurden, aufgehoben worden, wodurch die plötzliche Kräfteverschiebung zwischen der SG Polizei und der SG West zu erklären ist. Denn es gingen einige Spieler des Brandenburger SC 05 zurück zu ihrem alten Verein, der nunmerigen SG West, die sich kurz nach dem Saisonstart in BSG Traktorenwerke umbenennen sollte. Der BSC 05 war vor dem Kriegsbeginn die unbestrittene Nummer 1 der Stadt gewesen, nachdem er (als BBC 05) 1932/33 zwar noch in der drittklassigen Gauklasse A gespielt hatte, anschließend aber von durch die Nazis verordneten zahlreichen Zwangseingliederungen anderer Vereine profitiert hatte, wodurch im August 1933 der BSC 05 gegründet worden war. Der BSC 05 spielte schließlich zwischen 1938 und 1942 für fünf Jahre in der Gauliga Berlin-Brandenburg, welche als eine von 16 Staffeln formell erstklassig gewesen war.
Wie bereits geschrieben, war vor der Saison 1948/49 das Gebot aufgehoben worden, dass die Zuordnung von Spielern zu den jeweiligen Sportgemeinschaften ausschließlich aufgrund ihrer Meldeadresse erfolgte. Zudem hatten sich, nachdem es in den ersten Nachkriegsjahren in der Stadt Brandenburg ausschließlich die Sportgruppen Nord und West gegeben hatte, Betriebssportgemeinschaften gegründet, so dass die Vielfalt der städtischen Vereine langsam wieder anstieg und die Sportler zumindest halbwegs in den gleichen Gemeinschaften Sport treiben konnten, wie vor dem Krieg, wenngleich unter anderem Namen oder veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Gern hätten dies auch die ehemaligen Sportkameraden der Brandenburger Spielvereinigung 1921 getan. Jedoch existierten die beiden Betriebe, denen die Sportler bis zum Zweiten Weltkrieg angehört hatten, das Stahl- und das Walzwerk, zu diesem Zeitpunkt schlichtweg nicht mehr. Beide Werke waren nach dem Kriegsende zwar noch fast vollkommen intakt gewesen, da die Bombenangriffe auf Brandenburg jeweils ausschließlich die Stadtteile getroffen hatten, die östlich der Bahnlinie Brandenburg – Rathenow gelegen hatten. Doch die noch intakte Industrie wurde nach dem Kriegsende abgebaut und als Reparationsleistung komplett in die Sowjetunion verschifft7. Und ohne Trägerbetrieb konnte auch keine BSG existieren! Erst zwei Jahre später wurde mit dem Neubau der Werke begonnen und drei Jahre später die BSG Stahl gegründet, wodurch diese als Neugründung gilt, anstatt dass die Traditionslinie der Brandenburger SV 1921 im gleichen Maße fortgeführt werden konnte, wie es beispielsweise der BSG Motor Süd mit ihrem Vorgängerverein BSC 05 vergönnt war, da Motor Süd mit dem Traktorenwerk einen Trägerbetrieb gefunden hatte, zu welchem vor dem Kriegsbeginn noch keine offiziellen Beziehungen bestanden hatten. Die Spielvereinigung 1921 hingegen war immer ein Werksverein gewesen, der halt nach dem Zweiten Weltkrieg ohne seine ehemaligen Trägerbetriebe dastand und somit seiner Existenzgrundlage beraubt war. Und wodurch Stahl beim Erscheinen dieses Buchs eben „nur“ auf eine 73-jährige anstatt mehr als 100-jährige Geschichte vorweisen kann.
Doch springen wir noch ein paar Jahre zurück: Wie oben geschrieben, belegte die SG Polizei/BSG Konsum in der Saison 1948/49 einen Abstiegsplatz. Sie blieb der Liga aber als Teil eines neu geschaffenen Konstrukts erhalten. Denn nur wenige Monate nach der verordneten Gründung der Betriebssportgemeinschaften wurden, erneut auf politische Verordnung, alle bislang bestehenden BSG zu einer zentralen Sportgemeinschaft (ZSG) für die gesamte Stadt vereint. Die Havelstadt hatte nach dem Kriegsende fußballerisch an Stärke verloren, nicht zuletzt wegen zahlreicher gefallener und des Wegzugs weiterer Spieler, da durch die Zerstörung der Industrie zahlreiche Arbeitsplätze weggefallen waren und die Kicker auszogen, ihren Lebensunterhalt woanders zu verdienen. Ziel der ZSG und der „Bündelung der Kräfte“ war die Bildung einer Mannschaft, die spätestens mittelfristig den Aufstieg in die 1949 gegründete Oberliga schaffen würde. Aus dem Land Brandenburg hatten sich nämlich für deren Premierensaison lediglich die BSG Franz Mehring Marga (im Saisonverlauf in BSG Aktivist Brieske-Ost umbenannt) und die BSG Märkische Volksstimme Babelsberg (später BSG Rotation Babelsberg) qualifiziert. Die neue zentrale Brandenburger Sportgemeinschaft bekam den Namen ZSG Werner Seelenbinder. Als Namensgeber fungierte ein ehemaliger Berliner Ringer, der u.a. sechsmaliger Deutscher Meister, zweimaliger Medaillengewinner bei Europameisterschaften und Halbfinalist bei den Olympischen Spielen 1936 gewesen war. Seelenbinder war jedoch nicht nur Sportler, sondern auch kommunistischer Widerstandskämpfer und hatte bereits bei seinem ersten Meisterschaftsgewinn 1933 den Hitlergruß verweigert, weswegen eine Serie von Inhaftierungen seiner Person begann. 1944 wurde Seelenbinder zum Tode verurteilt und am 24. Oktober gleichen Jahres im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet.
Neben der BSG Konsum gingen in der ZSG u.a. die BSG der Volkswerft Ernst Thälmann und die BSG Traktorenwerke auf. Die neue Brandenburger Mannschaft spielte 1949/50 in der zweitklassigen Landesklasse. Die Heimspiele fanden im Stadtteil Nord auf der ehemaligen Musterwiese statt, welche seit dem Kriegsende ebenfalls den Namen Werner Seelenbinders trug (und bis heute trägt). Der Plan, durch die Zentralisierung den Oberliga-Aufstieg zu schaffen, scheiterte jedoch und endete sogar mit dem „Worst Case Scenario“ des formellen Abstiegs. Nicht nur, dass die ersten beiden Tabellenplätze verpasst wurden, welche das Entscheidungsspiel um die Landesmeisterschaft austragen sollten und deren Meister sich für die Oberliga-Aufstiegsspiele qualifizieren würde. Nein, auch die Qualifikation für die zur Saison 1950/51 ins Leben gerufene DDR-Liga wurde um einen Punkt verfehlt. Die ZSG blieb somit in der Landesklasse, welche ab dem Spieljahr 1950/51 nur noch drittklassig war. Landesmeister wurde übrigens die SG Großräschen durch einen 2:0-Sieg im Entscheidungsspiel bei der ZSG Textil Cottbus, der späteren BSG Fortschritt Cottbus (heute BSV Cottbus-Ost). In der Oberliga-Aufstiegsrunde scheiterte Großräschen allerdings. Für die neue, zweitklassige DDR-Liga qualifizierten sich die SG Volkspolizei Potsdam und die SG Reichsbahn Cottbus.
Endtabelle der Landesklasse Brandenburg 1949/50
Platz
Mannschaft
Tore
Punkte
1.
ZSG Textil Cottbus
77:32
39:13
2.
ZSG Großräschen
68:26
39:13
3.
SG Volkspolizei Potsdam
73:36
36:16
4.
SG Reichsbahn Cottbus
59:38
33:19
5.
ZSG Werner Seelenbinder Brandenburg
62:40
30:22
6.
ZSG Welzow
70:71
28:24
7.
BSG Einigkeit Spremberg
48:41
26:26
8.
BSG TEWA Luckenwalde
64:60
22:30
9.
BSG Einigkeit Forst
48:45
22:30
10.
BSG KWU Guben
54:72
22:30
11.
SG Eintracht Eberswalde
43:76
18:34
12.
ZSG Neuruppin
46:84
18:34
13.
ZSG Wittenberge
44:80
17:35
14.
ZSG Hennigsdorf
37:92
14:38
Kurz nach dem Zusammenschluss als ZSG war die DDR gegründet worden, und wenig später waren auch die politischen Verordnungen plötzlich ganz andere. Nunmehr sollten für jeden Wirtschaftszweig eigene Betriebssportgemeinschaften gebildet werden, worauf die ZSG Werner Seelenbinder wieder „entflochten“ wurde.8 Das neue, politisch nach sowjetischem Vorbild verordnete, Motto lautete nun „Sport auf Produktionsgrundlage“ . In der Leipziger Volkszeitung vom 16. Juli 1950 hieß es hierzu: „Unsere Sportfreunde in der Sowjetunion und den Volksdemokratien haben längst erkannt, dass der schaffende Mensch mit seiner Arbeitsstätte untrennbar verbunden ist, dass über die Tätigkeit an der Werkbank, an der Maschine hinaus, sein kulturelles Erleben hier in der Gemeinschaft gepflegt werden muss, hier eine Heimstätte finden kann und wird. Darum erfolgte die Umstellung der gesamten Sportorganisation in diesen Ländern auf den Betriebssport auf Produktionsgrundlage.“9 Der Passus „…dass der schaffende Mensch mit seiner Arbeitsstätte untrennbar verbunden ist“ und die folgenden bedeuteten zugleich und offenbar bewusst verklausuliert, dass das Sporttreiben außerhalb der Betriebssportgemeinschaften fortan nicht mehr gestattet war.
Aufgrund der neuen Richtlinien hatte sich als erstes die BSG Traktorenwerke wieder von der ZSG abgespalten und spielte schon in der Landesklassen-Saison 1950/51 unter ihrem alten Namen eigenständig, bevor daraus im Februar 1951 die BSG Motor Süd hervorging. Dass die BSG Traktorenwerke den Platz (in der nach wie vor drittklassigen) Landesklasse der ZSG übernehmen durfte, war im Übrigen vollkommen gerecht, da sie diesen Startplatz auch vor der Verschmelzung in die ZSG eingebracht hatte. Aus dem Strang, den die BSG der Volkswerft Ernst Thälmann in die ZSG eingebracht hatte, ging die BSG Anker (ab 1951 BSG Motor Nord) hervor. Und die Fragmente der vormaligen BSG Konsum gründeten am 20. November 1950 die BSG Einheit, die fortan die Brandenburger Krankenanstalten als Trägerbetrieb hatte. Einheit spielte weiter in der viertklassigen Bezirksklasse und damit jener Liga, in die die BSG Konsum 1949 abgestiegen war.
Mit seiner Inbetriebnahme am 20. Juli 1950 kam auch das neu aufgebaute Stahl- und Walzwerk Brandenburg (SWB) für die Gründung einer BSG in Betracht. Die Sportorganisation oblag in der DDR zwischen 1948 und 1957 dem Deutschen Sportausschuss , dessen gemeinsame Träger die Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) und der Gewerkschaftsverband Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) waren. FDJ und FDGB hatten ihre Arbeit im Werk bereits im April aufgenommen, also drei Monate vor dem ersten Stahlabstich, waren jedoch hinsichtlich des Betriebssports lange in keinster Weise aktiv geworden. Da das Treiben von Sport, wie weiter oben erwähnt, nunmehr nur noch in der jeweiligen BSG des eigenen Arbeitgebers gestattet war, führte die dahingehende Inaktivität im SWB zu ansteigender Unzufriedenheit innerhalb der Belegschaft sowie zur von Stahlwerker Dieter Seipelt in der Betriebszeitung vom 25. August 1950 offen gestellten Frage, „was die BGL (Betriebsgewerkschaftsleitung) für den Sport tue“ . 10 Laut Seipelts Leserbrief war zu diesem Zeitpunkt genau ein Fußball vorhanden und er forderte die BGL dazu auf, aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwachen.
Nur eine Woche nach der Veröffentlichung des Briefs machten einige Stahlwerker, auf Initiative des Kollegen und Leichtathleten Rudolf Burgdorf, dann Nägel mit Köpfen: Am 2. September 1950 kam es zum Affront, dass sich die BSG Stahl Brandenburg gründete, ohne dass die Werksleitung, die Einheitspartei SED oder andere staatliche Organe die Initiatoren oder an der Gründung auch nur beteiligt waren. Zum ersten Vorsitzenden der BSG wurde Heinz Sportleiter Sommer, Blaschke gewählt, wurde Kollege der ehemalige Vorsitzende der BSG Anton Saefkow. Kassenwart wurde der Kollege Ewert, Schriftführerin die Kollegin Schulze, für die Berichterstattung würde Kollege Hennig sorgen und für Agitation und Propaganda der Kollege Kensler. Immerhin den BGL-Leiter Röhler und die Kollegin Ulm, die Vorsitzende der FDJ-Betriebsgruppe, konnten die Vereinsgründer um Rudolf Burgdorf für ihr Ansinnen gewinnen. Die Unterstützung des FDGB wurde in der Gründungs-Bekanntmachung zwar ebenfalls mit aufgeführt, jedoch war diese wohl lediglich informeller und duldender Natur. Auf der rechten Seite zu sehen ist die Information zur BSG-Gründung aus der Betriebszeitung Stahlwerk im Aufbau vom 8. September 1950: 11
Überrumpelt von der Gründung, sahen sich die Funktionäre von Betriebsleitung und SED nachträglich in der Pflicht, endlich die Verantwortung für den Betriebssport zu übernehmen. So kam es zur absurden Situation, dass am 25. November eine zweite Gründungsversammlung der BSG Stahl abgehalten wurde, obwohl die ersten Sektionen ihre Aktivitäten längst aufgenommen hatten. Die Vertreter der Werksleitung und der staatlichen Organe sicherten sich nun ihre repräsentativen Posten und neben dem SWB wurden FDJ & FDGB offiziell als Trägerorganisationen der BSG anerkannt. Die Traute, jemanden anderes als den in der Belegschaft beliebten Heinz Blaschke als Vorsitzenden einzusetzen, hatten die Genossen jedoch nicht. Als Vereinsfarben wurden Blau und Schwarz bestimmt. Neben den Fußballern gab es zunächst Sektionen in folgenden Sportarten: Handball, Ringen, Tischtennis, Kegeln, Gymnastik, Leichtathletik, Boxen, Schwimmen, Geräteturnen und Schach. 12
Die in der Stadt Brandenburg in jenen Monaten neben der BSG Stahl neu gegründeten Betriebssportgemeinschaften, die über eine Fußballabteilung verfügten, waren folgende:
BSG Brandenburger Traktorenwerke (VEB Traktorenwerk, später VEB Getriebewerk, ab 1951 BSG Motor Süd)
BSG Einheit (Städtische Krankenanstalten)
BSG Anker (Ernst-Thälmann-Werft, ab 1951 BSG Motor Nord, 1961 aufgelöst. Die Sektionen Rugby, Segeln, Kanu und Billard wechselten zur BSG Stahl, die Sektionen Fußball und Judo zur BSG Lok.)
BSG Anker Plaue (VEB Schiffswerft Plaue, ab 1950 o. 51 BSG Motor Plaue)
BSG Empor (Handels- und Nahrungsgüterwirtschaft)
BSG Post (Post- und Fernmeldewesen)
BSG Aufbau (Bauindustrie)
BSG Motor (Maschinen- und Fahrzeugbau)
BSG Lok (Deutsche Reichsbahn)
BSG Traktor Klein Kreutz (Landwirtschaft)
BSG VP der Strafvollzugsanstalt (Volkspolizei, ab 1963 PSG Dynamo Brandenburg-West).
Und nach der Entstehung der Armee-Sportgemeinschaft Vorwärts Hohenstücken wenige Jahre später hatte schließlich auch das zweite bewaffnete, staatliche Organ seine Sportgemeinschaft.
Bekanntmachung zweite Gründung (Stahlwerk im Aufbau vom 15.12.1950)
Einwurf: Das falsche Gründungsdatum
Auf ihrer Website gibt die BSG den 20. November 1950 als ihr Gründungsdatum an. Wie wir im letzten Kapitel erfahren haben, ist dies nicht ganz korrekt. An jenem Datum wurde nämlich „nur“ Einheit Brandenburg gegründet. Deren Fußballabteilung trat im Januar 1956 zwar der BSG Stahl bei, wodurch zugleich der Bezirksligastartplatz übernommen wurde und Einheit zumindest hinsichtlich der sportlichen Linie als Stahl-Vorgänger anzusehen ist. Die Gründung der BSG Stahl jedoch erfolgte am 2. September bzw. am 25. November 1950.
Der Vereinsvorstand der BSG Stahl wird dieses Buch sicherlich auch lesen und entscheiden müssen, welches Gründungsdatum man sich in Zukunft in die Vita schreibt. Auch wenn ich kein Vereinsmitglied mehr bin, erlaube ich mir den Vorschlag, künftig den 2. September 1950 als eigenes Gründungsdatum anzusehen. Nicht, um die Existenz der BSG künstlich um zweieinhalb Monate nach vorn zu verlängern, was bei einer über 70-jährigen Historie schlichtweg nicht relevant wäre. Sondern, weil von diesem Tag an unter dem Banner der BSG Stahl Brandenburg Sport getrieben wurde. Und es aus der Sicht eines Fußball-Sozialromantikers einfach eine zu schöne Geschichte ist, dass die Vereinsgründung vorbei an den staatlichen Organen erfolgt ist. Damit würde sich Stahl nicht nur von zahlreichen anderen Betriebssportgemeinschaften abgrenzen, die auf politische Initiative hin entstanden sind. Nein, die von Rudolf Burgdorf gegründete BSG war eine, deren ureigenstes und einziges Bestreben es war, unter Arbeitskollegen Sport zu betreiben, frei von politischer Gleichschaltung und Agitation. Den Geist dieser demokratischen Gedanken gilt es aus meiner Sicht, mit der Anerkennung des 2. September 1950 als Gründungsdatum zu bewahren.
Und nicht zuletzt gefällt mir der 2. September besser, weil der Initiator der Vereinsgründung, der Leichtathlet Rudolf Burgdorf, nicht nur ein Läufer war, sondern ein echter Stahlwerker, der damit die Vereinsidentität beispielhaft verkörperte und dessen Vermächtnis es zu ehren gilt.
Das Stahl- und Walzwerk Brandenburg
In einem Buch über einen Fußballverein namens Stahl kommt man natürlich nicht darum herum, auf den namensgebenden Betrieb zumindest in einem Kapitel näher einzugehen. Denn das Brandenburger Stahl- und Walzwerk war nicht nur der „Trägerbetrieb“ der BSG Stahl, sondern darüber hinaus ein identitätsstiftender Betrieb für die ganze Region, ihr größter Arbeitgeber und eines der bekanntesten Symbole der Silhouette der Havelstadt.
Eine verkehrsgünstige Lage unweit der Metropole Berlin, deren in der Nähe liegende Verbindung nach Westen auf Straße und Schiene, der 1910 fertiggestellte Silokanal und riesige Freiflächen waren die wichtigsten Gründe, die Rudolf Weber dazu veranlassten, im Jahr 1912 ein 800.000 m2 großes Gelände neben dem Silokanal zu erwerben, auf dem das erste Stahl- und das erste Walzwerk entstehen sollten. Weber, 1856 in einem Vorort von Siegen zur Welt gekommen, hatte zuvor bereits Werke in Dortmund und im Saarland erbaut. Nach der Schließung des Dortmunder Werks im Jahre 1912 verkaufte er dessen Gelände und setzte seine lang gehegte Idee um, ein Stahlwerk im Großraum Berlin zu errichten. 13
kommen der Hauptstadt stellte eine günstige Rohstoffquelle dar und dank der hervorragenden Anbindung des Stahlwerks an Straße, Schiene und Wasser konnte alles bequem und günstig nach Brandenburg transportiert werden. Die Stahlwerkshalle war zur Zeit der Eröffnung lediglich 60 x 40 Meter groß, wurde später aber in Richtung Silokanal vergrößert. Kurz nach der Eröffnung des Walzwerks bekam jenes eine zweite Halle. Zudem kaufte Weber die Eisengießerei Richter auf, ein 1861 gegründetes Brandenburger Traditionsunternehmen, das fortan die Kokillen des Stahlwerks fertigte, die Gussformen für den Stahl.
Neben den erwartbaren Anlaufschwierigkeiten stellte Weber der wenige Monate nach der Eröffnung begonnene Erste Weltkrieg vor neue Probleme. Aufgrund der sich kriegsbedingt steigernden Produktion war ein weiterer Ausbau für 1 Millionen Mark nötig geworden, ehe der Werksbetrieb im Herbst 1917 fast komplett heruntergefahren werden musste, da die Versorgung mit Kohle weitestgehend zum Erliegen gekommen war. Der Reichskohlekommissar jedenfalls verweigerte weitere Lieferungen, wobei der Verdacht überliefert ist, dass Konkurrenten dahinter steckten, weil sie Weber aus dem Markt drängen wollten. Was schließlich klappte, denn der Werksgründer sah sich noch im gleichen Jahr dazu gezwungen, sein Stahl- und Walzwerk an die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft zu Bochum zu verkaufen, deren Haupteigentümer der rheinische Großindustrielle Hugo Adolf Eugen Victor Stinnes war. Rudolf Weber zog sich nach dem Verkauf ins Privatleben zurück, übersiedelte nach Bonn und lebte dort bis zu seinem Tod im Jahr 1932. Immerhin blieb der Name bestehen, die Fabriken firmierten weiterhin als Stahl- und Walzwerk Weber . Außerdem übertrugen die neuen Eigentümer Webers Neffen nach dem Verkauf die Betriebsleitung und auch die Kohleversorgung lief anschließend wieder an.
Nachdem die Produktion nach dem Kriegsende neue Rekorde erreicht hatte, wurden bis 1923 zwei weitere Siemens-Martin-Öfen erbaut. Im Stahlwerk arbeiteten nun mehr als 1.300 Menschen und durch Gebietszukäufe wurde der Grundstein für den Bau der Walzwerksiedlung gelegt. Einen weiteren Eigentümerwechsel gab es 1926. Stinnes ver-
Werbung für das Stahl- und Walzwerk Weber aus dem Jahr 1934
kaufte die Werke an Friedrich Flick, sie waren fortan Teil der Mitteldeutschen Stahlwerke AG. Die Produktionsleistungen erhöhten sich unter Flick weiter. Und ab 1933 wurden, wie in fast allen anderen Werken der Stadt, größtenteils Kriegsgüter produziert, im Stahl- und Walzwerk beispielsweise Panzerwagen sowie für selbige Kuppeln und Gehäuse. Drei weitere Siemens-Martin-Öfen wurden ausschließlich für die Rüstungsproduktion errichtet und auch ein Teil des Geländes des Bahnausbesserungswerks Kirchmöser nutzte man fortan exklusiv für militärische Zwecke.
Aufgrund seiner Lage fernab des Stadtzentrums war das Werk von den acht Luftangriffen der 8. US-Luftflotte während des Zweiten Weltkriegs fast vollständig verschont geblieben. Bis zum April 1945 lief sogar noch die Produktion, ehe die Rote Armee die Stadt eingenommen hatte, im Zuge des Ringschlussverfahrens um Berlin. Nach dem Kriegsende wurde das intakte Werk schließlich vollständig demontiert und als Reparationsleistung in die Sowjetunion verschifft. Eine mehr als 30-jährige Stahl- und Walzwerkgeschichte auf dem Quenz war vorerst zu Ende, nur ein riesiges Feld voller Schutt und Trümmer hatten die Kriegsgewinner zurück gelassen.
"Heute lacht Brandenburg, heute fließt der Stahl!"14 hieß es jedoch schon am 20. Juli 1950 wieder, nur gut fünf Jahre nach dem Kriegsende. Denn ganze 155 Tage, nachdem mit der Grundsteinlegung für den ersten Siemens-Martin-Ofen Neubau des Stahl- und Walzwerk Brandenburg (SWB) begonnen hatte, erfolgte um kurz nach 12 Uhr der erste Stahl-Abstich.
Den Wiederaufbau hatte Friedrich Franz geleitet, der zuvor Technischer Direktor des Stahlwerks in Thale gewesen war. Franz kam Anfang Dezember 1949 nach Brandenburg, der Grundstein für das neue Werk wurde am 15. Februar 1950 gelegt. Über 4.000 Menschen hatten auf der Baustelle gearbeitet, übrigens hauptsächlich mit ihren Händen und einfachsten Geräten, Baumaschinen gab es fast nicht. Friedrich Franz war sowohl in der Planung, als auch bei der Durchführung des Aufbaus sehr engagiert, kümmerte sich obendrein um Weiterbildungs-Maßnahmen für die Belegschaft und deren soziale Absicherung. Zudem war er zwar als Vorgesetzter durchaus streng, stellte sich aber in jeder Hinsicht vor und hinter die Stahlwerker, was ihm den Spitznamen „Papa Franz“15 einbrachte. Das Werk leitete er bis 1956, blieb ihm aber bis zu seinem Tod im Jahr 1969 eng verbunden. Zum Gedenken an ihn trägt die Hauptzufahrtsstraße zum Stahlwerksgelände heute seinen Namen.
Das Werk nach der Demontage (1947)
Im Frühjahr 1950 beim Wiederaufbau
Das Stahlwerk wurde in den Jahren nach seiner Wiedereröffnung größer als es vor dem Zweiten Weltkrieg je gewesen war. Bis 1953 entstand die große Halle mit elf Siemens-Martin-Öfen. Jene stand nun parallel zum Silokanal und war sage und schreibe 420 Meter lang! Nebenan entstand eine Generatorhalle zur Erzeugung von Gas aus Rohbraunkohle, mit denen die Siemens-Martin-Öfen beheizt wurden. Das Stahlwerk war nun optisch weithin sichtbar. Seine insgesamt 16 Schornsteine, jeweils 70 Meter hoch, prägten fortan die Stadtsilhouette und waren nicht nur identitätsstiftend, sondern für alle Brandenburger auch ein Zeichen, dass man nach einer Ortsabwesenheit wieder zu Hause war.
Bis 1967 entstanden schließlich zwei weitere Öfen. Da das Werk die staatlichen Planauflagen jedoch auch mit den zusätzlichen Öfen nicht mehr erreichte, wurde es ab 1970 modernisiert, um die Produktivität zu steigern. Eine zusätzliche Erweiterung erhielt das Werk mit dem 1980 eröffneten Elektrostahlwerk südwestlich des Stadions. In allen Werken zusammen arbeiteten zu jener Zeit über 10.000 Beschäftigte, was das SWB zum größten Rohstahlproduzenten der DDR machte. Ein Drittel des im Lande produzierten Rohstahls kam aus der Havelstadt! 1979 wanderte zudem die Leitung des Kombinat Qualitäts- und Edelstahl von Hennigsdorf an den Quenz. Unter dessen Dach standen in der gesamten Republik etwa 35.000 Werktätige in Lohn und Brot.
Nach der Wende stellte sich schnell heraus, dass das Stahlwerk und seine Siemens-Martin-Öfen auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Die Technik war gegenüber der in Westeuropa oder den Altbundesländern um etwa 30 Jahre veraltet. Gewerkschaften wie die IG Metall sowie Partein wie die SPD und die PDS versuchten zwar, das Werk zu retten. Aber auch europaweit war die Stahlindustrie am Ende. Mit der Schließung des Werks in Duisburg-Rheinhausen beispielsweise endete am 15. August 1993 die fast 100-jährige Ära der Kruppschen Hüttenwerke. Der letzte Brandenburger Stahlabstich erfolgte schließlich am 13. Dezember 1993, die letzte Walzung zwei Tage später. Im ersten Quartal 1994 begann der Abriss der Werksanlagen. Bestrebungen, wenigstens einen Schornstein als Industriedenkmal zu erhalten, scheiterten. Lediglich das Elektrostahlwerk war 1992 vom italienischen Konzern Riva übernommen worden und produziert bis heute. Die Werkshalle des Stammbetriebs allerdings wurde komplett entkernt, in ihr existiert heute das Industriemuseum, das den Geist der Stahlwerker und die Erinnerung an die insgesamt fast 80-jährige Werksgeschichte wach hält. Zwischen dem Industriemuseum und der BSG Stahl existieren gegenwärtig übrigens wieder lebendige Kontakte, sogar die Mannschaftsbilder wurden in den letzten Jahren immer wieder in den „Heiligen Hallen“ aufgenommen. Mit dem Riva-Konzern hingegen gibt es leider bis heute keinerlei Zusammenarbeit.
„Papa Franz“ (mit Hut) auf einem Graffito an der Magdeburger Landstraße
Die elf Schornsteine der großen Stahlwerkshalle, vom Silokanal aus gesehen
(Vergebliche) Demonstration der IG Metall zum Erhalt des Werks (1991)
Vereinsgeschichte, Teil 3: 1950 bis 1960
Die erste Gründung der BSG Stahl war, wie auf den Seiten 34 und 35 beschrieben, am 2. September 1950 erfolgt. Bereits kurz danach nahmen die ersten Sektionen den Trainingsbetrieb auf. Leichtathlet Rudolf Burgdorf, der seinerzeit auch die Gründung initiiert hatte, war schließlich der erste Sportler, der die BSG Stahl Brandenburg in einem Wettkampf vertreten sollte. Am 21. Oktober ging er beim Potsdamer Polizeisportfest im Ernst-Thälmann-Stadion im 3000-Meter-Lauf an den Start und belegte den sechsten Platz.16
Die Sektion Fußball gründete sich am 13. November 1950, also zwölf Tage vor der zweiten Gründungsversammlung. Trainiert und gespielt wurde aber erst ab Februar 1951. Zuvor hatte es schlichtweg kein Trainingsmaterial und keine Sportbekleidung gegeben. 17 Die Fußballsektion startete mit ganzen 24 Mitgliedern. Trainiert wurde zunächst nur einmal pro Woche, nämlich donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr. Am 10. Februar kam es auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz zu einem ersten Freundschaftsspiel. Gegen Einheit Brandenburg, die BSG der Städtischen Krankenanstalten, wurde trotz 1:4-Rückstand noch mit 5:4 gewonnen. Immerhin war Einheit seinerzeit eine gestandene Mannschaft in der viertklassigen Bezirksklasse, Stahl hingegen hatte sich erst ganz frisch formiert, gehörte noch gar keiner Liga an und hatte sogar erst ein einziges Mal (!) gemeinsam trainiert. Der Sieg über Einheit muss also als absolute Sensation eingeordnet werden! Vom 17. Februar 1951 ist ein zweites Spiel bekannt. Stahl gewann bei der zweiten Mannschaft der Bau-Union Ost Brandenburg, einem Vorgänger der späteren BSG Aufbau, mit 6:1 Toren. Leider gibt es keine Informationen über den Austragungsort, seitens Stahl wurden nach dem Spiel lediglich die schlechten Platzverhältnisse bemängelt. Überliefert sind zudem erstmals ein paar Namen damaliger Stahl-Akteure. Als beste Spieler in der Betriebszeitung Stahlwerk im Aufbau vom 03.03.1951 erwähnt wurden „Torwart Klinke, Woltschke und Sportfreund Fischer als Mittelstürmer“. Weitere von 1951 bekannte Freundschaftsspiel-Ergebnisse der ersten Mannschaft sind ein 0:4 bei Anker Brandenburg, ein 2:3 bei Empor Schenkenberg, ein 1:6 bei Konsum Pritzerbe, ein 1:1 bei der SG Brück und ein 3:1 bei Anker Plaue. Zudem gab es seinerzeit einen Pokal der Vereinigung Stahl . Im ersten Spiel ereilte Stahl aber durch ein 0:6 in Wildau gleich das Aus.
Das erste Mannschaftsfoto: Stahl 1951/52 auf dem Gördensportplatz
Erstmals am Punktspielbetrieb nahm Stahl in der Saison 1951/52 teil, mit folgender Stammmannschaft: Sperling (Tor), Wusow (linker Verteidiger), Bahrke (rechter Verteidiger), Spitta (linker Läufer), Pätzke (Mittelläufer), Rabe (rechter Läufer), Kotzian, Prill (linke Stürmer), Lyck (Mittelstürmer), Kranz und Klinke (rechte Stürmer). 18 Gestartet wurde in der Kreisliga Brandenburg-Stadt. Leider sind aus jener Saison nur etwa zehn Ergebnisse überliefert, wie das 7:2 gegen Stahlbau Brandenburg am 2. September 1951 im ersten Punktspiel der Vereinsgeschichte oder ein spektakuläres 6:7 gegen Traktor Groß Kreutz. In der Märkischen Volksstimme gab es erst ab Januar 1952 eine Berichterstattung über die Kreisliga, und jene war alles andere als lückenlos. Eine Tabelle wurde sogar kein einziges Mal abgedruckt. Stahls erreichte Endplatzierung lässt sich somit nicht verifizieren. Ein MV-Kurzkommentar nach dem letzten Spieltag besagte allerdings, dass Stahl „hinter Motor Plaue ins Ziel gelaufen“ sei. Da die Plauer Meister wurden, was verbrieft ist, landete Stahl wahrscheinlich auf Rang 2. Plaue verzichtete anschließend trotz erfolgreicher Aufstiegsspiele auf die Bezirksklasse und blieb Kreisligist. Warum wiederum Stahl ab 1952/53 in der Bezirksklasse spielte, konnte nicht mehr herausgefunden werden. Eventuell deshalb, weil die Anzahl der Ligen oberhalb der Kreisebene erhöht wurde. Denn aus der Landesklasse Brandenburg wurden ab 1952/53 die drei Bezirksligen Potsdam, Frankfurt/Oder und Cottbus. Und somit gab es auch eine stark erhöhte Anzahl der Bezirksklassen auf dem Gebiet des bisherigen Landes Brandenburg (von zwei auf sieben.) In jener Bezirksklasse konnte sich Stahl 1952/53 als Siebter mit 45:53 Toren und 20:20 Punkten behaupten. Begonnen hatte die Serie gar noch besser, nach vier Spielen stand Stahl mit vier Siegen auf dem ersten Tabellenplatz. Jedoch folgte anschließend eine schwarze Serie und aus den letzten sechs Hinrundenspielen kam nur noch ein einziger Zähler hinzu. In die Winterpause ging Stahl als Achter (von elf Mannschaften) mit 21:29 Toren und 9:11 Punkten. Der Abwärtstrend konnte in der Rückrunde jedoch gestoppt werden: Hinzu kamen 24:24 Tore und 11:9 Punkte. Für einen Neuling, der zugleich die unerfahrenste Mannschaft der Liga darstellte, war dieses Endergebnis beachtlich, auch wenn nach dem fantastischen Saisonstart mehr möglich schien. Ein Jahr später rief Stahl sein Potenzial dann deutlich häufiger ab und unterlag weitaus geringeren Leistungsschwankungen. Am Saisonende schrammte die Mannschaft mit vier Punkten Rückstand auf Kirchmöser knapp an der Staffel-Meisterschaft vorbei, als man schlussendlich als stolzer Tabellenzweiter ins Ziel lief. Nach diversen Einsprüchen gegen Spielwertungen aufgrund des Einsatzes von nicht spielberechtigten Akteuren wurde vom Verbandssportgericht eine salomonische Lösung gefunden und beide Mannschaften mussten den Meister in zwei Entscheidungsspielen ermitteln. In Kirchmöser wurde 2:3 verloren, daheim mit 2:1 gewonnen. Das somit notwendige dritte Spiel endete 1:3.
Die Stahl-Mannschaft der Saison 1952/53 (rechts der junge Dieter Löffler)
Die Stahl-Elf der Saison 1953/54 im Trainingslager in Bollmannsruh
Immerhin stammt aus dieser Saison der höchste Punktspielsieg der Vereinsgeschichte: Die SG Bornim wurde mit sage und schreibe 13:0 besiegt. Auch gab es Stahls erste Bezirkspokalspiele. Es wurde jedoch kein eigener Pokal ausgespielt, sondern die Spiele dienten lediglich als Qualifikation für den landesweiten Wettbewerb. Stahl hatte in der ersten Runde ein Freilos, gewann in der zweiten Runde mit 4:2 bei Turbine Trebbin und wäre dann auf Einheit Brandenburg getroffen. Dieses Spiel war aber aufgrund der Entscheidungsspiele gegen Kirchmöser schon verschoben und für Himmelfahrt neu terminiert worden. Als beide ins dritte Spiel mussten, hatte dieses terminlich Vorrang, da der Sieger auch noch die Bezirksliga-Aufstiegsspiele würde bestreiten müssen. Somit trat Stahl zum Pokalspiel gegen Einheit nicht an. Gegen den frisch gebackenen Liga-Aufsteiger wäre es aber ohnehin schwer geworden!
Bezirksklasse-Entscheidungsspiel 1954: Gegen Kirchmöser auf der Musterwiese
Nach 2:3 auswärts und 2:1 daheim verliert Stahl das dritte Spiel mit 1:3
In der Saison 1954/55 wurde die Meisterschaft sogar noch knapper verpasst. Was sensationell war vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft in der vorherigen Sommerpause schwerwiegende Abgänge zu verkraften hatte, u.a. die Rückkehr der legendären Rinkenbach-Brüder Jupp und Otto zur BSG Motor Süd. Lediglich der älteste Rinkenbach-Bruder Johann (Rinkenbach I, auch „Hans“ genannt) blieb bei Stahl. Trotzdem stand unsere Mannschaft nach ihrem letzten Spiel am Karfreitag gegen Motor Nord Brandenburg (1:0) auf dem ersten Tabellenplatz, musste jedoch zusehen, wie Empor Südwest Potsdam am Ostermontag durch einen 7:1-Sieg in einem Nachholspiel noch aufgrund des besseren Torverhältnisses vorbeizog und in die Bezirksliga aufstieg.
Stahl 1954/55: Hinten von links: Günter Boede, Hans Rinkenbach, Horst Fähling, Horst Ruschitzky, Benno Pass, Kurt Morgenrot, Fietje Filipeit, Horst Heideck, Harry Mrugalski. Vorne von links: Rudi Künzer, Heiner Raatz, Schwager Bertz.
Wenige Monate später fand sich Stahl am anderen Ende der Tabelle wieder. Da die Saison 1955 nur eine halbe war und als Übergangsrunde vom jahresübergreifenden auf den Jahres-Spielrhythmus galt, gab es aber keine Absteiger, so dass die Gefahr eines Abrutschens zurück auf die Kreisebene nie gegeben war. Stahl enttäuschte unterm Strich in diesem Halbjahr und wurde nur Zehnter. Und auch ein besonderes Spiel verlief enttäuschend: Das zweite Übergangsrunden-Heimspiel gegen Motor Plaue am 2. Oktober 1955 war das Eröffnungsspiel des Stahl-Stadions! Stahl verlor eindeutig mit 0:3. Mit Rudi Künzer weilt heute leider nur noch einer der damals für Stahl auflaufenden Spieler unter uns. Und mir als Autor dieses Buchs sei diese persönliche Anmerkung gestattet: Mein Großvater mütterlicherseits, Siegfried Beyenbach, stand damals für die Plauer Gäste auf dem Platz.
In der Saison 1955 war die II. DDR-Liga als dritthöchste Spielklasse eingeführt worden. Da Stahl nach wie vor in der Bezirksklasse festhing, waren die Quenz-Kicker somit erstmals nur noch fünftklassig. Doch dies lediglich für ganze zwölf Spiele, denn nach der Übergangsrunde schloss sich zum 1. Januar 1956 die Fußball-Sektion von Einheit Brandenburg der BSG Stahl an. Die Mannschaft konnte den Einheit-Startplatz in der Bezirksliga übernehmen. Außerdem wurden die Vereinsfarben geändert. Bei Stahl waren jene bis dahin Blau-Schwarz gewesen, bei Einheit die Stadtfarben Blau-Weiß-Grün. Künftig sollte man gemeinsam unter dem blau-weißen Banner antreten, aber in roten Trikots. In jenen hatten die Einheit-Fußballer nämlich traditionell gekickt, zudem war Rot die Farbe der Sportvereinigung Stahl. Und nicht zuletzt stieg durch den Beitritt der Einheit-Fußballer die Mitgliederzahl der BSG von zuvor 880 auf erstmals über 1.000.