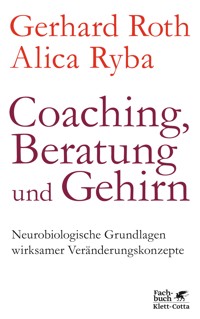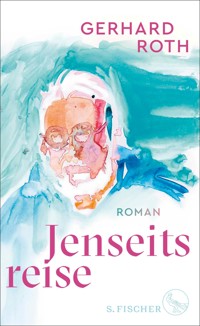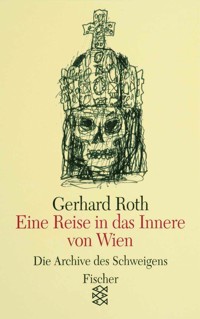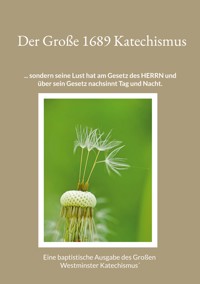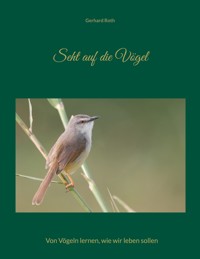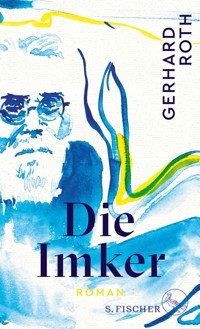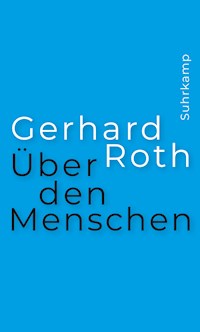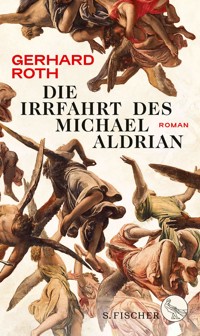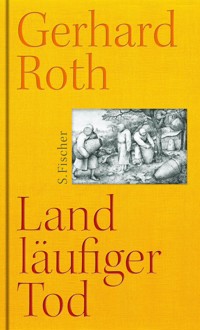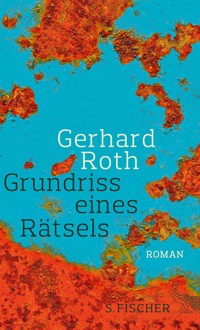14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Gehirn ist der Sitz der Seele. Aber wie genau entstehen das Psychische, unsere Persönlichkeit, unser Ich? Worauf beruhen psychische Erkrankungen? Und wie kann man sie therapieren? In der vollständig überarbeiteten Neuauflage hinterfragen die Autoren außerdem die Wirkung anerkannter Psychotherapien und stellen eine neue Art der Therapie vor, die auf jüngsten Erkenntnissen der Neurobiologie fußt. Die jüngsten Fortschritte der Neurowissenschaften in Kombination mit modernen Forschungsmethoden machen es möglich, fundierte Antworten darauf zu geben, - wo im Gehirn die Seele zu verorten ist - wie der Aufbau der Persönlichkeit verläuft - worauf psychische Erkrankungen beruhen - warum die Wirksamkeit von Psychotherapien nicht gut belegt ist - warum alte Muster immer wieder unser Verhalten bestimmen und so schwierig zu verändern sind - warum Menschen mit antisozialen Persönlichkeitsstrukturen nur schwer behandelbar sind - wie man im Rahmen der Psychotherapie oder mit Medikamenten auf die Psyche einwirken kann. »Dieses Buch dürfte für neuen Diskussionsstoff sorgen.« Steve Ayan, Spektrum der Wissenschaft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gerhard Roth/Nicole Strüber
Wie das Gehirn die Seele macht
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2014/2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Ulf Müller, Köln
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96251-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10750-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage 2018
Vorwort
Einleitung
Kapitel 1 Die Suche nach dem Sitz der Seele
1.1 Die antike und mittelalterliche Seelenlehre
1.2 Die neuzeitliche Suche nach dem »Sitz der Seele«
1.3 Experimentelle Hirnforschung und Seele-Geist
1.4 Wo stehen wir heute?
Kapitel 2 Gehirn und limbisches System
2.1 Allgemeiner Aufbau des Gehirns
2.2 Bau und Funktion des limbischen Systems als Sitz des Psychischen
2.3 Was lernen wir daraus?
Kapitel 3 Die Sprache der Seele: Neuromodulatoren, Neuropeptide und Neurohormone
3.1 Dopamin
3.2 Serotonin
3.3 Noradrenalin
3.4 Acetylcholin
3.5 Endogene Opioide
3.6 Oxytocin
3.7 Vasopressin
3.8 Cortisol
3.9 Zusammenfassung: Sechs psychoneuronale Grundsysteme
Kapitel 4 Die Entwicklung des Gehirns und der kindlichen Psyche
4.1 Die Entwicklung des Gehirns
4.2 Die Entwicklung der kindlichen Psyche
4.3 Was lernen wir daraus?
Kapitel 5 Persönlichkeit und ihre neurobiologischen Grundlagen
5.1 Die gängigen psychologischen Bestimmungen der Persönlichkeit
5.2 Die neurobiologischen Grundlagen der Persönlichkeit
5.3 Was sagt uns das alles?
Kapitel 6 Das Bewusstsein, das Vorbewusste und das Unbewusste
6.1 Die Erscheinungsformen des Unbewussten
6.2 Die Erscheinungsformen des Bewusstseins und des Vorbewussten
6.3 Die Funktionen des Bewusstseins
6.4 Die neurobiologischen Grundlagen des Bewusstseins
6.5 Wie verhalten sich nun Geist-Bewusstsein und Gehirn zueinander?
6.6 Was sagt uns das alles?
Kapitel 7 Psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen
7.1 Depressionen
7.2 Angststörungen
7.3 Posttraumatische Belastungsstörung
7.4 Zwangsstörung
7.5 Borderline-Persönlichkeitsstörung
7.6 Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Psychopathie
7.7 Psychische Erkrankungen und das Gehirn: Was sagt uns das?
Kapitel 8 Psychotherapien und ihre Wirkungen
8.1 Psychotherapie-Formen
8.2 Ergebnisse der Psychotherapie-Wirksamkeitsforschung
8.3 Was sagt uns das alles?
Kapitel 9 Die Wirkungsweise von Psychotherapie aus Sicht der Neurowissenschaften
9.1 Welche Methoden besitzt die Neurobiologie, um die Wirksamkeit von Psychotherapien zu überprüfen?
9.2 Neurowissenschaftliche Beurteilung der Therapiewirkungsforschung
9.3 Grundzüge einer »Allgemeinen Psychotherapie auf neurowissenschaftlicher Grundlage«
9.4 Was bedeuten diese Erkenntnisse für eine »Neuropsychotherapie«?
Kapitel 10 Zusammenfassung
10.1 Eine naturalistische Sicht der Seele
10.2 Seele und Persönlichkeit
10.3 Neurobiologische Grundlagen psychischer Störungen
10.4 Konsequenzen für die Psychotherapie
10.5 Die partielle Autonomie des Psychischen
Literatur
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8:
Kapitel 9
Kapitel 10
Register
Im Andenken an Manfred Cierpka in Dankbarkeit
Vorwort zur Neuauflage 2018
Das vorliegende Buch hat seit seinem Erscheinen vor rund dreieinhalb Jahren eine große und überwiegend sehr positive Aufmerksamkeit erfahren. Das war nicht unbedingt zu erwarten, geht es doch in dem Buch um Dinge, die gleich mehrere Disziplinen in ihren Kernbereichen betreffen, wie die Psychologie, die Neurobiologie und die Psychiatrie und insbesondere auch die Psychotherapie in Theorie und Praxis. Letztere beleuchten wir aus neurobiologischer Sicht und hinterfragen kritisch bisherige Annahmen über Wirkmechanismen. Neben zahlreichen eingeladenen Vorträgen spielten dabei Vorlesungen, Seminare und Diskussionsrunden im Rahmen der Lindauer Psychotherapiewochen eine bereichernde Rolle. Wir legen nun mit dem Erscheinen der Taschenbuchausgabe eine grundlegend überarbeitete und in Teilen erweiterte Fassung vor. Die Überarbeitung betrifft neben stilistischen Verbesserungen und sachlichen Korrekturen auch die Einarbeitung der Fachliteratur, die seither erschienen ist. Insbesondere haben wir versucht, am Ende des Buches unseren Lesern eine plausible Antwort auf die uns häufig gestellte Frage zu geben, was denn all das für die Praxis der Psychotherapie bedeutet. Dies mündet in einem Modell für eine neurowissenschaftlich fundierte und schulenübergreifende Psychotherapie, wie sie bereits Klaus Grawe in seinem Spätwerk »Neuropsychotherapie« von 2004 angestrebt hatte. Über die Personen hinaus, denen wir bereits im Vorwort zur 1. Auflage gedankt haben, möchten wir herzlich Prof. Ulrich Egle und Dipl. Psych. Georg Hoffmann danken. Diese Ausgabe unseres Buches ist unserem verstorbenen Freund und Kollegen Prof. Manfred Cierpka in Dankbarkeit gewidmet.
Bremen, Lilienthal und Brancoli/Lucca, Februar 2018.
Vorwort
Die eingehende Beschäftigung mit der Thematik dieses Buches begann 1997 mit der Gründung des Hanse-Wissenschaftskollegs, einer Einrichtung der Bundesländer Niedersachsen und Bremen in der zwischen Oldenburg und Bremen gelegenen Stadt Delmenhorst. Es ging damals darum, die wissenschaftliche interdisziplinäre Tätigkeit des Hanse-Kollegs längerfristig zu planen, und bei der Suche nach einem großen Rahmenthema entschieden wir uns für »Determinanten menschlichen Verhaltens«, die wir in den Bereichen der Neuro- und Kognitionswissenschaften, der Philosophie, der Sozialwissenschaften und der Anthropologie in Einzelprojekten behandeln wollten. Was uns und dem damaligen, leider viel zu früh verstorbenen Mitarbeiter Uwe Opolka dabei sehr am Herzen lag, war das Thema »Seele und Gehirn«. Wir wollten Neurobiologen, Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten und Philosophen zusammenbringen und zu gemeinsamen transdisziplinären Diskursen und Projekten anregen.
Schnell waren »Gründungsväter« für das Projekt »Seele und Gehirn« gefunden, vor allen anderen der Heidelberger Psychiater und Psychotherapeut Manfred Cierpka, hinzu kamen als weitere Kollegen Horst Kächele aus Ulm, Peter Buchheim aus München, Ulrich Sachsse aus Göttingen, Thomas Münte, seinerzeit aus Magdeburg, und Eckart Altenmüller aus Hannover, mit denen wir über zehn Jahre hinweg viele kleinere und größere Tagungen am Hanse-Kolleg und in Heidelberg, Ulm und München durchführten. Später kam eine ganze Reihe jüngerer Kolleginnen und Kollegen hinzu wie Anna Buchheim (heute Innsbruck), Svenja Taubner (heute Heidelberg), Daniel Wiswede (heute Lübeck), Daniel Strüber (heute Oldenburg), Cord Benecke (heute Kassel), John Dylan Haynes (heute Berlin) und Henrik Kessler (heute Bonn).
Wir merkten aber bald, dass über diesen engen Kreis hinaus die Bereitschaft zu einem intensiven Gespräch zwischen den Neuro- und Kognitionswissenschaftlern einerseits und den Psychiatern und Psychotherapeuten andererseits bei den von uns angesprochenen Personen anfangs nicht sehr groß war. Viele naturwissenschaftlich orientierte Psychiater, Neurologen und Neurobiologen sahen skeptisch bis geringschätzig auf die Psychotherapeuten und ihr »unwissenschaftliches Tun« herab, während für diese wiederum die Neurobiologen und die ihnen nahestehenden Psychologen nichts als hartgesottene Reduktionisten waren, mit denen zu sprechen sich nicht lohnte. Es brauchte unsererseits viel Überredungskunst, bis es zu ersten größeren Zusammenkünften und zu einem gegenseitigen Verstehen kam.
Ein besonderes Ereignis war die Einladung an G. R., als erster Neurobiologe auf den angesehenen Lindauer Psychotherapiewochen einen Vortrag zu halten, der dann den Titel trug: »Wie das Gehirn die Seele macht«. Dieser Titel stammte von Manfred Cierpka, und wir haben ihn auch für das vorliegende Buch gewählt. Der Vortrag stieß zu unser aller Erstaunen auf große Resonanz, was zur Folge hatte, dass ähnliche Auftritte in Lindau von nun an ungefähr alle zwei Jahre stattfanden und das Interesse der Psychotherapeuten, mehrheitlich Psychoanalytiker und Tiefenpsychologen, an der Hirnforschung stetig wuchs.
Am Hanse-Wissenschaftskolleg gelang es uns, den berühmtesten lebenden Neurobiologen, Eric (1)Kandel, im Rahmen eines »Kurz-Fellowships« nach Delmenhorst und Bremen zu holen. Kandel forderte uns und unsere Kolleginnen und Kollegen aus Neurobiologie, Psychiatrie und Psychotherapie nachdrücklich zur Zusammenarbeit auf. Dies war dann auch der Auslöser für die erste Wirksamkeitsstudie zur (1)psychodynamischen Therapie an depressiven Patienten, die mithilfe bildgebender Verfahren durchgeführt wurde. Bekannt geworden ist sie unter dem Namen »(1)Hanse-Neuro-Psychoanalyse-Studie (HNPS)«, weil sie institutionell vom Hanse-Wissenschaftskolleg getragen wurde.
Die Zusammenarbeit im Kontext vieler Tagungen in Delmenhorst, Heidelberg, Lindau und an zahlreichen anderen Orten sowie im Rahmen der HNPS und sich anschließender Projekte entwickelte sich zu einem langsamen, aber doch deutlichen Erfolg. Dies heißt aber keineswegs, dass sich der »Traum« von Sigmund Freud, Eric (2)Kandel und dem leider früh verstorbenen Klaus (1)Grawe, eine neurobiologische Fundierung der Psychiatrie und Psychotherapie zu erreichen, von selbst verwirklichen würde. Denn während die (1)kognitive Verhaltenstherapie schon seit Langem die Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern sucht, öffnet man sich dem in der psychoanalytischen Therapie nur zögerlich. Hier ist der Widerstand von ausschließlich geisteswissenschaftlich orientierten Psychoanalytikern bzw. Psychodynamikern noch immer groß. Selbst ein so bedeutendes Buch wie die Neuropsychotherapie von Klaus (2)Grawe wird von manchen Psychoanalytikern auch zehn Jahre nach seinem Erscheinen geradezu verteufelt. »Wenn ich als Psychoanalytiker noch etwas dazulernen will, greife ich lieber zu einem Buch von Habermas, als dass ich in ein neurobiologisches Lehrbuch hineinschaue!«, hieß es auf einer Tagung zu Fragen der Kinder- und Jugendpsychotherapie.
Einer solchen Abwehrhaltung, die vielerlei Gründe hat, steht die Tatsache gegenüber, dass seit dem Erscheinen des genannten Buchs von Grawe die Erforschung der neurobiologischen Grundlagen des Seelisch-Geistigen abermals große Fortschritte gemacht hat. Das betrifft alle Aspekte dieser Thematik, angefangen von der Entwicklung der Persönlichkeit und dem Entstehen von Geist und Bewusstsein über die Ursachen psychischer Erkrankungen bis hin zu Fragen der Wirkungsweise von Psychotherapien aus neurobiologischer Sicht. Diese Erkenntnisfortschritte in verständlicher Weise darzulegen ist das Hauptziel des vorliegenden Buches.
Ein weiterer entscheidender Schritt für das Zustandekommen unseres Buches war unsere umfassende und integrative Aufarbeitung psychologischer und neurobiologischer Befunde, die die Rolle frühkindlichen Stresserlebens beim Entstehen psychischer Störungen beleuchten. In dieser Aufarbeitung, die wir im Rahmen einer Projektarbeit durchführten, wurde uns bewusst, welche Bedeutung insbesondere die frühen Erfahrungen innerhalb kritischer sensibler Perioden(1), aber auch die genetisch-epigenetische Ausstattung des Menschen für seine spätere Persönlichkeit und die Entwicklung psychischer Erkrankungen haben. Es wurde deutlich, dass es während der Entwicklung vor allem die komplizierte Neurochemie ist, die sich in ihrer Funktionsweise den jeweiligen Lebensumständen anpasst: Bei Vorliegen ungünstiger genetisch-epigenetischer Prädispositionen, kombiniert mit negativen oder gar traumatischen Erfahrungen, erfährt sie langfristige Veränderungen und begünstigt so die Entstehung von psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen.
Grundlage unserer Überlegungen ist eine »naturalistische« Sicht des Seelischen, der zufolge sich Psyche und Geist in das Naturgeschehen einfügen und dieses nicht transzendieren. Daher rührt die strenge empirische Ausrichtung unserer Argumente. Gleichzeitig versuchen wir, die Fallstricke eines unfruchtbaren neurobiologischen (1)Reduktionismus zu vermeiden. Inwieweit uns dies gelungen ist, hat der Leser zu entscheiden.
Wir danken einer Reihe von Personen, die uns bei der Abfassung dieses Buches geholfen haben. Vor allem danken wir unseren Ehepartnern Prof. Ursula Dicke (Universität Bremen) und Prof. Daniel Strüber (Universität Oldenburg) für den ständigen fachlichen Rat und im Falle von Prof. Dicke für die wertvolle Hilfe bei der Anfertigung von Abbildungen. Weiterhin gilt für die kritische Lektüre einzelner Teile des Buches sowie die fachliche Beratung unser Dank (in alphabetischer Reihenfolge) Prof. Cord Benecke (Kassel), Mark Borner (Berlin), Prof. Georg Bruns (Bremen), Prof. Manfred Cierpka (Heidelberg), Annette Goldschmitt-Helfrich, Werner Helfrich (beide Bremen), Prof. Otto Kernberg (New York), Prof. Manfred Pauen (Berlin) und Dr. Iris Reiner (Mainz).
Bremen, Lilienthal und Brancoli/Lucca,
Mai 2014.
Einleitung
Seit Menschen damit begonnen haben, über sich und ihre Existenz nachzudenken, war ihnen das eigene Fühlen, Denken und Handeln rätselhaft. Die Welt um sie herum war zwar auch voller geheimnisvoller Vorgänge, doch bald lernten sie, durch Naturbeobachtungen und damit verbundene mythisch-religiöse Vorstellungen Ordnung in diese Welt zu bringen. Die religiösen Anschauungen über die Natur und den Gang der Dinge wurden jedoch mehr und mehr durch wissenschaftliche Erklärungen ersetzt, auch wenn viele diese »Entzauberung der Welt« bedauerten und manche sie bekämpften. Heute scheint innerhalb der »harten« Naturwissenschaften fast nur noch im Bereich der Quantenphysik und der Kosmologie einiges vollkommen unerklärlich zu sein. Innerhalb der Biowissenschaften sind die Vorgänge, die einen Organismus am Leben erhalten, und ebenso diejenigen der Vererbung weitgehend aufgeklärt oder lassen eine solche Aufklärung in naher Zukunft vermuten. Dies gilt auch für die Prozesse, die im Gehirn auf der Ebene einzelner Nervenzellen und ihrer Bestandteile und innerhalb kleinerer Zellverbände ablaufen. Kaum ein Naturwissenschaftler vermutet hier noch geheimnisvolle Kräfte, die die Grenzen des Naturgeschehens überschreiten. Vielmehr herrscht die Vorstellung von der »Einheit der Natur« vor, die besagt, dass dieselben Prinzipien, die für die unbelebte Natur gelten, auch in der belebten Natur wirksam sind. Das war bis ins späte 19. Jahrhundert nicht selbstverständlich, denn bis dahin nahm man an, Lebewesen würden von ganz anderen Kräften und Prinzipien bestimmt als die unbelebte Natur, z.B. von einer mystischen Lebenskraft (vis vitalis). Man glaubte, es gebe in den Lebewesen eine spezifische »organische« Chemie, die sich von der »anorganischen« Chemie der unbelebten Materie grundsätzlich unterscheide. Der Nachweis durch Friedrich Wöhler im Jahre 1828, dass die »anorganische« und die »organische Chemie« denselben Gesetzen unterliegen, war ein großer Wendepunkt der Wissenschaftsgeschichte, auch wenn diese Tatsache nur sehr langsam akzeptiert wurde und es bis heute vitalistische Konzepte gibt.
Einen solchen Erkenntnisfortschritt hat es hinsichtlich solcher Fragen wie »Was sind Geist und Bewusstsein?«, »Woher kommen meine Gefühle und meine Gedanken?« oder »Warum handle ich in dieser Weise und nicht anders?« – also hinsichtlich dessen, was man in einem umfassenderen Sinn als das »Seelische« des Menschen versteht – augenscheinlich nicht gegeben. Auch wenn sich seit Langem die Philosophen, später auch die Psychologen und noch später die Neurobiologen mit Antworten auf diese Fragen abmühen, so herrscht auch unter ihnen bislang keinerlei Konsens vergleichbar dem unter Physikern, Chemikern und Biologen. Erstaunlich viele Philosophen und sonstige Geisteswissenschaftler, aber auch viele Psychiater und Psychotherapeuten sind heute noch der festen Überzeugung, dass bei seelisch-geistigen Zuständen Prinzipien wirken, die die Grenzen des Naturgeschehens und einer naturalistischen Erklärung überschreiten. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht Bücher und Artikel erscheinen, in denen Geisteswissenschaftler vehement gegen die »reduktionistischen Anmaßungen« und »naturalistischen Grenzüberschreitungen« der Hirnforschung zu Felde ziehen und die Einzigartigkeit des menschlichen Geistes herausstreichen.
Eine solche Haltung ist durchaus verständlich. In unserem täglichen Empfinden und Erleben sind Bewusstsein, Denken und Fühlen etwas ganz anderes als die materielle Welt um uns herum. Geist und Gefühle kann man – so scheint es – grundsätzlich nicht messen und wiegen; sie haben offenbar gar keine Ausdehnung und kein Gewicht, keinen definitiven Ort, und ihre zeitlichen Eigenschaften sind verwirrend. Eine strikte Kausalität zwischen Gedanken oder Gefühlen in der Weise, dass ein bestimmter Gedanke einen anderen erzwingt, ein bestimmtes Gefühl gesetzmäßig ein nächstes nach sich zieht, scheint es nicht zu geben. Dies alles drängt uns ein (1)dualistisches Weltbild auf, in dem Geist und Seele und das Naturgeschehen zwei unterschiedliche »Wesenheiten« sind und von wesensverschiedenen Prinzipien beherrscht werden.
Gleichzeitig – und das ist das Dilemma – gibt es gute Gründe, an einem solchen dualistischen Weltbild zu zweifeln, so plausibel es auf den ersten Blick erscheint. Nur zu gut kennen wir die enge Beziehung zwischen Psyche und Körper: Große Freude ebenso wie große (1)Furcht lassen unseren Körper erbeben, uns schlottern die Knie, zittern die Hände vor Angst, bei großem Stress wälzen wir uns nachts im Bett herum, der Gedanke an die nahende Prüfung führt zu Schweißausbrüchen und so weiter. Gefühle können unseren Körper ergreifen. Wie aber kann es geschehen, dass Psyche und Geist als immaterielle Wesenszustände auf Gehirn und Körper einwirken, ohne dabei die Naturgesetze zu verletzen? Die umgekehrte Wirkungsrichtung scheint genauso rätselhaft zu sein: Auf welche Weise führt eine Verletzung zu einer Schmerzempfindung, also etwas rein Seelischem? Wie können chemische Substanzen wie Schmerzmittel oder (1)Antidepressiva auf unsere Psyche schmerz- und angstlindernd wirken, wo doch die Psyche gar keine »Andockstellen« für diese Stoffe hat? Seit René (1)Descartes hat kein Dualist diese Fragen plausibel beantworten können.
Sie stellen sich umso dringlicher, je weiter die Neurowissenschaften in enger Zusammenarbeit mit Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie darin voranschreiten, diejenigen Hirnprozesse zu identifizieren, die mit den geistig-psychischen Vorgängen verbunden sind. Noch vor 14 Jahren, als das »Manifest der Hirnforscher« geschrieben wurde, konnte man sich als Geisteswissenschaftler damit beruhigen, dass die bunten Hirnbilder eigentlich gar nichts Wichtiges beinhalten, denn sie zeigen auf den ersten Blick nichts weiter als die Tatsache, dass geistig-psychische Prozesse und neuronale Vorgänge irgendwie parallel verlaufen. Mit der klassisch-geisteswissenschaftlichen Maxime »Verstehen statt Erklären« und »Gründe statt Ursachen« kamen Psychiater und Psychotherapeuten über lange Zeit gut zurecht. Wenn man schon nicht an zwei wesensmäßig unterschiedliche Welten glaubte, so doch zumindest an zwei komplementäre Erklärungswelten, die sich letztlich gar nicht ins Gehege kamen.
Eine beträchtliche Zahl der heutigen Philosophen, Psychologen, Psychiater und Psychotherapeuten vertritt entsprechend einen (1)psychophysischen Parallelismus. Dieser akzeptiert natürlich einen gewissen Zusammenhang zwischen Geist-Psyche und Gehirn, hält ihn aber für irrelevant. Ein solcher Parallelismus wird allerdings umso rätselhafter, je enger sich die Beziehung zwischen dem Psychischen und dem Neuronalen erweist. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass die mit bewusstem Erleben verknüpften neuronalen Prozesse vom Stoffwechsel her sehr »teuer« sind. Warum wird ein solcher Parallelaufwand betrieben, wenn er ohne funktionale Bedeutung ist?
Ganz unplausibel wird ein (2)psychophysischer Parallelismus spätestens mit dem experimentellen Nachweis, dass dem bewussten Erleben von Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen unbewusste neuronale Prozesse in einem gut messbaren Rahmen von einigen Hundert Millisekunden zeitlich vorhergehen. Das bedeutet, dass bewusstes Erleben stets einen unbewussten neuronalen »Vorlauf« hat, und dass bestimmte unbewusste neuronale Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit überhaupt etwas bewusst wird. Gleichzeitig heißt dies, dass es sehr viele neuronale Prozesse gibt, die niemals oder zumindest nicht unter den gegebenen Bedingungen bewusst werden, umgekehrt aber keine bewussten Prozesse, denen nicht unbewusste neuronale Prozesse vorhergehen würden.
Diese Erkenntnis hat natürlich eine große Bedeutung für das Verständnis der »Natur« von Geist, Seele und Bewusstsein, denn es bindet die Existenz dieser Zustände unlösbar an die Existenz des Gehirns. Darüber hinaus erhebt sich die dringliche Frage nach den spezifischen neuronalen Bedingungen für das Entstehen und die Art geistig-psychischen Erlebens. Diese Frage steht im Mittelpunkt unseres Buches, wenn es um die Entwicklung von Psyche und Gehirn geht, um die Grundlagen von Persönlichkeit, um das Entstehen psychischer Erkrankungen und die Wirkungsweisen von Psychotherapie. Es stellt sich die Frage, wie weit die Aufklärung der neuronalen Grundlagen denn gekommen ist.
Hier wird der Hirnforschung immer wieder vorgeworfen, dass sie über reine Korrelationen hinaus nichts vorzuweisen habe. Dieser Vorwurf ist sicherlich zum Teil berechtigt. So liefert die Feststellung, dass die Amygdala bei Furchtzuständen eine erhöhte Aktivität aufweist, erst einmal keine Erkenntnisse über die kausalen Zusammenhänge zwischen beiden Ereignissen. Für einen (1)interaktiven Dualisten, für den das Gehirn ein Instrument in den Händen des Geistes ist, heißt dies nichts anderes, als dass der Empfindungszustand der (2)Furcht bzw. (1)Angst die Amygdala aktiviert und diese dann den Körper in Bewegung setzt, z.B. um zu fliehen. Natürlich kann man sofort fragen, warum eigentlich der Geist dafür die Amygdala oder überhaupt das Gehirn benötigt. Dem könnte der interaktive Dualist mit dem Argument begegnen, dass ein Pianist eben einen Flügel braucht, um Musik zu produzieren. Allerdings dürfte es dann keine unbewusste (1)Furchtkonditionierung geben, bei der die (1)Amygdala nachweislich aktiviert wird, ohne dass der Betroffene dies erlebt, denn das hieße, dass sich die Tasten des Flügels ohne den Pianisten bewegen können. Nach den Erkenntnissen der Hirnforschung scheint das neuronale Geschehen die psychischen Erlebniszustände zu verursachen und nicht umgekehrt.
Läuft dies nicht doch auf einen »platten« (2)Reduktionismus hinaus, für den etwa psychische Erkrankungen wie Depressionen nichts anderes sind als Fehlverdrahtungen in der Amygdala oder Unterfunktionen im Serotoninhaushalt? Solche Aussagen sind in der Tat unter Neuropharmakologen und naturwissenschaftlich orientierten Psychiatern keineswegs selten anzutreffen und dienen dann der geisteswissenschaftlichen Gegenseite als Schreckensbild eines neurobiologischen Reduktionismus. Zwar werden die meisten Neurobiologen zugeben, dass sie psychische Erkrankungen noch nicht in allen ihren Details neurobiologisch erklären können. Aber was ist in vielleicht 20 Jahren? Können wir dann das diagnostische Gespräch des Therapeuten nicht doch durch eine gründliche Untersuchung des Patientengehirns ersetzen?
Immerhin kann die moderne Medizin in anderen Bereichen nicht auf technische Diagnoseverfahren verzichten, und viele Ärzte beschränken sich zunehmend darauf, weil es für sie billiger und weniger risikoreich ist. Aber was ist dann mit der Psychotherapie? Könnte sie durch neurobiologische oder neuropharmakologische Verfahren ersetzt werden? In der Tat erwecken viele neuropharmakologisch orientierten Psychiater und erst recht die dahinterstehende Pharmaindustrie genau diese Hoffnung: Wenn denn Depression nichts anderes ist als eine Fehlfunktion des Serotoninsystems, dann muss man diesen Defekt eben durch Medikamente, z.B. die bekannten (1)selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) beheben. Natürlich kann man argumentieren, dass die genaue langfristige Wirkung der SSRI nicht bekannt ist, dass diese Medikamente keineswegs bei allen Depressiven gleichermaßen wirken und bei manchen Patienten überhaupt nicht, und dass in der Regel die Wirkung mit der Zeit nachlässt – wie bei vielen anderen Psychopharmaka auch. Ein kritischer Experte wird zudem darauf hinweisen, dass die Wirkung sowohl der Neuro- und Psychopharmaka als auch der Psychotherapien verschiedenster Richtung signifikant von einem ganz unspezifisch wirkenden Faktor, nämlich der »therapeutischen Allianz«, dem Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut bestimmt wird, und dass daher auch viele angeblich spezifische Wirkungen psychopharmakologischer und psychotherapeutischer Behandlung vornehmlich auf diesen Effekt zurückzuführen sind. Was könnte besser die Unzulänglichkeit eines reduktionistischen Ansatzes in Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie demonstrieren?
Die große Herausforderung besteht also darin, die neurobiologischen Grundlagen des »Seelischen« zu bestimmen und dabei die Fallstricke eines (3)Reduktionismus ebenso wie die eines (2)Dualismus zu vermeiden. Dies wird uns gelingen, wenn wir zeigen können, in welcher Weise im Gehirn Gene und Umwelt miteinander interagieren, vor allem wie vorgeburtliche und nachgeburtliche Erfahrungen auf die Genexpression einwirken, die ihrerseits die synaptische Verschaltung steuert. Eine zentrale Rolle wird dabei entsprechend die Darstellung der »neuronalen Sprache der Seele«, nämlich der (1)Neuromodulatoren, (1)Neuropeptide und (1)Neurohormone spielen, welche die Kommunikation zwischen Zellen, Zellverbänden und ganzen Hirnregionen zugleich bestimmen und widerspiegeln.
Auf der Ebene der synaptischen Kommunikation spielt sich nämlich das Gehirngeschehen ab, das für das Psychische entscheidend ist. Es geht dabei um das Ausmaß von Produktion und Freisetzung der neuroaktiven Substanzen und um ihre Wirkung auf bestimmte Rezeptoren. Entsprechend ist dies die Ebene, auf der sich psychische Erkrankungen »materiell« manifestieren, nämlich durch Veränderungen in der Produktion und Freisetzung der Substanzen, in der Anzahl, Verteilung und Empfindlichkeit der Rezeptoren und in der Interaktion zwischen diesen Systemen. In den vergangenen Jahren hat sich ein wahrer »Quantensprung« ergeben, indem es gelang, die Wirkung psychischer Traumatisierung, etwa infolge von (1)Vernachlässigung, (1)Misshandlung oder (2)Missbrauch in früher Kindheit, auf der Ebene neurochemischer Veränderungen und der damit verbundenen Gehirnmechanismen nachzuweisen und so die Einsicht in die neuronalen Korrelate psychischer Erkrankungen zu vertiefen. Es wurde deutlich, dass die individuelle Ausprägung der neurochemischen Systeme die Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkungen früher Erfahrungen vorgeben und so die Psyche schützen oder gefährden können. Die Erfahrungen können ihrerseits in einem (1)epigenetischen Prozess auf die Gene zurückwirken und deren Umsetzung in Proteine, d.h. in Komponenten der neurochemischen Systeme beeinflussen. Damit ist zumindest im Prinzip hinsichtlich des Psychischen das uralte »Gen-Umwelt«-Problem gelöst. Es bestätigt sich die Anschauung, dass psychische Gesundheit ebenso wie psychische Erkrankungen durch spezifische (1)Gen-Umwelt-Interaktionen bestimmt werden.
Daraus leitet sich die Erwartung ab, dass ein positiver Effekt von Psychotherapien, sei er spezifisch oder unspezifisch, auf der synaptisch-neurochemischen Ebene nachweisbar sein muss. Der all diesen Vorstellungen zugrundeliegende Gedanke lautet: Wenn psychische Erkrankungen einhergehen mit Fehlfunktionen bei der Kommunikation zwischen Neuronen, sich also auf der synaptisch-neurochemischen Ebene abspielen, und sie damit das Ergebnis »falschen Lernens« sind, dann muss eine erfolgreiche Psychotherapie als Veränderung auf eben dieser Ebene sichtbar werden.
Damit ist natürlich nicht auch schon geklärt, wodurch diese Veränderungen genau hervorgerufen werden. Hierzu gibt es bei den unterschiedlichen Psychotherapierichtungen spezifische Wirkmodelle wie etwa die »(1)kognitive Umstrukturierung« in der (2)kognitiven Verhaltenstherapie oder das »(1)Bewusstmachen des Unbewussten« in der (1)Psychoanalyse. Während sich die Psychoanalyse nach dem Scheitern Sigmund Freuds als Hirnforscher von neurobiologisch orientierten Wirkungsmodellen weitgehend fernhielt oder sie gar radikal ablehnte, entwickelte die (3)kognitive Verhaltenstherapie relativ früh Vorstellungen über die eigene neurobiologische Wirksamkeit. Damit hat sie in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken können, im Vergleich zur Psychoanalyse die einzige wissenschaftlich begründete Therapieform zu sein. Das zögerliche Verhalten vieler Psychoanalytiker gegenüber einer wissenschaftlichen Überprüfung ihrer Aussagen hat der Psychoanalyse schwer geschadet. Aber auch angesichts der zunehmenden und berechtigten Forderung des Gesundheitssystems nach einer »evidenzbasierten Medizin« kann eine solche Haltung immer weniger glaubhaft vertreten werden, selbst wenn es richtig ist, dass sehr sorgfältig über geeignete Standards nachgedacht und geforscht werden muss, mit denen sich die Wirksamkeit von Psychotherapien überprüfen lässt.
Die Wirkmodelle der verschiedenen Psychotherapien bieten aber nicht nur eigene Konzepte ihrer Wirkung an, sie sollen außerdem die tatsächliche oder vermeintliche Überlegenheit der jeweiligen Richtung erklären. Im Rahmen unseres Buches werden wir deshalb die jeweils unterstellten Wirkmodelle kritisch auf ihre neurobiologische Plausibilität hin untersuchen. Besonders interessant wird es natürlich, wenn uns diese Plausibilität gering erscheint, die verschiedenen Therapien aber dennoch zumindest bei einigen Patienten wirksam sind. Lässt sich diese Wirkung dann auf andere Weise erklären? Dies führt zu der in der Psychotherapieforschung bereits intensiv diskutierten Frage, ob nicht allen Psychotherapien, wie oben erwähnt, ein ganz unspezifischer »gemeinsamer Faktor«, nämlich das »Arbeitsbündnis« oder die »(1)therapeutische Allianz« zugrunde liegt. Es ist dann zu fragen, ob die Wirkung dieses Faktors, den man lange geringschätzig als »Placeboeffekt« abgetan hat, auch neurobiologisch erklärbar ist.
Einer der ganz wenigen, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an der Vision einer neurobiologisch fundierten Psychotherapie festhielten, war der Neurobiologe Eric (3)Kandel (geb. 1929), der – sozusagen in Gegenrichtung zu Freud – im Rahmen seines Medizinstudiums mit der Psychiatrie und Psychoanalyse begann und bei der molekular-zellulären Neurobiologie von Gedächtnisprozessen endete, für deren Erforschung er im Jahre 2000 den Nobelpreis für Physiologie/Medizin erhielt. Bereits 1979 entwickelte er in dem Aufsatz »Psychotherapie und die einzelne Synapse« die visionäre Vorstellung, dass Psychotherapie notwendigerweise auf der synaptischen Ebene ansetze und deshalb aufgrund synaptischer Veränderungen wirksam sein müsse. Rund 20 Jahre später, in den zwei Aufsätzen »Ein neuer theoretischer Rahmen für die Psychiatrie« und »Biologie und die Zukunft der Psychoanalyse« konkretisierte er diese Anschauung weiter.
Im ersteren der beiden letztgenannten Aufsätze heißt es kurz und knapp: »Alle geistigen Funktionen spiegeln Gehirnfunktionen wider« (S. 83), und ebendort führt (4)Kandel aus:
»Insofern Psychotherapie und Beratung wirksam ist und zu langfristigen Veränderungen im Verhalten führt, gründet diese Wirksamkeit vermutlich im Lernen, indem Veränderungen in der Genexpression erzeugt werden, die die Stärke der synaptischen Verbindungen verändern, und indem strukturelle Veränderungen stattfinden, die das anatomische Muster der Verbindungen zwischen Nervenzellen im Gehirn ändern« (wieder abgedruckt in Kandel 2008).
Allerdings dauerte es noch über zehn Jahre, bis derartige Ideen unter deutschsprachigen Psychoanalytikern überhaupt ernsthaft diskutiert wurden und man damit begann, neuro-psychiatrische Forschung auf der Grundlage funktioneller Bildgebung zu betreiben.
Das im Jahre 2004 erschienene Buch Neuropsychotherapie des leider 2005 viel zu früh verstorbenen Psychologen und Psychotherapeuten Klaus (3)Grawe hat seinerzeit viel Aufsehen erregt, beruhte aber trotz vieler beeindruckender Einsichten auf einer immer noch unzureichenden Grundlage neurobiologischer Erkenntnisse.
Mit unserem Buch setzen wir die Bemühungen Klaus Grawes fort, ein neurobiologisches Verständnis des Seelisch-Psychischen, der Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit als Träger dieses Seelischen, der Entstehung psychischer Erkrankungen und der Wirksamkeit von Psychotherapie zu erreichen. Ebenso werden wir seine Vorstellungen von einer schulenübergreifenden »allgemeinen Psychotherapie« aufnehmen und weiterentwickeln.
Zu Beginn des Buches verfolgen wir in einem kurzen historischen Abriss die lange Suche nach dem »Sitz der Seele« und fragen uns in einer ersten Annäherung, ob und in welcher Hinsicht diese Suche heute zu einem Ende gekommen ist. Wir tun dies in der Überzeugung, dass die gegenwärtige Auseinandersetzung um eine »Neuropsychiatrie« bzw. »Neuropsychotherapie« nicht verstanden werden kann, wenn wir nicht auch deren Vorgeschichte kennen.
Es folgt im Kapitel 2 ein Überblick über den Aufbau des menschlichen Gehirns und dann eine genauere Darstellung des limbischen Systems als dem eigentlichen »Sitz« von Psyche und Persönlichkeit einschließlich unseres »(1)Vier-Ebenen-Modells«. In Kapitel 3 geht es um die Darstellung der »neuronalen Sprache der Seele«, also um die Wirkungsweise von (1)Neurotransmittern, (2)Neuromodulatoren, (2)Neuropeptiden und (2)Neurohormonen. Ohne eine Kenntnis von der Wirkungsweise dieser neuroaktiven Substanzen kann man sich nicht sinnvoll mit der Entstehung psychischer Erkrankungen und ihrer möglichen Therapie beschäftigen.
In Kapitel 4 behandeln wir die Individualentwicklung des menschlichen Gehirns und die darauf aufbauende Entwicklung der kindlichen Psyche. Hierbei geht es vor allem um die Ausformung des Bindungssystems und die Bedeutung der Bindungserfahrung für die weitere psychische Entwicklung. Im 5. Kapitel stellen wir ein neurobiologisch fundiertes Konzept der Persönlichkeit einschließlich des von uns entwickelten Modells der sechs psycho-neuronalen Grundsysteme vor.
In Kapitel 6 bemühen wir uns um eine genauere Definition der Begriffe des (1)Unbewussten, Vorbewussten und Intuitiven sowie des Bewussten, die für die Psychotherapie zentral sind. In diesem Zusammenhang entwerfen wir eine neurobiologisch begründete Theorie von Geist und Bewusstsein, die mit der Grundvorstellung der »Einheit der Natur« verträglich ist und dabei zugleich die jeweiligen Fallstricke eines (3)Dualismus und ebenso die eines (4)Reduktionismus vermeidet.
Mit psychischen Erkrankungen, ihren neurobiologischen Grundlagen und insbesondere mit der Frage nach der dabei ablaufenden (2)Gen-Umwelt-Interaktion befassen wir uns in Kapitel 7. Dabei konzentrieren wir uns auf diejenigen Erkrankungen, die aus neurobiologischer Sicht am besten (wenngleich noch immer unzulänglich) untersucht sind, nämlich (1)Depressionen, Angststörungen, die (1)posttraumatische Belastungsstörung, die (1)Zwangsstörung und Persönlichkeitsstörungen einschließlich der (1)Borderline-Störung(1) und der antisozialen Verhaltensstörung. Im 8. Kapitel geht es vornehmlich um die Darstellung der am weitesten verbreiteten Psychotherapierichtungen, nämlich der (1)Verhaltenstherapie bzw. (4)kognitiven Verhaltenstherapie und der (2)Psychoanalyse bzw. psychodynamischen Konzepte. Die Konzentration auf diese Therapierichtungen ergibt sich sowohl aus Platzgründen als auch aus der Tatsache, dass nur hierzu ernstzunehmende neurowissenschaftliche Daten vorliegen.
Im 9. Kapitel werden wir die Wirkmodelle der genannten Psychotherapierichtungen auf ihre psychologische wie neurobiologische Fundierung und Plausibilität hin überprüfen. Sollten wir dabei auf Mängel stoßen, werden wir uns fragen, wie aus neurobiologischer Sicht plausiblere und allgemeinere Wirkmodelle der Psychotherapie aussehen könnten. Eine Frage wird dabei sein, warum Psychotherapien häufig keine nachhaltige Wirkung haben, obgleich sie einer reinen Pharmakotherapie langfristig überlegen zu sein scheinen. Auch wird zu untersuchen sein, warum die Wirkung in vielen Fällen in zwei Phasen aufritt, nämlich einer kurzfristigen, aber nicht nachhaltigen Besserung der Symptomatik und subjektiven Befindlichkeit, und einer zweiten, längeren Phase voller mühsamer Fortschritte – falls es überhaupt zu einer Langzeittherapie kommt. Wir werden dann auch die Grundzüge einer »allgemeinen Psychotherapie« im Sinne Grawes umreißen und ein neues Psychotherapie-Wirkmodell präsentieren. Im abschließenden 10. Kapitel werden wir das Gesagte noch einmal modellhaft zusammenfassen.
Kapitel 1
Die Suche nach dem Sitz der Seele
Der Begriff der »Seele« ist einer der kompliziertesten Begriffe der Ideengeschichte. In allen Religionen, Weltanschauungen und Kulturen der Welt ist er in unterschiedlichsten Ausprägungen und Bedeutungen anzutreffen.
Am Anfang steht der animistisch-vitalistische Seelenbegriff. Hierbei geht es um die Tatsache, dass es in der Natur Lebewesen wie Pflanzen, Tiere und Menschen gibt, die sich von unbelebten Dingen wie Steinen oder Metallen grundsätzlich unterscheiden. Alle Lebewesen sind in dieser ursprünglichen Naturauffassung »beseelt«, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Pflanzen zeichnen sich durch Wachstum und Reizbarkeit aus, sie orientieren sich mit ihren oberirdischen Teilen zum Licht, mit ihren Wurzeln zur Erde hin. Tiere können sich außerdem bewegen, haben Sinnesorgane und zeigen zum Teil auch erstaunlich zweckhaftes Verhalten. Dieses Verhalten wird meist als angeboren oder instinkthaft angesehen, aber manche Tiere wie Hunde, Affen oder Rabenvögel gelten seit dem Altertum als intelligent. Der Mensch zeigt sowohl Wachstum und Reizbarkeit wie die Pflanzen und bewegt und verhält sich zweckhaft wie die Tiere, aber darüber hinaus hat er noch Verstand, den die Tiere entweder gar nicht oder nur in geringem Maße besitzen. Schließlich hat er Vernunft, also die Fähigkeit zum logischen und begrifflichen Denken, zu moralisch-sittlichem Handeln und zur Einsicht in das Walten Gottes oder der Götter in der Natur.
1.1 Die (1)antike und (1)mittelalterliche Seelenlehre
Die deutlichen Unterschiede zwischen der belebten und der unbelebten Natur sowie zwischen Pflanze, Tier und Mensch wurden von den antiken Philosophen, Naturforschern und Ärzten unterschiedlich erklärt. Der am weitesten verbreiteten Anschauung nach war das Universum von einer »Weltseele« oft göttlicher Natur durchdrungen, auch Pneuma oder Äther (lateinisch anima oder spiritus) und im Deutschen Odem genannt. Mit der Atemluft nahmen Tiere und Menschen diesen Odem auf und wurden dadurch belebt. Diese Annahme beruhte auf der Beobachtung, dass ein längerer Atemstillstand zum Tod führt, was aus heutiger Sicht ja nicht falsch ist, auch wenn wir mittlerweile wissen, dass beim Atmen der für den Körperstoffwechsel notwendige Sauerstoff aufgenommen wird und nicht etwa eine lebendig machende Substanz.
Vorsokratische Philosophen wie Empedokles und Heraklit haben die Seele fast durchweg als feinstofflich (»ätherisch«) oder luftähnlich angesehen. Demokrit, der Begründer der antiken Atomlehre, ging von speziellen Seelen- oder Feueratomen aus, die besonders beweglich sind, über die Atemluft aufgenommen werden und sich im Körper bzw. im Gehirn zur Seele verdichten. Sie vermitteln auch Bilder aus der Umwelt ins Gehirn, die dann die Grundlage der Wahrnehmung sind. Über die Atmung besteht ein ständiger Austausch dieser Atome mit der Umwelt. Beim Tod und Atemstillstand zerstreuen sich die Atome wieder. Eine unsterbliche Seele ist daher für Demokrit und später für den lateinischen Dichter und Philosophen Lukrez, dessen Werk De rerum natura für die frühe Neuzeit als Hauptwerk einer materialistischen Weltanschauung galt, unmöglich.
Einen Höhepunkt findet die antike Anschauung der Seele in der »Drei-Seelen-Lehre«, wie sie unter anderem die griechischen Philosophen (1)Platon (428/427–348/347 v. u. Z.) und (1)Aristoteles (384–322 v. u. Z.) vertraten. Danach gibt es als grundlegendes Lebensprinzip eine »vegetative Seele«, lateinisch anima vegetativa oder spiritus vegetativus, die zu Wachstum, Entwicklung und Erregbarkeit durch Umweltreize führt. Pflanzen haben nur diese vegetative Seele. Tiere als höherstehende Lebewesen haben eine weitere Seele, »Tierseele« oder anima animalis bzw. spiritus animalis genannt; sie ermöglicht Bewegung, adaptives Verhalten und vielleicht auch Intelligenz. Der Mensch hat gegenüber den Tieren eine »Vernunftseele«, die anima rationalis oder den spiritus rationalis, die bis in die Neuzeit und zum Teil auch noch bis heute als unstofflich und zudem unsterblich galt und gilt. Durch sie erhebt sich der Mensch über die Tiere und hat Teil an einem göttlichen Prinzip, oder sie ist selbst Gabe der Götter bzw. Gottes. Sie steht damit im klassischen dualistischen Weltbild dem Körper als einer stofflichen Substanz gegenüber, was zu den in der Einleitung erwähnten Problemen des (4)Dualismus führt.
Bereits im Altertum wurde die Seele durch diese Ausweitung vom Lebensprinzip hin zur »Vernunftseele« des Menschen auch zum Organ der Erkenntnis. Auf diese Weise verband sich die Frage nach der Herkunft und Natur der Seele auf neuartige Weise mit der Frage nach gesicherter Erkenntnis, wie sie seit (2)Platon und (2)Aristoteles im Zentrum der Philosophie steht. Für Platon konnte aus sinnlicher Erfahrung keine sichere Erkenntnis im philosophischen Sinne entstehen, da sie materieller Natur war. Sinnliche Erfahrung diente lediglich der Orientierung des Körpers an den Geschehnissen der Welt. Wahre Erkenntnis hingegen, episteme genannt, wurde durch die »Augen des Geistes« gewonnen und hatte nichts mit der materiellen Welt zu tun, sondern mit dem Erfassen der unwandelbaren, unsterblichen und vollkommenen Ideen. Bevor sich die unsterbliche Seele mit einem sterblichen Körper verband und somit irdisch wurde, existierte sie in einem Raum »auf der Rückseite des Himmels«, wie es in Platons bekanntem Dialog Phaidros heißt, in der unmittelbaren Schau der Ideen. Daran kann sich die Seele mithilfe der wahren Methode des Erkenntnisgewinns, des philosophischen Diskurses wiedererinnern.
Für Platon hat die vernunftbegabte Seele ihren Sitz im Gehirn, ihr edel-muthafter Teil sitzt in der Brust bzw. im Herzen und der triebhaft-begehrende Teil im Unterleib – wo auch sonst! Aus heutiger neurobiologischer Sicht lagerte Platon also die »limbischen Anteile« des Psychischen aus dem Gehirn in diejenigen Körperteile aus, die von Emotionen und starken Affekten offenbar besonders betroffen sind. Der muthafte Teil der Seele ist zwar durch den Nacken vom Gehirn als Sitz der Vernunftseele getrennt, ordnet sich aber gern dieser unter, während der begehrende Teil der Seele, durch das Zwerchfell vom Herzen getrennt, eher widerspenstig ist. Dies illustriert (3)Platon am berühmten und bis heute populären Bild der Vernunft als »Wagenlenker« des »Seelenwagens«, eines Zweigespanns von Pferden, von denen das eine fügsam, das andere wild ist. Nur die Vernunftseele, so der spätere Platon, ist unsterblich, die beiden anderen Seelenteile, Mut und Triebe, vergehen mit dem Leib.
Anders als Platon nahm sein Schüler (3)Aristoteles einen engen Zusammenhang zwischen sinnlicher Wahrnehmung und gesicherter Erkenntnis an. Er verneinte die Existenz unsterblicher Ideen und ging als erster großer Naturforscher und »Empirist« der Philosophie davon aus, dass alle Erkenntnis auf sinnlicher Wahrnehmung und Erfahrung gegründet ist, indem die Vernunft über die »Vorstellungskraft« (phantasia) die Sinnesdaten mithilfe angeborener Erkenntnisschemata, den »Kategorien«, organisiert und in eine allgemeingültige Form bringt. Tiere können durchaus Sinneseindrücke miteinander verbinden und auch recht intelligent sein, aber abstrakte Erkenntnisse hat für (4)Aristoteles nur der Mensch. Kategorien sind als Organisatoren des Denkens aktuell erfahrungsunabhängig, könnten aber durch assoziatives Lernen allmählich entstanden sein, wie es die britischen Philosophen John Locke und David Hume später annahmen.
Vernunftseele und Denkvermögen sind bei Aristoteles unsterblich und leidensunfähig, aber nur in überindividueller Form. Die individuellen Anteile der vegetativen, der tierischen und der menschlichen Seele sterben hingegen mit dem Menschen. Im Gegensatz zu Platon sind für Aristoteles die drei Seelenanteile nicht im Gehirn, sondern im Herzen lokalisiert, da dort alles Blut als Träger der Lebensgeister zusammenströmt und dann wieder im Körper verteilt wird. Aristoteles schloss das Gehirn als Ort der Seele aus, weil es sich nach Öffnung des Schädels kühl anfühlte, während doch die Wärme der Ausdruck des Lebensprinzips war. Vielmehr hielt er das Gehirn für eine Art Kühlsystem des Blutes. Aristoteles zählte also zu den »Cardiozentristen«, die meinten, das Herz sei Sitz der Seele, im Gegensatz zu den »Cerebrozentristen«, die zumindest die »rationale Seele«, also das Denkvermögen, mit dem Gehirn in Verbindung brachten.
Die Anschauung, das Gehirn sei Sitz zumindest der Vernunftseele, der Intelligenz und der kognitiven Fähigkeiten, war mit Ausnahme von Aristoteles unter Naturforschern spätestens seit dem antiken Arzt Hippokrates (ca. 460–370 v. u. Z.) und seiner Schule weithin akzeptiert. Allerdings sah man als ihren genauen Ort die Ventrikel, die flüssigkeitsgefüllten Hohlräume des Gehirns, an. Man konnte sich nicht vorstellen, dass die schlüpfrige Gehirnmasse etwas mit der Vernunftseele zu tun habe. Dieses antike Seele-Gehirn-Modell erhielt seine Abrundung durch den griechischen Arzt (1)Galen (um 129–216 n. u. Z.), der zunächst als Gladiatorenarzt, später in Rom als »Modearzt« der Kaiser und der vornehmen römischen Gesellschaft tätig war. Galen kam aufgrund von Tierexperimenten und Beobachtungen an verwundeten Gladiatoren (wie vor ihm schon andere Forscher) zu der Überzeugung, dass das pneuma psychikón, der spiritus animalis über die Atemluft und das Blut zuerst ins Herz gelangt und dann im Gehirn durch ein Geflecht aus feinsten Arterien, »Wundernetz« (lateinisch rete mirabile) genannt, aus dem Blut in die Ventrikel destilliert wird. Über das Rückenmark werde dann das in den Ventrikeln gespeicherte Pneuma im Körper verteilt und steuere ihn so. Ein Wundernetz, wie es (2)Galen beschreibt, ist im Gehirn von Paarhufern wie dem Schaf vorhanden. Allerdings wusste man nicht, dass das menschliche Gehirn so etwas gar nicht besitzt – dieser Umstand wurde erst um 1500 n. u. Z. durch den italienischen Arzt Jacopo da Carpi nachgewiesen.
Die Pflanzenseele und Tierseele wurden von Galen und seinen späteren Anhängern allgemein als materiell, wenngleich von unterschiedlicher Beschaffenheit betrachtet. Die Pflanzenseele stellte man sich breiartig wie den Trester vor, der beim Keltern der Trauben entsteht, während die Tierseele wie auch die menschliche Seele »feinstofflich« nach Art der Luft, des Äthers oder Weingeistes war, der beim Destillieren von Wein anfällt. Daher ist im Lateinischen die Wortidentität von spiritus als »Weingeist« und »Geist« nicht zufällig. Das Zuprosten mit geistigen Getränken ist ein uralter Brauch des Austauschs sowohl von alkoholischem wie seelischem Geist, der den meisten Menschen allerdings bei dieser Tätigkeit nicht bewusst ist.
Die mittelalterliche Theologie und Philosophie übernahm die platonische Vorstellung von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Diese Ansicht wurde nach Jahrhunderten heftiger Auseinandersetzungen im Jahre 1515 auf dem 5. Laterankonzil als unbezweifelbare Wahrheit (Dogma) festgeschrieben und wird zumindest im Katholizismus bis heute verbindlich gelehrt, während protestantische Theologen wie Karl Barth und Jürgen Moltmann die auf jüdische Vorstellungen zurückgehende Lehre vom Tod der Seele mit dem Tod des Körpers und einer gänzlichen Neuschöpfung von Körper und Seele in einer »Auferstehung« vertraten bzw. vertreten.
Für die spätere christliche Lehre des Mittelalters verbindet sich die unsterbliche, bereits vor der Geburt existierende Seele wie bei (4)Platon im Akt der Zeugung oder spätestens bei der Geburt mit dem Körper. Im Augenblick des Todes entweicht sie wieder aus dem Körper, so dass dieser »entseelt« zurückbleibt. Aus der Antike, etwa dem Werk Homers, übernahm man auch die Anschauung, dass die Seele nach ihrem Entweichen aus dem Körper an einen sicheren Ort geleitet werden müsse, da sie sonst als Gespenst in der Welt umherirre und bei den Lebenden Schaden anrichte. Wie in Abbildung 1.1 dargestellt, gibt es für gute Menschen hilfreiche Wesen, »Engel«, die die Seele in Empfang nehmen, sie eventuell gegen böse Mächte schützen und an einen paradiesischen Ort geleiten.
Abb. 1.1: Volkstümliche Darstellung aus dem 16. Jahrhundert, die zeigt, wie die Seele aus dem Munde eines Sterbenden entweicht und den toten Körper zurücklässt. Die Seele wird von einem Engel in Empfang genommen. Die Gleichsetzung von Seele und Atem ist antiken Ursprungs (aus Florey 1996).
Die Lehren (3)Galens bestimmten das ganze Mittelalter hindurch bis ins 18. Jahrhundert die Anschauungen über die Natur der Seele und ihren Ort. Man übernahm die Drei-Seelen-Lehre, sah aber im spiritus rationalis eine unstoffliche und unsterbliche Seele, die den spiritus animalis als »Botenstoff« benötigt. Damit war klar, dass der Ort der Interaktion zwischen beiden Seelen die Ventrikel waren, eine Vorstellung, die der mittelalterliche Universalgelehrte Albertus Magnus (um 1200–1280) weiter verfeinerte. Im Rahmen dieser Ventrikellehre, die bis ins 19. Jahrhundert wirksam war, wies man den vier (bzw. irrtümlich drei) Hirnventrikeln unterschiedliche Rollen bei Wahrnehmung und kognitiven Funktionen zu, wie in Abbildung 1.2 dargestellt. Im vorderen Ventrikel, der aus heutiger Sicht den paarigen Endhirnventrikeln entspricht, siedelte man den Gemeinsinn (sensus communis) an, in dem alle »Informationen« von den Sinnesorganen zusammenlaufen und sich zu einer einheitlichen Wahrnehmung formen. Albertus Magnus fügte dem Gemeinsinn noch die Vorstellungskraft (imaginatio) und das Erfassen von Bedeutung (aestimatio) hinzu. Im mittleren Ventrikel lokalisierte er das Denkvermögen (phantasia und cogitatio) und im hinteren das Erinnerungsvermögen oder Gedächtnis (reminiscentia und memoria). Andere Autoren siedelten das Gedächtnis im mittleren Ventrikel und die Willenskraft sowie die Fähigkeit zu Willkürbewegungen im hinteren Ventrikel an. Allgemein ging man davon aus, dass die Nerven, von den Sinnesorganen kommend, in den Ventrikeln enden und dort den Seelenstoff oder die unterschiedlichen Seelenstoffe abgeben.
Abb. 1.2: Eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Darstellung der Hirnventrikel. Die hier gezeigten drei der fünf Sinne, nämlich der Geruchssinn (»olfactus«), der Hörsinn (»auditus«) und der Geschmackssinn (»gustus«) schicken, zusammen mit dem Gesichtssinn (»visus«) und dem Tastsinn (»tactus«), Erregungen zum ersten Ventrikel, in dem der Gemeinsinn (»sensus communis«), die Vorstellungskraft (»fantasia«) und das Anschauungsvermögen (»vis imaginativa«) ihren Sitz haben. Im zweiten Hirnverntrikel sind das Denkvermögen (»vis cogitativa«) und das Urteilsvermögen (»vis estimativa«) angesiedelt; erster und zweiter Hirnventrikel sind durch den Wurm (»vermis«) als eine Art Ventil getrennt. Im dritten Hirnventrikel ist das Gedächtnis (»memoria«) lokalisiert. Heute weiß man, dass die Hirntätigkeit nicht in den Ventrikeln, sondern in der Hirnmasse (graue und weiße Substanz) stattfindet (aus Florey 1996).
Schwerwiegende Zweifel an dieser Ventrikellehre kamen durch den flämischen Arzt und Anatomen Andreas Vesalius (1514–1564) auf, der in Padua arbeitete und als Begründer der modernen Anatomie gilt. Er beschrieb den Unterschied zwischen grauer und weißer Hirnsubstanz und stellte fest, dass die großen Hirnnerven nicht in die Ventrikel einmündeten und auch keine Hohlräume besaßen, durch die der spiritus animalis hindurchgeleitet werden konnte. Das wurde aber nicht allgemein zur Kenntnis genommen. Der englische Arzt Thomas Willis (1621–1675) konstatierte als Erster, es sei die graue Substanz des Gehirns, die das Pneuma hervorbringe, und nicht die Ventrikel. Die weiße Substanz dagegen leite das Pneuma fort. Wenn man aus heutiger Sicht unter »Pneuma« die neuronalen Impulse versteht, so war dies völlig richtig. Wenig später stellte der Italiener Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) fest, dass die Nerven unmöglich einen gasförmigen spiritus enthalten konnten, und nahm stattdessen einen flüssigen Seelenstoff an. Dies gab Anlass zu Spekulationen, dass die Erregungsübertragung von den Sinnesorganen auf das Gehirn und dann auf den Geist hydraulisch-pneumatisch geschehen könnte.
1.2 Die (1)neuzeitliche Suche nach dem »Sitz der Seele«
Die moderne Diskussion um den Sitz der Seele beginnt mit dem französischen Philosophen, Mathematiker und Naturforscher René (2)Descartes (1596–1650). Descartes gilt heute als Hauptvertreter des neuzeitlichen Leib-Seele- oder (1)Geist-Gehirn-Dualismus. Dieser besagt, dass es im Universum zwei »Substanzen« gibt, nämlich eine ausgedehnte Substanz (res extensa) oder Materie, die den Naturgesetzen gehorcht, und eine unausgedehnte Substanz (res cogitans) oder Geist bzw. Seele, die jenseits der Naturgesetze existiert und wirkt. Bis heute ist umstritten, ob und in welchem Maße ein solcher (5)Dualismus den tatsächlichen Anschauungen (3)Descartes’ entsprach, oder ob er ihn aus Furcht vor der Verfolgung durch die Kirche, wie sie während Descartes’ Lebzeiten Galileo Galilei erfahren hatte, zwar offiziell äußerte, insgeheim aber Materialist war.
Descartes ist nämlich auch Begründer des neuzeitlichen Materialismus-(1)Physikalismus, demzufolge die gesamte Natur mit Ausnahme der menschlichen Seele oder des menschlichen Geistes nach rein physikalischen Gesetzen funktioniert und nicht »beseelt« ist, wie dies nahezu alle früheren Naturphilosophen glaubten. Allerdings wurde das, was er in seinem großen Werk Traité de l’homme (»Abhandlung über den Menschen«) um 1632 über die (2)Geist-Gehirn-Beziehung schrieb, erst 1662, also nach seinem Tod, unter dem Titel De Homine (Über den Menschen) veröffentlicht. Viele bekannte Abbildungen zur Interaktion von Geist und Gehirn, wie auch Abbildung 1.3, entstammen dieser posthumen Ausgabe und sind nicht original.
Eine große Bedeutung für die mechanistische Sicht (4)Descartes’ war die Entdeckung des Blutkreislaufs und der Funktion des Herzens als Pumpe durch den englischen Arzt William Harvey (1578–1657), der so das Herz als vermeintlichen Sitz psychischer Zustände entzauberte. Descartes führte in der Nachfolge von Harvey selbst anatomische Experimente durch und betrachtete auch das Gehirn als eine – wenngleich äußerst komplizierte – Maschine. Er übernahm die Anschauung, dass die Nerven Röhren seien, die von »Lebensgeist« (esprit animal, also dem klassischen spiritus animalis) erfüllt sind. Allerdings enden sie für ihn nicht in den Ventrikelwänden, sondern in der Nähe der Zirbeldrüse (Epiphyse), die Descartes als Schnittstelle zwischen Geist und Gehirn ansah. Diese Annahme, die bereits den Zeitgenossen merkwürdig vorkam, ging zum einen auf die antik-mittelalterliche Ventrikellehre zurück, die zwischen dem ersten und dem zweiten Ventrikel eine Art Ventil annahm, Vermis (lateinisch für »Wurm«) genannt. Auch griff (5)Descartes Befunde von Vesalius auf, wonach die Zirbeldrüse und der Balken (das Corpus callosum), der die linke und rechte Hirnhälfte miteinander verbindet, die einzigen unpaaren Gebilde des Gehirns seien. Unpaar musste die Schnittstelle zwischen Gehirn und Geist schon sein, weil es seit der Antike als unumstößlich galt, dass die Seele unausgedehnt ist. Deshalb konnte sie keineswegs wie die anderen Hirnteile paarig angeordnet und damit ausgedehnt sein.
Wie in Abbildung 1.3 dargestellt, wurde die Zirbeldrüse einerseits vom flüssigen Seelenstoff oder von Fäden durch die Nerven bewegt und verteilte andererseits, gelenkt von der immateriellen Seele, über die Nerven Erregungsflüssigkeiten, die dann die Muskeln durch Aufblähen zur Kontraktion brachten. (Ein solches Aufblähen der Muskeln bei der Kontraktion wurde aber bald als Irrtum erkannt.) (6)Descartes nahm an, die hohlen Nerven würden sich durch Druck und Stoß ohne jegliche Verzögerung öffnen und in der Nähe der Epiphyse den Seelenstoff freisetzen. Wie dieser dann die Epiphyse in Erregungen oder Schwingungen versetzte, blieb unklar, ebenso die Frage, wie die Seele ihrerseits die Epiphyse so beeinflusste, dass ihre Handlungsabsichten in Körperbewegungen umgesetzt werden konnten.
Abb. 1.3: Illustration zum (2)interaktiven Dualismus von René (7)Descartes. Das Bild eines Gegenstandes (hier eines Pfeils) wird von den Augen aufgenommen und die entsprechende Erregung per »Seelenstoff« über die Sehbahn (falsch als nichtkreuzend dargestellt) zur Oberfläche der Epiphyse geleitet. Diese gerät hierdurch vermutlich über den Seelenstoff oder feine Fäden in Schwingungen, die in nicht weiter erläuterter Weise auf den immateriellen Geist einwirken und die bewusste Wahrnehmung erzeugen. Der Geist kann seinerseits aufgrund eines Willensentschlusses die Epiphyse in Schwingungen versetzen, die dann über feine Fäden die in den motorischen Nerven enthaltene Seelenstoff-Flüssigkeit in Bewegung setzt. Diese bläht die Muskeln auf und bewirkt so die Armbeugung (ebenfalls eine völlig falsche Annahme). Diese wie auch alle anderen Abbildungen wurde dem 1662 posthum auf Lateinisch erschienenen Werk De Homine von dem Leidener Philosophieprofessor Florent Schuyl hinzugefügt. Sie stammt also nicht von Descartes selbst.
Descartes ist in der Leib-Seele- bzw. (3)Geist-Gehirn-Diskussion also in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Zum einen verabschiedete er sich radikal von der Drei-Seelen-Lehre, denn für ihn gab es – zumindest in seinen veröffentlichten Schriften – nur noch eine unsterbliche und unstoffliche Seele. Das bedeutete, dass man sich ohne religiöse oder philosophische Gewissensbisse mit der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane und des Gehirns befassen konnte, wenn man die kritische Frage aussparte, wie denn diese Seele mit dem Gehirn interagierte. Dies taten nun auch mehr oder weniger alle Naturforscher der Neuzeit und nahmen zumindest offiziell die Existenz einer immateriellen, nicht lokalisierbaren Seele an. Nur wenige Materialisten, insbesondere solche unter den französischen Enzyklopädisten wie Diderot oder D’Alembert und später die Materialisten des 19. Jahrhunderts wie Carl Vogt, Jakob Moleschott und Ludwig Büchner betrachteten den Geist bzw. die Seele als einen materiellen Zustand, der vom Gehirn hervorgebracht wird, wenngleich auch hier offengelassen wurde, wie dies genau geschieht.
1.3 Experimentelle Hirnforschung und Seele-Geist
Die Hirnforschung im modernen Sinne nahm im 19. Jahrhundert einen bedeutsamen Aufschwung, insbesondere im Zuge verbesserter neuroanatomischer Methoden und der deutlichen Steigerung der Leistungsfähigkeit von Mikroskopen sowie schließlich durch das Aufkommen der modernen Elektrophysiologie und Neurochemie (vgl. Shepherd 1991; Florey und Breidbach 1997). In dieser Forschung gab es eine lange Liste von Problemen zu lösen wie etwa (a) die Natur der »nervösen« Erregungsfortleitung von den Sinnesorganen zum Gehirn und schließlich zum eigentlichen »Seelenorgan« als – modern ausgedrückt – Schnittstelle zwischen Gehirn und Seele, (b) die Frage, mit welcher Geschwindigkeit die Erregungsfortleitung stattfindet (unendlich schnell, mit Lichtgeschwindigkeit oder viel langsamer?), (c) wie die unterschiedlichen Sinnesqualitäten entstehen, (d) die Frage, ob Funktionen im Gehirn räumlich verteilt sind oder das Gehirn »holistisch« arbeitet, (e) wie die Integration der Sinneswahrnehmungen im Zusammenhang mit der Entstehung »höherer« Hirnfunktionen (Bewusstsein, Denken, Vorstellen, Erinnern, Wollen usw.) stattfindet, (f) wie Lernen und Gedächtnis funktionieren, und vieles andere mehr. Charakteristisch war, dass Neuroanatomen einerseits und Neurophysiologen andererseits hierbei weitgehend unabhängig voneinander arbeiteten und sich die große Synthese beider Disziplinen erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts vollzog.
Die größten, wenngleich mühsam errungenen Fortschritte machten erst einmal die Neuroanatomen. Nachdem man sich durch Läsionsexperimente davon überzeugt hatte, dass die Hirnfunktionen in der grauen, zellhaltigen Substanz des Gehirns lokalisiert waren und die weiße Substanz im Wesentlichen aus langen Fasern bestand, untersuchte man die Textur des Gehirns genauer, wobei diese Studien anfangs sehr von der schlechten Qualität der Mikroskope beeinträchtigt waren. Immerhin sahen alle Forscher im Gehirn ein Fasergeflecht, das sich von der weißen in die graue Substanz fortsetzte und feinste Verästelungen aufwies. Es lag nahe, in diesem sehr subtilen Geflecht die Grundlage der Gehirnfunktionen zu sehen. Als Erster beschrieb 1833 der deutsche Naturforscher Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876) »Ganglienkugeln«, die im Gehirn in ein sehr feines Fasergeflecht eingebettet waren, doch gelang es ihm mit seinen Mikroskopen nicht, eine eindeutige Beziehung zwischen diesen Kugeln und den Fasern aufzuzeigen. Erst 1844 wies der deutsch-polnische Neuroanatom und Embryologe Robert Remak (1815–1865) die beobachteten Fasern als Fortsätze der »Ganglienkugeln« nach, und sein früh verstorbener Kollege Otto Deiters (1834–1863) lieferte die erste genaue Beschreibung des exakten Baues von Nervenzellen, die er als zusammengesetzt aus Dendriten, Zellkörper (Soma) und Axon erkannte. Hieraus erwuchs gegen Ende des 19. Jahrhunderts die moderne »Neuronendoktrin«, d.h. die Anschauung, dass das Gehirn – neben den Gliazellen als Stütz- und Nährzellen – aus »Neuronen« besteht, wie Heinrich Wilhelm Waldeyer die Nervenzellen 1891 nannte. Auch wurden spätestens mit den bahnbrechenden Arbeiten des vielleicht größten Neuroanatomen, des Spaniers (1)Santiago Ramón y Cajal (1852–1934 – meist fälschlich nur »Cajal« genannt) die Funktionen der einzelnen Neuronenbestandteile klar: Dendriten nehmen Erregungen – meist von anderen Neuronen – auf, leiten sie zum Zellkörper (Soma) und dann zum Ursprungsort des Axons, dem Axonhügel, weiter, von wo aus sie über das Axon und seinen Verzweigungen (Kollaterale) bis zur nächsten Nervenzelle weiterlaufen (s. Kapitel 2).
Bis weit ins 20. Jahrhundert gab es einen erbitterten Streit darüber, ob die Nervenzellen ein ununterbrochenes Vielzellgeflecht, ein »Synzytium«, bildeten und an ihren Fortsätzen ineinander übergingen, oder ob es sich um Einzelzellen handelte, die durch einen – wenngleich winzig kleinen – Spalt voneinander getrennt waren. Diese Frage war mit den damaligen Lichtmikroskopen nicht eindeutig zu entscheiden. Allerdings entdeckte der Schweizer Neuroanatom Wilhelm His (1831–1904), dass Nervenzellen wie jede Körperzelle als diskrete Einheiten entstehen und allmählich ihre Fortsätze (die Dendriten und das Axon) ausbilden. Infrage kam also, wenn überhaupt, nur eine sekundäre Verschmelzung der Fortsätze zu einem »Synzytium«. Eine solche Annahme machte die Fortleitung von Erregungen zwischen den Nervenzellen plausibel, während die Ansicht einer räumlichen Trennung durch einen sehr schmalen Spalt die Frage aufwarf, wie denn dann die Erregungsfortleitung zwischen den Zellen ablaufen sollte. Andererseits blieb bei einer Kontinuität zwischen den Nervenzellen offen, wie hierbei überhaupt eine komplexe »Informationsverarbeitung« geschehen konnte, da man doch annehmen musste, dass sich die Erregungen zwischen den Zellen schnell und widerstandsfrei ausbreiteten.
(2)Ramón y Cajal glaubte aufgrund seiner lichtmikroskopischen Untersuchungen, die im Wesentlichen auf der sogenannten »Golgi-Färbung« beruhten, bei den Axonen diskrete Endknöpfchen nachweisen zu können – Strukturen, die wenige Jahre später (1897) der britische Neurophysiologe Charles Scott Sherrington (1857–1952) als »Synapsen« bezeichnete. Deren Existenz, Bau und Funktion konnte allerdings erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts mithilfe der Elektronenmikroskopie endgültig erwiesen und durch einen Schüler Sherringtons, John C. (1)Eccles (1903–1997), sowie zahlreiche weitere Neurophysiologen und Neuropharmakologen genauer beschrieben werden. Der Entdecker der seinerzeit bahnbrechenden »Golgi-Färbung«, der italienische Neuroanatom Camillo (1)Golgi (1843–1926), hielt dagegen hartnäckig an der Theorie des Synzytiums fest, wie auch viele andere bedeutende Neuroanatomen jener Zeit, obwohl die Zahl der Gegenbelege schnell wuchs. So kam es zu der bemerkenswerten Situation, dass im Jahre 1906 Golgi und (3)Ramón y Cajal für ihre jeweiligen Arbeiten den Nobelpreis für Physiologie/Medizin erhielten und jeder von ihnen in der eigenen Nobelpreisrede seine gegensätzliche Ansicht vertrat. Aus heutiger Sicht behielt Ramón y Cajal recht, allerdings mit der Einschränkung, dass er damals keine wirklich klaren Belege vorlegen konnte und es neben den vorwiegend vorhandenen chemischen Synapsen durchaus auch elektrische Synapsen (sogenannte gap junctions) gibt, die eine Plasmabrücke zwischen Neuronen darstellen und somit Camillo (2)Golgis Position zumindest teilweise bestätigen.
Die Neurophysiologie entwickelte sich dagegen langsamer, insbesondere weil es bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts keine geeigneten Instrumente gab, um schnelle und schwache elektrische Vorgänge zu messen. Allerdings war seit dem frühen 17. Jahrhundert der Zusammenhang zwischen Nervensystem und Elektrizität bekannt, und der berühmte englische Physiker Isaac Newton (1642–1726) spekulierte, Elektrizität sei das lange gesuchte »Nervenfluidum«. Mit den Entdeckungen der italienischen Forscher Luigi Galvani (1737–1798) und Alessandro Volta (1745–1827) verdichteten sich im 18. und 19. Jahrhundert die Hinweise, dass die Erregungsfortleitung in den Nerven ein elektrischer Vorgang ist. Bahnbrechend war der durch den Physiker und Physiologen Hermann von Helmholtz (1821–1894) am Froschnerven erbrachte Nachweis, dass die neuronale Erregungsfortleitung überraschend langsam verlief, nämlich nur wenige Meter pro Sekunde. Es häuften sich zudem Belege, dass die Membranen der Nervenzellen eine Art Batterie oder Kondensator waren, deren Ladung durch die ungleiche Verteilung von geladenen chemischen Teilchen (Ionen) entsteht (s. Kapitel 2). Zugleich gab es erste Erkenntnisse, wonach Nervenfasern kurze elektrische Signale, Aktionspotenziale genannt, fortleiteten. Deren genauer Verlauf und ihr Zusammenhang mit der Ladung der Nervenzellmembranen blieben jedoch unklar, vor allem da es an geeigneten Messinstrumenten fehlte.
Dies änderte sich entscheidend mit der Entwicklung des Kathodenstrahl-Oszilloskops auf der Grundlage der Braunschen Röhre. Mit seiner Hilfe konnten Herbert Spencer Gasser und Joseph Erlanger in den 1920er Jahren erstmals den genauen Verlauf des Aktionspotenzials darstellen. Schließlich gelang es in den 1950er Jahren den englischen Forschern Alan Hodgkin und Andrew Huxley, in bahnbrechenden Experimenten die Entstehung des sogenannten Ruhemembranpotenzials und des Aktionspotenzials aufzuklären; sie erhielten dafür im Jahre 1963 zusammen mit John (2)Eccles den Nobelpreis. Eine noch ungeklärte Frage war allerdings, ob die Erregungsübertragung an den Synapsen elektrischer oder chemischer Natur war oder eine Kombination aus beidem. Hierüber kam es unter Neurobiologen erneut zu einem erbitterten Streit.
Bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts war die erregende oder hemmende Wirkung bestimmter chemischer Stoffe auf die Aktivität des Herzens und anderer Muskel sowie der Nervenzellen nachgewiesen. Man nannte diese Stoffe später Adrenalin, Noradrenalin und Acetylcholin und identifizierte Letzteren schließlich als Überträgersubstanz oder »Transmitter« zwischen Nervenendigungen und Skelettmuskeln. Damit war klar, dass ein Großteil der Synapsen chemische Synapsen sind, bei denen ein einlaufender elektrischer Reiz, in der Regel ein Aktionspotenzial, in der sogenannten Präsynapse die Ausschüttung eines Transmitters in den synaptischen Spalt auslöst. Dieser Transmitter wird dann in der sogenannten Postsynapse wieder zu einer elektrischen Erregung umgeformt und führt schließlich in der zugehörigen Zelle zu einem Aktionspotenzial. Details dieses Vorgangs erfahren wir im nächsten Kapitel.
Der bereits erwähnte australische Neurophysiologe John (3)Eccles, der sich zunächst vehement gegen das Konzept der chemischen Signalübertragung an der Synapse gewehrt hatte, wurde nach seiner »Bekehrung« in den 1950er Jahren zum Pionier in der weiteren Aufklärung der Synapsenfunktion. Durch die Entwicklung der sogenannten Patch-Clamp-Technik durch die beiden Deutschen Bert Sakmann und Erwin Neher (Nobelpreis 1991) erlebte die Elektrophysiologie in den 1980er Jahren einen weiteren bedeutenden Entwicklungsschub, denn diese Technik erlaubte die genauere Analyse der Ionenkanäle, die als Grundbausteine der chemo-elektrischen Erregungsverarbeitung identifiziert worden waren. Ebenso wichtig waren die Aufklärung der Dopamin-vermittelten synaptischen Übertragung durch Arvid Carlsson und David Greengard sowie der zellulären und molekularen Grundlagen des Lernens und der Gedächtnisbildung durch Eric (5)Kandel (zusammen Nobelpreis 2000); auch diese Forschungen bauten auf der Patch-Clamp-Methode auf. Heute gilt die neuronale synaptische Erregungsübertragung in den Grundzügen als aufgeklärt, wenngleich die genaue Interaktion von Nervenzellen in Zellverbänden noch weitgehend unverstanden ist.
Eine in der Hirnforschung ebenfalls über lange Zeit erbittert geführte Kontroverse betraf die Frage, ob es anatomisch und funktionell abgrenzbare Hirnzentren gibt, wie es die Lokalisationisten annahmen, oder ob Gehirne »holistisch«, d.h. als eine durchgängige Funktionseinheit arbeiten, wie es die Holisten annahmen. Für einen Lokalisationismus sprachen seit der Antike Beobachtungen, dass die Verletzung unterschiedlicher Hirnteile zu unterschiedlichen sensorischen, motorischen, kognitiven oder emotionalen Ausfällen führte. So hatten Verletzungen des Hinterhauptslappens Sehstörungen zur Folge, solche des Stirnlappens führten zu Störungen der Aufmerksamkeit oder zu plötzlichem antisozialem Verhalten. Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte der Anatom Franz Joseph Gall (1758–1828) anhand genauerer anatomischer Untersuchungen die Anschauung, es gebe sowohl in der Großhirnrinde(1) als auch im übrigen Gehirn Zentren, die für unterschiedliche Funktionen im Bereich der Wahrnehmung, der Begabungen und der Charakterzüge verantwortlich seien. Diese Auffassung geriet jedoch in Misskredit, als Gall behauptete, bestimmte Begabungen und Charakterzüge eines Menschen ließen sich an besonderen Ausprägungen des Schädelknochens erkennen. Diese »Phrenologie« genannte Lehre hat sich als völlig unzutreffend erwiesen.
Demgegenüber vertrat der seinerzeit führende französische Physiologe Marie Jean Pierre Flourens (1794–1867) die holistische Auffassung, dass Wahrnehmungen und kognitive Fähigkeiten über das gesamte Gehirn verteilt seien. Er leitete dies aus Beobachtungen ab, wonach Verletzungen der Großhirnrinde(2) in der Regel nicht zu scharf umrissenen Ausfällen führten, sondern je nach Größe der Verletzung zu einer abgestuften Beeinträchtigung von Wahrnehmung, Intelligenz oder Gedächtnis. Eine Wende brachte der aufsehenerregende Befund des französischen Arztes und Forschers Paul Broca (1824–1880), dass eine charakteristische Störung des Sprachvermögens, heute Broca-Aphasie genannt, eindeutig auf eine Verletzung in einem bestimmten Bereich des linken Frontallappens, dem später so genannten Broca-Areal, zurückzuführen war. Dies verhalf dem Lokalisationismus zu erneutem Aufschwung. In der Folge häuften sich dann Befunde über die Lokalisation bestimmter Funktionen: die räumliche Orientierung im rechten Scheitellappen, das »semantische« Sprachzentrum (auch Wernicke-Zentrum genannt) im linken Schläfenlappen, die Verhaltensplanung und Impulskontrolle im Stirnhirn und so weiter. Diese Befunde erhielten dann weitere Bestätigung durch Tierexperimente, in denen die Bedeutung eng umgrenzter Hirnregionen mithilfe von Läsionen oder elektrischer Stimulation untersucht wurde.
1.4 Wo stehen wir heute?
Im Laufe des 20. Jahrhunderts konnten diese Befunde durch genaue anatomische Untersuchungen des Gehirns, insbesondere der Großhirnrinde(3), und der Verknüpfung der einzelnen Gehirnzentren untermauert werden. Dies betraf vor allem Funktionen der Wahrnehmung und der Bewegungssteuerung, später wandte man sich auch den kognitiven Leistungen im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnisbildung und Sprache zu. Diese Entwicklung wurde nachhaltig beeinflusst durch die berühmte »kognitive Wende«, die Ende der 1960er Jahre die Psychologie erfasste. Erst relativ spät begannen sich Forscher den neuronalen Grundlagen der Emotionen und des Psychischen im engeren Sinne zuzuwenden.
Dies lag zum einen daran, dass Emotionen gegenüber Wahrnehmungen und kognitiven Leistungen als weniger »edel« angesehen wurden, aber auch daran, dass die Hirnregionen, die offenbar für sie verantwortlich waren, oft außerhalb der Großhirnrinde(4) lagen, tief im Innern des Gehirns und so für Experimente schlechter zugänglich als die Funktionen der Großhirnrinde(5), die man seit der Erfindung der (1)Elektroenzephalographie (EEG) in den 1920er Jahren relativ leicht untersuchen konnte. Erst das Aufkommen der (1)Positronen-Emissions-Tomographie (PET)(1) und insbesondere der (1)funktionellen Magnetresonanz-Tomographie (fMRT; s. Kapitel 9) in den 1980er Jahren erlaubte es, die Grundlagen des Emotionalen bzw. Psychischen auch im lebenden menschlichen Gehirn ohne chirurgischen Eingriff zu studieren. Bahnbrechend waren hier die Forschungen der Arbeitsgruppe um den portugiesisch-amerikanischen Neurobiologen Antonio Damasio, der die Auswirkungen untersuchte, die eine Verletzung des unteren Stirnhirns auf Impulskontrolle und »moralisches« Verhalten hatte (vgl. Damasio 1994). Dieses Vorgehen wurde dann auf alle erdenklichen Aspekte des Psychischen und seiner Erkrankungen ausgedehnt und von Joseph LeDoux und dem kürzlich verstorbenen Jaak Panksepp (um nur einige zu nennen) durch anatomische und neurophysiologische Experimente an Tieren, zumeist Makaken, Ratten und Mäusen, ergänzt und untermauert. In den letzten Jahren kam eine große Zahl von Studien hinzu, die Licht auf die molekularen und genetischen Grundlagen psychischer Prozesse und ihrer Erkrankungen werfen. Von ihnen wird in diesem Buch noch ausführlich die Rede sein.