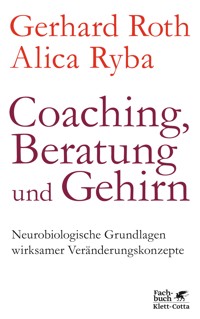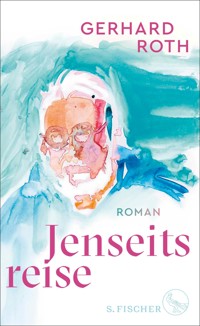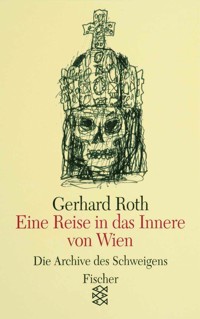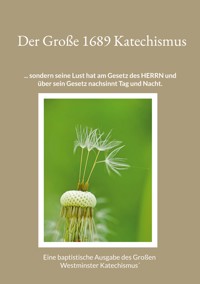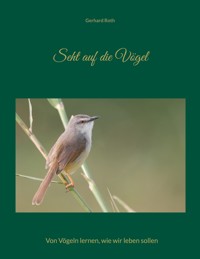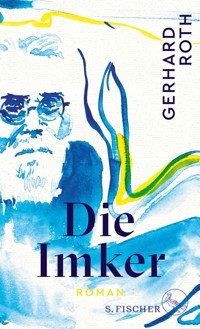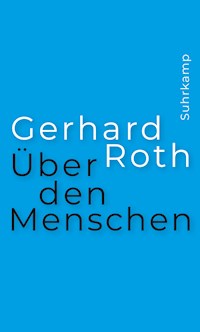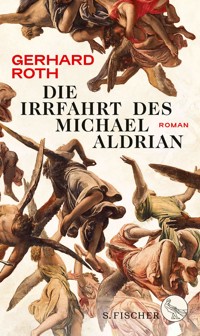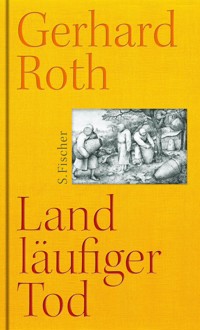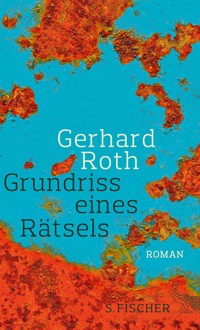19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Übersetzer Emil Lanz lebt allein in einem Haus auf dem Lido von Venedig und beschließt, seinem eintönigen Leben ein Ende zu setzen. Auf der Suche nach einem guten Platz zum Sterben betrinkt er sich und schläft ein. Als er erwacht, beobachtet er einen Mord. Aber ist wirklich passiert, was er gesehen hat? Oder ist sein Selbstmordversuch doch gelungen, und er bewegt sich von nun an in einer anderen Dimension? Als einziger Zeuge des Mordes gerät Lanz jedoch in höchste Gefahr. Er, der eben noch sterben wollte, will nur noch überleben und sieht die Welt wie nie zuvor. Welche Rolle spielt die rätselhafte Fotografin Julia Ellis, welche das tote Flüchtlingsmädchen am Strand? Ist die Wirklichkeit tatsächlich nur das, was wir wahrnehmen? Lanz nimmt es mit einem übermächtigen Gegner auf – dem Unsichtbaren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Gerhard Roth
Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier
Roman
Über dieses Buch
Der Übersetzer Emil Lanz lebt allein in einem Haus auf dem Lido von Venedig und beschließt, seinem eintönigen Leben ein Ende zu setzen. Auf der Suche nach einem guten Platz zum Sterben betrinkt er sich und schläft ein. Als er erwacht, beobachtet er einen Mord. Aber ist wirklich passiert, was er gesehen hat? Oder ist sein Selbstmordversuch doch gelungen, und er bewegt sich von nun an in einer anderen Dimension? Als einziger Zeuge des Mordes gerät Lanz in höchste Gefahr. Er, der eben noch sterben wollte, will nur noch überleben und sieht die Welt wie nie zuvor. Welche Rolle spielt die rätselhafte Fotografin Julia Ellis, welche das tote Flüchtlingsmädchen am Strand? Ist die Wirklichkeit tatsächlich nur das, was wir wahrnehmen? Lanz nimmt es mit einem übermächtigen Gegner auf – dem Unsichtbaren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Gerhard Roth, 1942 in Graz geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und der Südsteiermark. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke, darunter den 1991 abgeschlossenen siebenbändigen Zyklus »Die Archive des Schweigens« und den 2011 abgeschlossenen Zyklus »Orkus«. Für sein Werk wurde Gerhard Roth mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter der Jakob-Wassermann-Preis, der Jean-Paul-Preis sowie der Große Österreichische Staatspreis 2016. »Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier« ist nach »Die Irrfahrt des Michael Aldrian« sein zweiter Roman über Venedig – eine Stadt, die Roth seit Jahrzehnten liebt und durchforscht.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
© 2019 by Gerhard Roth
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490172-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
I Die Einsamkeit des Strandläufers
II Mord und Selbstmord
III Auf der Flucht
IV Das Multiversum
V Der Sturm
Bildnachweise
»Die Hölle ist leer, und alle Teufel sind hier.«
William Shakespeare, Der Sturm
IDie Einsamkeit des Strandläufers
Jeden Morgen ging Lanz zum Strand und spazierte vom aufgelassenen Marine-Hospital, in dessen Nähe er wohnte, bis zum Hotel Excelsior und wieder zurück. »Ich versäume mein Leben«, dachte er, während er ging, »ich lebe nicht. Ich verhalte mich wie ein Fisch in einem Aquarium, der still im Wasser steht und darauf wartet, was geschieht.« Doch es geschah nie etwas, weil er der einzige überlebende Fisch im Wasserbehälter war. Alle anderen waren erschlagen und verspeist worden. Der Anblick und der Lärm der unbekannten Wesen, die er durch die Glasscheiben des Aquariums sah, verbanden ihn als Einziges mit der Außenwelt. Und da eine Woche der anderen glich, lebte er jeden Tag, als ob es sein letzter wäre.
Fast immer hielt er Ausschau nach Strandgut, er fand verschiedene Muscheln und Schneckenhäuser, ein vom Meerwasser glatt poliertes Stück Glas, ein abgeschliffener Stein oder kleine, wie von Ebbe, Flut und Salz gedrechselte Reste von Zweigen und Ästen. Manchmal stieß er auf noch lebende oder bereits tote Tiere: Krabben, aber auch Fische und mitunter sogar eine tote Möwe. Unübersehbar waren jedoch die Reste von Nylonsäcken, Plastikflaschen, zerdrückten Trinkbechern und Zigarettenstummeln. Es war zumeist so früh am Morgen, dass er kaum jemandem begegnete, bis auf Männer und Frauen mit Hunden. Nur selten ergab sich ein Gespräch. Im Winter war er einem mageren, seltsamen Trompetenspieler begegnet, der sich vor das offene Meer gestellt und kläglich auf seinem Instrument geübt hatte.
Doch vor einigen Wochen hatte er ein totes Flüchtlingskind, das am Strand angeschwemmt worden war, gefunden. Zuerst hatte er gedacht, es handle sich um ein Gepäckstück, als er dann näher kam, glaubte er, es sei ein totes Tier, aber zuletzt sah er, dass es ein kleines afrikanisches Mädchen war. Das Kind lag seitlich, leicht gekrümmt vor ihm, das Gesicht war aufgeschwemmt, der Mund halb geöffnet, eine Hand deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger zum Meer hin. Dort entdeckte Lanz jedoch nichts, er sah nur das Entstehen und Vergehen der Wellen, die weiter draußen ein leises, dumpfes Brausen erzeugten und schmatzend am Strand ausliefen. Das Mädchen war barfuß, trug ein rotes T-Shirt sowie einen kleinen Ohrring aus Silber und an den Beinen die Reste einer Jeanshose. Neben dem Kopf und einem seiner Knie befand sich ein Bündel Algen. Während er dastand und das Kind anstarrte, dachte er an nichts. Er hörte nicht mehr die Wellen rauschen oder das Schreien der Möwen, seine ganze Aufmerksamkeit richtete sich jetzt auf den Anblick des toten Mädchens. Plötzlich stand ein bellender Hund neben ihm und beschnupperte – heftig mit dem Schwanz wedelnd – den Leichnam, dann fing er zu bellen an und hörte auch nicht auf, als die Besitzerin, wie er hörte, ihm von weitem befahl zurückzukommen. Lanz drehte sich um, da der Hund – ein schwarz-weiß gefleckter Border Collie – inzwischen ein paar Sprünge in ihre Richtung gemacht hatte. Doch sogleich beeilte sich das Tier, noch immer bellend, zu dem Mädchen zurückzukehren, vor dem es außer sich weiter Laut gab, bevor es aufgeregt zu der älteren Frau in einer Windjacke zurücksprang, abermals kehrtmachte und wieder zum toten Mädchen lief. Lanz stellte fest, dass die Frau ebenso außer sich war wie ihr Border Collie. Sie schrie den Hund an, doch er ließ sich nicht beruhigen.
Gerade als Lanz etwas sagen wollte, erschien ein Polizist, der, nachdem er sich zum Mädchen hinuntergebeugt hatte, die Frau aufforderte, sich mit ihrem Hund zu entfernen und vor den Duschen zu warten. Lanz hatte vergessen, dass er selbst die Polizei über sein Handy angerufen hatte, jetzt fiel es ihm plötzlich wieder ein. Während der Beamte Lanz befragte, eilten weitere Polizisten und Männer in Zivil herbei, begannen die Umgebung nach Spuren abzusuchen und die Tote zu fotografieren. Nach einer halben Stunde durfte er gehen, behielt aber das Geschehen die ganze Zeit über im Kopf.
Am nächsten Tag hatte Lanz keinen Bericht in den Zeitungen entdeckt und auch nicht am folgenden. Erst eine Woche später las er, dass ein totes Mädchen »vor einigen Tagen in der Lagune« aufgefunden worden sei und man annehme, es gehöre zu den illegalen Afrikanern, die am Strand Hand- und Badetücher verkauften oder gefälschte Rolex- und IWC-Uhren anboten. Auch später fand er keine weiteren Meldungen mehr darüber. Offenbar befürchtete man einen Schaden im Tourismusgeschäft, überlegte Lanz.
Einige Male war er bei Einbruch der Nacht am Strand spazieren gegangen. Es war schon warm, und er sah einen Mann und eine Frau, die sich im Halbdunkel auf einer Luftmatratze umarmten. Die Frau gab leise klagende Laute von sich, der Mann keuchte heftig. Lanz konnte nur ein weißes, sich bewegendes Hemd und die aufgestellten Beine der Frau erkennen. Als er weiter ging, bildete er sich ein, auch blonde, lange Haare gesehen zu haben und die heruntergezogenen Jeans des Mannes auf dessen Unterschenkeln. Rasch war er zum Wasser hin abgebogen.
Einige Abende später fiel ihm ein Paar auf, das sich stehend an einer der weißen Strandkabinen vereinigt hatte und stumm miteinander zu ringen schien. Daraufhin spazierte er erst wieder am frühen Morgen den Strand entlang. Einmal bemerkte er bei seiner Rückkehr, dass nicht wie gewohnt der serbische Briefträger seine Post zustellte, sondern ein Afrikaner. Auf Lanz’ fragenden Blick gab er ihm zu verstehen, dass von nun an er die Briefe und Pakete bringen würde. Lanz bot dem Briefträger eine Dose Coca-Cola an, die er schweigend und hastig leerte. Sein Name war, erfuhr Lanz, Samuel Goodluck Oboabona. Er sprach Englisch und Italienisch, doch wollte er nicht über seine Heimat Nigeria sprechen, auch nicht über seine Flucht – nur über seine Angehörigen zu Hause. Lanz hatte den Eindruck, ihn schon einmal gesehen zu haben, bis ihm einfiel, dass es am Strand gewesen war, wo der Briefträger damals als Verkäufer gefälschte Marken-Damenhandtaschen angeboten hatte. Jetzt hatte er sein Haar blond gefärbt, es war auch anders geschnitten als früher, vor allem aber waren die Schläfen glatt rasiert.
Bevor der Afrikaner ihn wieder verließ, fiel Lanz das tote Mädchen am Strand ein, und er fragte ihn, ob er etwas von dem Vorfall wisse. Oboabona schluckte, seine Augen suchten Halt, und er stammelte, dass es die Tochter eines Freundes sei, der mit ihr am Abend in der Dunkelheit den Strand aufgesucht hatte. Tränen traten in seine Augen, und er drehte sich abrupt um. Lanz verabschiedete ihn flüchtig, blickte zum Fenster hinaus und sah ihn gleich darauf mit seinem Moped und dem Postkarren am Gartentor der gegenüberliegenden Villa läuten.
Bis zum Abend übersetzte Lanz dann weiter »Gullivers Reisen« aus dem Englischen ins Italienische und las anschließend seine Übersetzung von Anfang an durch: wie das Schiff mit Namen »Antilope« am 5. November 1699 auf der Fahrt nach Ostindien an einem Felsenriff zerschellte, das Rettungsboot kenterte und der überlebende Gulliver schließlich als Einziger schwimmend an einen Strand gelangte, wo er erschöpft einschlief. Da der Vorname des jungen Mannes Lemuel war, dachte Lanz immer wieder an den Briefträger, der mit Vornamen Samuel hieß, und das ertrunkene Mädchen. Lanz hatte »Gullivers Reisen« schon als Kind in einer gekürzten und illustrierten Ausgabe gelesen. Beim Übersetzen sah er die bunten Zeichnungen immer wieder vor sich, abwechselnd mit den Illustrationen von Grandville aus dem Exemplar, das er beim Studium der englischen Sprache verwendet hatte. Es war wunderbar, fand Lanz, dass Gulliver aus dem Meer an eine fremde Küste gespült wurde und – erschöpft vom heißen Wetter und einer Pinte Branntwein, die er getrunken hatte, bevor er das sinkende Schiff verließ – eingeschlafen war. Von da an hatte der Autor Jonathan Swift nämlich alle Möglichkeiten einer phantastischen Reise in der Hand gehabt. War sie nur ein Traum gewesen? War Gulliver aufgrund seiner seltsamen Erlebnisse verrückt geworden? War alles nur eine aus Seemannsgarn gesponnene Lügengeschichte? Oder beruhte sie tatsächlich auf Wahrheit, wenn auch nur in einem übertragenen Sinn?
Lanz klappte seinen Laptop zu und verließ das Haus. Er ging die Uferpromenade, den Lungomare Gabriele D’Annunzio, mit den Bänken zwischen den Bäumen hinunter bis zur Hauptstraße, der Gran Viale Santa Maria Elisabetta, setzte sich vor einem Imbissladen auf einen der am Gehsteig bereitgestellten Stühle und erhielt das gewünschte Glas Merlot, eine Pizza Margherita und ein freundliches Wort des Lokalbesitzers. Sie sprachen nie miteinander, weil Lanz immer in Gedanken war, wenn er dort eine Pause machte. Nur am Anfang, als er bereits eine ganze Woche lang Pizza, Spaghetti, Lasagne oder Brötchen mit Stockfischmus gegessen und dazu Merlot getrunken hatte, hatte der Lokalbesitzer sich ihm namentlich und mit der Bitte vorgestellt, ihn Giuseppe zu nennen, und als Lanz nach seinem Vornamen Emilio, wie er in Italien hieß, den Familiennamen »Lanz« hinzugefügt hatte, hatte Giuseppe scherzhaft ausgerufen: »Ah! Mario Lanza!« Daraufhin hatte Lanz die Pizzeria vierzehn Tage nicht mehr betreten, und beim nächsten Mal hatte Giuseppe ihn laut als »Signor Lanz« begrüßt, um ihm zu zeigen, dass er ihn respektierte. Das blieb auch bei allen weiteren Besuchen so, manchmal nickten sie einander überhaupt nur kurz zu.
Diesmal hatte Giuseppe ihm rasch ein zweites Glas Merlot serviert, »auf Kosten des Hauses«, wie er bemerkte. Nach der Mahlzeit ging er müde nach Hause. Den ganzen Weg stellte er sich vor, Gulliver zu sein, der auf der Insel Liliput vor der Nordküste Australiens gefesselt am Strand lag. Auf seiner Couch liegend, nahm er weitere Gläser Merlot zu sich, bis er betrunken war und die Augen schloss. Beim Einschlafen fiel ihm die Pistole ein, die er in einer leeren Kommodenlade versteckt hatte. Er hatte sich geschworen, sie erst herauszunehmen, wenn er nicht mehr weiter wüsste. Die zwei Jahre, die sie seither dort lag, hatte er sie nie angesehen und daran gedacht, sie ins Meer zu werfen.
Bei Tagesanbruch erwachte er. Eine Zeitlang lag er untätig auf dem Bett und korrigierte dann seine Übersetzung von Gullivers Abenteuern bei den Riesen in Brobdingnag und dachte wieder an seine eigene Kindheit voller Ängste und Tagträume. Erst zu Mittag spazierte er zum Meer hinunter. Kaum hatte er den nach dem Dichter Gabriele D’Annunzio benannten Lungomare erreicht, fiel ihm eine Frau in einem schwarzen Bikini auf, die am Ufer kniend etwas fotografierte. Auf den ersten Blick fühlte er sich von ihr angezogen. Er beeilte sich, in die Strandkabine zu kommen, die er wie im Jahr zuvor für die Sommermonate gemietet hatte, zog seine Sneakers, sein T-Shirt und seine Jeans aus und schlüpfte in seine Badehose. Auch etwas Geld vergaß er nicht einzustecken.
Noch immer kniete die Frau auf dem feuchten Sand am Ufer. Er trat an sie heran und entdeckte, dass es eine große, gläserne Qualle war, die vor ihr lag. Zugleich sah er im Wasser einen kleineren Schwarm des Meerestiers. Er betrachtete die Frau genauer: ihr blondes Haar, ihre langen Finger und Zehen und ihren schlanken Körper. Als sie die Kamera absetzte und kurz zu ihm aufschaute, empfand er die Glücksgefühle eines spontan Verliebten. Sie hatte große dunkle Augen, geschminkte Lider, Wimpern und Brauen.
Obwohl es nicht ratsam war, sich weiter in das Wasser zu wagen, tat sie es ohne Scheu, um den kleinen Quallenschwarm aufzunehmen. Langsam näherte sie sich ihm, hob die Kamera und blickte durch den Sucher, um gleich darauf eilig ans Ufer zurückzukehren.
»Quallen?«, fragte er auf Italienisch, »Meduse?«
»Ja, eine ganze Menge«, antwortete sie auf Englisch und lachte.
Er wartete, bis sie sich ein paar Schritte entfernt hatte, und folgte ihr dann vorsichtig. Seit er auf dem Lido wohnte, ging er gerne Menschen nach, die ihn anzogen oder abstießen. Auf diese Weise lernte er auch viele kleine Gassen kennen. Vor allem liebte er die Villen und grünen Kanäle, in denen Motorboote lagen, und die Ufer, die von Gras und Bäumen bewachsen waren. Ein Jahr zuvor hatte er sich selbst ein Boot mit Außenbordmotor und ein Fahrrad gekauft, die er hin und wieder benutzte. Als er einmal ungesehen einer hübschen Frau gefolgt war, durchquerte er den halben Ort, bis sie schließlich in ihrem Segelboot an einem der Kanäle verschwunden war. Ein anderes Mal schlich er einem grauhaarigen Mann mit einem Strohhut und Spazierstock hinterher. Der Mann hatte immer wieder auf Bänken Platz genommen und mit sich selbst gesprochen. Dadurch war Lanz jedes Mal gezwungen gewesen, sich auch eine Bank zu suchen, von der aus er den Fremden weiter im Auge behalten konnte. Nach einer Stunde hatte der Alte vor Giuseppes Pizzeria Platz genommen, und Lanz hatte den Wirt gebeten, ihn dem Fremden vorzustellen. Zu seiner Überraschung war er ein Archäologe gewesen, der mehr als zehn Jahre bei den Ausgrabungen in Pompeji mitgearbeitet hatte. Er war erfreut über Lanz’ Interesse und erzählte ihm Neues über die Fresken in den Häusern der durch den Ausbruch des Vesuvs verschütteten Stadt.
Es war so heiß, dass Lanz zwischendurch in das Wasser griff und sich das Haar befeuchtete, während die Frau sich unter eine der öffentlichen Duschen am Strand stellte. Vorher hatte sie ihre Kamera einem weißgekleideten Bademeister anvertraut, mit dem sie ein paar Worte wechselte und der ihr nachher ein Handtuch reichte. Sie nahm wieder ihre Kamera, beeilte sich, im heißen Sand eine Hütte mit einem kleinen Laden zu erreichen, und kam mit einem Sonnenhut auf dem Kopf und Badeschuhen an den Füßen wieder heraus. Eilig kaufte auch Lanz sich eine grüne Baseballkappe und lief wieder zum Meer hinunter, ohne die Frau aber zu entdecken. Am Himmel waren jetzt kleine, weiße Wolken zu sehen, und er spürte den scharfen Muschelschotter an den Füßen, wenn er in seichtes Wasser trat. Wich er auf den Strand aus, schmerzte ihn der heiße Sand, und er begab sich wieder zurück in das Wasser. Große Haufen Seetang, grün oder ausgebleicht grau, ließen ihn an papierene Luftschlangen nach dem Ende des Karnevals denken. Dazwischen lag an den Strand geschwemmter Abfall, vor dem ihm, wie immer auf seinen Spaziergängen, ekelte. Er spürte aber zugleich, dass er die Eigenschaften eines Misanthropen besaß.
Während er nach der Unbekannten Ausschau hielt, registrierte er gleichzeitig eine zerdrückte Zigarettenpackung, auf der das bekannte Kamel abgebildet war, die Kapsel einer leeren Plastikflasche Coca-Cola, einen Eisbecher, ein zerknittertes Nylonsäckchen, Teile von Muscheln, die weißen ovalen Brustschilde von Tintenfischen, Krabben im Wasser vor seinen Füßen und ein angeschwemmtes blaues Feuerzeug. Endlich sah er den schwarzen Bikini und den Sonnenhut der Unbekannten, die abermals am Wasser kniete. Als er sie erreicht hatte, stellte er erstaunt fest, dass sie das fotografierte, was er gerade selbst gesehen hatte. Sie erhob sich, blieb aber ein paar Schritte weiter wieder stehen, um die schwarzen Schalen von Miesmuscheln aufzunehmen. Allmählich begriff er, dass die Unbekannte Zufallsbilder von angeschwemmten Gegenständen machte, Stillleben aus toter Materie: eine leblose, dunkelbraune Qualle, die von den auslaufenden Wellen umspült war und zuerst ihre Unterseite zeigte, dann aber von der Strömung seitlich weitergetragen wurde – ein Spielball der Wasserbewegung –, außerdem Zigarettenstummel, ein kleines rotes Plastikflugzeug, wie man es in Überraschungseiern fand, eine halbe Zeitungsseite, Schnüre, den Griff eines alten hölzernen Spazierstocks.
Das Wasser am Ufer war glasklar, es schäumte, wenn es auslief, und gab ohne Unterbrechung die Glucksgeräusche der Wellen von sich, die, wie sich Lanz oft sagte, am Strand zu sprechen anfingen. Die Frau nahm inzwischen Schalen von weiteren Meeresmuscheln und Meeresschnecken auf, einen Schritt weiter ein gelbes Plastikfläschchen Sonnenöl, flache Steine, abgewetzte, glatte Splitter eines Ziegels, Styroporteilchen und einen nassglänzenden alten Pinienzapfen. Möwen segelten stumm über ihren Köpfen. Von den Liegestühlen der Badegäste her waren Rufe, Schreie und Gesprächsfetzen zu hören und von oben, vom blau-weißen Himmel her, das Brummen eines einmotorigen Flugzeugs und das ferne Grollen der hoch über ihnen fliegenden Jets.
Lanz wandte sich den gepflegten Füßen der Frau, der Form ihrer Zehen und Nägel zu, und beneidete insgeheim den Mann, der mit ihr zusammenlebte. Es musste wohl ein spießiger, reicher Amerikaner sein, dem sie als Fassade für seine Männlichkeit, wie er sich sagte, diente. Die Unbekannte hatte ihn längst bemerkt, doch sie schenkte ihm kaum Beachtung. Im Wasser huschten gerade Schwärme von winzigen Fischen ruckartig, und als seien sie über irgendetwas erschrocken, aus seinem Blickfeld. Was die Fotografin vielleicht darstellen wollte, dachte Lanz, waren die Folgen des Zivilisationsprozesses. Die Zerstörung des Schönen durch die Gier, die ihre Aufmerksamkeit nur auf das Eigene richtete. Der Gedanke kam ihm zugleich hochtrabend und wahr vor. Die Kamera der Fotografin war gerade auf einen kleinen Felsen neben dem Betonsteg, der in das Meer hinausführte, gerichtet, als sich die Frau plötzlich zu ihm hindrehte und wortlos ein Bild von ihm machte. Sie winkte ihn lachend zu sich und zeigte ihm das Display ihrer Digitalkamera, auf dem er sich abgebildet sah, mit der grünen Baseballkappe und dem gewohnt schwermütigen Blick. Er lächelte, nickte unabsichtlich und ging weiter, ohne sich noch einmal nach ihr umzudrehen. Ich Idiot, sagte er zu sich selbst. Weshalb drehst du dich nicht um und winkst ihr zu? Am Ufer entdeckte er jetzt eine tote Taube im Sand und einige Spuren von Lachmöwen, deren Schwimmhäute zwischen den Zehen im Abdruck deutlich sichtbar waren. Vor dem geschlossenen Hotel des Bains gingen zwei weißgekleidete Männer – alles aufmerksam mit ihren Blicken kontrollierend – auf und ab. Die wie mit Stroh gedeckte Kabinenreihe verlieh dem Strandbad das Aussehen eines afrikanischen Eingeborenendorfes am Ende des 19. Jahrhunderts. Abermals stiegen misanthropische Gefühle in ihm hoch, und er dachte sich gleich wieder abzuwenden – schließlich kannte er längst alles, was für ihn hässlich war –, doch hielt er an.
Das Hotel des Bains machte nach wie vor einen verlassenen Eindruck. Einige junge amerikanische Studentinnen und Studenten sammelten am Strand vor dem heiligen literarischen Gebäude, das in Thomas Manns »Tod in Venedig« eine Rolle spielt, Muscheln, die für sie vielleicht den Tod symbolisierten. Zwei weiße Tretboote mit Touristen, sah Lanz, als er weiterging, erreichten soeben das Meeresufer, und andere Badegäste lagen vereinzelt auf Handtüchern in der Mittagshitze. Kleine Felsen in der Nähe der Betonstege, die in das Meer führten, waren mit Miesmuscheln gespickt und von Algen bekleckert. Neben dem Hotel waren dichte Reihen bunter Sonnenschirme aufgestellt, Lanz verstand gar nicht, weshalb sie ihm auf einmal auffielen. Gerade als er überlegte, ob er nicht zu der Unbekannten zurückkehren sollte, erblickte er die Frau vor einer weiteren Ansammlung von Quallen im Wasser. Er trat unauffällig näher. Die größeren Quallen sahen aus wie Millefiori-Briefbeschwerer, dachte er, die kleineren wie Puppenfallschirmchen. Die Fotografin war so beschäftigt mit den toten Tieren, dass er sich unbemerkt wieder entfernen konnte.
In den letzten Monaten, kam es ihm wieder in den Sinn, hatte er mehrmals an Selbstmord gedacht, ohne dass es einen bestimmten Anlass dafür gegeben hatte. Automatisch hatte er dann angefangen, sich mit irgendetwas zu beschäftigen. Entweder vertiefte er sich in eine Übersetzerarbeit oder er schaltete den Fernseher ein, manchmal, wenn die Gedanken zu intensiv gewesen waren, war er zu Giuseppe gegangen und bis zur Sperrstunde geblieben. Erst dann war er nach Hause zurückgekehrt und betrunken in tiefen Schlaf gefallen. Er wollte jedes Mal an einem Ort, der nur selten von Menschen aufgesucht wurde, Suizid begehen. Sobald er sich aber besser fühlte, vergaß er seine Gedanken. Diesmal fand er es logisch, dass er, sobald er wieder zu Hause war, die Pistole aus der Kommode nehmen und sich ins Herz schießen würde. Vielleicht war es jedoch besser, mit dem Fahrrad zum Leuchtturm hinter dem kleinen Flugplatz zu fahren und dort sein Leben zu beenden, überlegte er.
Vor »Gullivers Reisen« hatte er den frühen Science-Fiction-Roman »Der Unsichtbare« von H.G. Wells übersetzt, in dem ein Wissenschaftler, Dr. Griffin, eine chemische Formel entdeckt, die seinen Körper unsichtbar macht. Dr. Griffin probiert es an sich selbst aus, wird unsichtbar, kann sich aber nicht mehr zurückverwandeln. Er vermummt sich daher mit Verbänden und trägt eine Sonnenbrille, als er das Universitätsgebäude verlässt und in einem verschneiten Dorf untertauchen will. Während der Arbeit an seiner Übersetzung hatte Lanz sich in den Unsichtbaren versetzt, wie damals, als er die Geschichte im Gymnasium zum ersten Mal gelesen hatte. Der Wunsch, unsichtbar zu sein, hatte ihn durch seine gesamte Kindheit begleitet und dadurch die Neugier, auf diese Weise mehr über die Menschen zu erfahren als jemals ein anderer, genährt. Lügen, Intrigen, Betrug, Gewalt, glaubte er schon als Gymnasiast, waren vermutlich so alltäglich wie das Atmen.
Zerstreut wie er war, hatte er gar nicht bemerkt, dass die Unbekannte ihn auf der Seite der Sonnenschirme wieder überholt hatte. Sie begrüßte dort einen älteren Mann mit einem Kuss auf die Wange. Seine Habichtsnase war eindrucksvoll wie sein schwarzgrauer Vollbart. Aus seinem Haar und seiner Gestik schloss Lanz, dass er Amerikaner oder Italiener war – und ein Leitwolf. Lanz machte kehrt, da er sich schon vor dem Hotel Excelsior befand. Seine Füße, sein Rücken, die Ober- und Unterschenkel brannten von der Sonne, und der Sand war jetzt so heiß, dass es fast nicht mehr möglich war, darauf zu gehen. Also war es wohl das Beste, umzukehren. Zwei Stunden nachdem er aufgebrochen war, um der Unbekannten zu folgen, erreichte er wieder den Lungomare D’Annunzio und seine Badekabine, legte die Baseballkappe ab, duschte mit kaltem Wasser und lief in das Meer hinaus. Er kraulte bis zur weißen Hütte der Strandwache. Die zwei ganz in Rot gekleideten jungen Männer saßen nicht weit davon entfernt am Ufer, zwischen einem Motor- und einem Ruderboot, die ebenfalls rot waren und wie die beiden Helfer die weiße Aufschrift »Salvataggio« – »Rettung« – trugen.
Das Wasser war warm, vermischt mit einer kühlenden Unterströmung, die ihn belebte. Er ließ sich von der Strömung an den Strand treiben, doch er schwamm nicht noch einmal auf das offene Meer hinaus, wie in seiner Jugend. In Gedanken versunken, schwebte er auf dem Rücken im Meer. Die Unbekannte ging ihm nicht aus dem Kopf, obwohl er sich dagegen wehrte. Er hatte ungeschickt reagiert, als sie ihm sein Bild auf dem Display ihrer Kamera gezeigt hatte, fiel ihm wieder ein. Hätte er sie nicht fragen sollen: »Who is this man?« Oder sie auf ein Getränk einladen und um das Bild bitten? Er hätte eine Bemerkung machen können, dass jetzt er an der Reihe sei, sie zu fotografieren oder irgendetwas anderes, irgendetwas … Vielleicht war der Zwischenfall aber ein Hinweis gewesen, dass er allein bleiben würde, weiter der einsame Fisch im Aquarium, der Sonderling, der die Bücher von Schriftstellern in eine andere Sprache übersetzte und in dieser Zeit zu einer oder mehreren erfundenen Figuren in einer erfundenen Welt wurde.
Einer der Räume in seiner kleinen Villa war vollgestopft mit Büchern, seiner Droge, wie er sich sagte, die ihn den Alltag ertragen ließ. Jetzt, da er die Übersetzung von »Gullivers Reisen« abgeschlossen hatte, fühlte er sich nutzlos. Die Lesewelt wurde für ihn nur dann wirklich lebendig, wenn er gerade Romane, Theaterstücke und Gedichte übersetzte oder wenn sie ihn von der ersten Zeile an verschlangen. Jeder Leser, dachte er, war ein Jonas, den ein Monster verschluckte und tief unter der Oberfläche eines Gedankenmeeres in seiner fremden Innenwelt einschloss. Das schützte ihn eine Zeitlang vor den Misslichkeiten des Alltags und vor der Leere und Gleichgültigkeit der Einsamkeit.
Aber das war nicht der wahre Grund, weshalb er zugleich an die unbekannte Frau denken musste, ihre Lippen, ihre Haare, die Zähne, ihre Finger und Zehen vor sich sah. Es war das Bewusstsein, dass er nicht mutig gewesen war. Er war bei Frauen kein Versager, sondern verlor, wenn er sich verliebte, seine Schlagfertigkeit. Er empfand in der ersten Phase seiner Verliebtheit kaum sexuelle Gefühle, sondern nur eine tiefe Zuneigung, die sich erst allmählich in Begierde verwandelte. Hatte er hingegen Bekanntschaften gemacht, bei denen es ihm nur um das Eine gegangen war, war er seltsamerweise von Anfang an ein guter Liebhaber gewesen.
Während er, am Strand liegend, auf das Wasser und die Wellen blinzelte, spukte ihm die fotografierende Unbekannte weiter durch den Kopf.
Dann dachte er wieder an seine Pistole, an den Tod und das Nicht-Sein. Er würde zu einem Tropfen im Meer werden, sagte er sich. Nichts würde sich durch seinen Tod ändern – andere Menschen würden sein Haus bewohnen, sich am Strand sonnen und glücklich oder traurig sein, an ihr Alter denken, an ihre Kindheit und nicht zuletzt an ihren Tod.
Vom kleinen Flugplatz Venezia-Lido flog, wie er wusste, später wieder ein einmotoriges Flugzeug zuerst den Strand entlang und dann aufs Meer hinaus und zuletzt über die Häuser zurück zum Flugplatz. Jedes Mal, wenn es über ihn hinwegflog, dachte er an den Tod. Die Quallen, die an den Strand gespülte Taube, die Muschelschalen und vor allem das tote Kind fielen ihm wieder und wieder ein. Ihre Wahrnehmungen und Empfindungen waren erloschen.
Auf dem morgendlichen Weg über den Lungomare D’Annunzio bemerkte er an einem Baumstamm die Todesanzeige mit dem Farbfoto einer greisen Frau. Sie war, wie er aus den Geburts- und Todesdaten errechnete, 94 Jahre alt geworden. Er überlegte, wie alt er selbst sein würde, wenn seine Mutter mit 94 Jahren stürbe. Würde ihm dann ihr Tod mehr oder weniger gleichgültig sein? Vor allem, wenn sie vorher zum Beispiel an Alzheimer erkrankte? War es nicht herrlich, am ruhigen, schönen Lidostrand zu liegen und noch am Leben zu sein? Jetzt erst fiel ihm auf, wie sehr seine Empfindungen und Urteile schwankten. Einerseits liebte er das Dasein, andererseits kam es ihm vor, als führte er ein totes Leben. Wenn die Unbekannte mit ihm gesprochen hätte, wäre er jetzt vermutlich glücklich, dachte er.
Eine Möwe saß auf der Spitze eines der großen Zelte der Strandbar. Der junge Bademeister langweilte sich augenscheinlich, er stapfte herum, gähnte entspannt in seiner Kabine, dann kratzte er sich am Kopf, pfiff, gähnte wieder und machte sich auf den Weg, um die Sonnenschirm- und Liegestuhlreihen zu kontrollieren. Kaum war er verschwunden, kam ein älterer Strandhändler mit weißem Bart auf Lanz zu und wollte ihm angeblich original indischen Schmuck verkaufen. Es war Ramschware, sah Lanz, der Mann tat ihm jedoch leid, und so hörte er ihm zu. Aber er wollte weder einen Ring noch ein Armband kaufen, die aus Silber und mit teuren Edelsteinen bestehen sollten – tatsächlich jedoch aus Kunststoff und gefärbtem Glas waren. Er gab dem Mann schließlich zu verstehen, was er davon hielt. Ohne zu zögern, griff dieser daraufhin in die Brusttasche seines Hemdes und bot ihm getrocknete Pflanzenstücke an.
»Tea!«, flüsterte er beschwörend. »You make tea and you dream to be in paradise.«
Als er Lanz’ Interesse bemerkte, erklärte er, dass es sich um getrocknete Teile von Pilzen handle, aus denen ein Tee gemacht werde, der seine Welt verändern würde.
»Only a pretty small part« – er ließ ein Stück des Pilzes zwischen den Fingern hervortreten: »Not too much or you become crazy.« Er bog sich kurz vor Lachen und verlangte dreißig Euro.
»Sind Sie morgen auch noch da?«, fragte Lanz.
»Ja, morgen. Und übermorgen. Die ganze Woche.«
»Wenn es gut ist, kaufe ich dir morgen alles ab, was du eingesteckt hast. Aber jetzt zahle ich dir nichts dafür.«
»Oh no! You must pay thirty Euro!«
»Für ein einziges Stück?«
»Nein, für drei.«
»Gut, ich nehme eines.«
Der Inder war sichtlich enttäuscht. »I don’t know, if I have something tomorrow«, antwortete er trotzig. Wortlos reichte er ihm ein Papiersäckchen, steckte den Zehn-Euro-Schein ein und ging grußlos davon.
Am Abend korrigierte Lanz wie immer mit dem Mont-Blanc-Kugelschreiber, den ihm sein Vater zum Schulabschluss geschenkt hatte, den zweiten Teil von »Gullivers Reisen« weiter, der im Königreich der Halbinsel Brobdingnag an Kaliforniens Küste spielt: eine Stelle im Buch, an der ihm jedes Mal eine gewisse Ähnlichkeit mit Lewis Carrolls »Alice im Wunderland« auffiel, da Alice selbst abwechselnd riesig groß und winzig klein wird. Außerdem dachte er daran, dass das Pilzstück des Inders in einer Teeschale auf dem Küchenregal lag. Er wusste natürlich, wie man Tee zubereitet, aber er wollte zunächst das Manuskript fertig korrigieren, und da war es gescheiter, Kaffee zu trinken. Er fand auch eine angebrochene Schachtel mit Keksen und arbeitete, bis er zur Episode kam, in der Gulliver plötzlich zwanzig riesigen Wespen ausgesetzt ist, jede so groß wie ein Rebhuhn. Sie »brummten lauter als die Basspfeifen von ebenso vielen Dudelsäcken … Ich hatte jedoch den Mut … meinen Hirschfänger zu ziehen und sie in der Luft anzugreifen«. – Die Wespen: meine Gehirngespinste, sagte sich Lanz. »Vier von ihnen tötete ich, die übrigen entwischten aber, und ich schloss sogleich das Fenster«, las er weiter. Die Menschen im Buch waren Riesen und an die zwölf Meter groß, die Getreidehalme zehn Meter hoch, die Hagelkörner achtzehnmal so groß »wie anderswo«. Die Räume des Königspalastes hatten eine Höhe von siebzig Metern, der Tempelturm maß neunhundert Meter, und seine Wände waren dreißig Meter dick. Bis zu 48 Kilometer türmten sich die Berge auf, und die einzelnen Bücher in der Bibliothek des Königs hatten eine Länge von sechs Metern. Um eine einzige Zeile zu lesen, musste Gulliver zehn Schritte gehen. Lanz wusste die ungefähren Maße noch aus seiner Kindheit, als er die englische Fassung für Zehnjährige gelesen hatte. »Eines Tages ließ die Gouvernante unseren Kutscher bei mehreren Läden anhalten«, hatte Lanz übersetzt, »wo die Bettler die Gelegenheit ergriffen, sich von beiden Seiten an die Kutsche zu drängen; sie boten mir den schrecklichsten Anblick, den ein europäisches Auge jemals gesehen hat.« Swift beschrieb auch die Hinrichtung eines Mörders. »Der Verbrecher war auf einem Stuhl festgebunden worden, und der Kopf wurde ihm mit einem riesigen Schwert abgehauen. Die Venen und Arterien spritzten eine so große Menge Blut hoch in die Luft hinauf, dass er die Fontäne aus dem Spritzbrunnen des Schlosses von Versailles bei weitem übertraf … Und als der Kopf des Verurteilten auf den Boden der Hinrichtungsstätte fiel, klatschte es so, dass ich erschrocken aufsprang, obwohl ich eineinhalb Kilometer weit entfernt war.«
Bis Lanz das Kapitel fertig korrigiert hatte, war es ein Uhr früh, und er legte sich erschöpft auf sein Bett und stellte sich vor, Gulliver zu sein und unter den Riesen zu leben, deren Gleichgültigkeit seine eigene gewaltig übertraf.
Gegen drei Uhr morgens erwachte er von einem Geräusch, aus dem er schloss, dass jemand in sein Haus eingedrungen war. Er hatte das angelehnte Fenster in seinem Bibliothekszimmer gegen das andere schlagen hören und das dumpfe Geräusch eines auf den Boden springenden Menschen wahrgenommen, war er überzeugt. So leise er konnte, stand er auf und schlich in den Vorraum und von dort in den ersten Stock hinauf, wo er die Pistole aus der Schublade der Kommode nahm. Da er den Militärdienst abgeleistet hatte, konnte er mit der Waffe umgehen. Er lud das vorbereitete Magazin, begab sich immer noch im Dunkeln die Stiegen hinunter, entsicherte die Pistole und wartete auf ein weiteres Geräusch. Abermals vernahm er, wie das Fenster zuschlug … Lautlos öffnete er die Tür und betätigte den Lichtschalter. Sofort erkannte er, dass sich draußen ein Unwetter zusammenbraute. Zwar konnte er noch keinen Donner hören, doch sah er in der Ferne Blitze aufleuchten, und Windböen ließen die Fenster erzittern. Er legte die Pistole auf einen Stuhl, schloss die Läden und ging zurück ins Schlafzimmer, nicht ohne die Waffe mitzunehmen und neben dem Bett auf das Tischchen zu legen.
Als er erwachte, war es still, und der Himmel hellte sich gerade auf. Das Unwetter hatte sich offenbar verzogen, stellte er fest, als er hinausblickte. Da alles ruhig und der Himmel von anziehender Schönheit war, fiel ihm ein, dass es ein guter Tag war, um zu sterben. Er duschte, putzte sich die Zähne und kleidete sich an, denn er spürte, dass er jetzt wirklich bereit war, sich das Leben zu nehmen. Er blickte auf die Uhr: Es war elf Minuten nach sechs, also war es einfach, in ein Vaporetto zu steigen und irgendwo hinzufahren, wo es ruhig war. Der Lido oder das offene Meer waren ihm zu pathetisch für einen Abgang. Es sollte wie das Allerselbstverständlichste passieren und kein Aufsehen erregen. Eigentlich wollte er nur endlich aus seinem eigenen Leben verschwinden. Am besten sich in Luft auflösen wie der Unsichtbare von H.G. Wells, dachte er.
Er steckte die geladene Pistole in die Tasche seiner olivgrünen Windjacke, vergaß auch nicht das Portemonnaie mit seinem Ausweis, die Bankkarten und genügend Bargeld. Das Fahrrad ließ er zu Hause und brach ohne Hast zur Vaporetto-Station Santa Maria Elisabetta auf. Er empfand nichts als das gewohnte Gefühl der Einsamkeit und Leere.
Wohin sollte er fahren? Eigentlich wollte er es dem Zufall überlassen, aber dann ging er in Gedanken alle Möglichkeiten durch und entschied sich für die Insel Torcello. Sie hatte ihn bisher weniger angezogen, weil er keine Neugier auf Kirchen hatte. Sein Vater war Atheist gewesen, und seine Mutter hatte ihm stets gesagt, sie habe keine Zeit für Religion, während seine Frau Alma ihm bis zu ihrem Tod vorgeworfen hatte, dass er daran desinteressiert war. Was Lanz jedoch niemandem gesagt hatte, war der Umstand, dass er in den schwersten Momenten seines Lebens stumm mit dem Schöpfer sprach. Er hatte sogar eine Stimme im Kopf wahrgenommen und sich an ihre Anweisungen gehalten. Nach außen hin war er manchmal Atheist, manchmal Agnostiker gewesen. Er hatte die großen Religionen als »Fließbandreligionen« bezeichnet und es immer abgelehnt, über den Glauben, das Jenseits oder die Wiedergeburt zu sprechen, denn zwangsläufig reihte sich dann eine Banalität an die andere. Religion war für ihn eine Innensprache, die nur in der Musik ihren Ausdruck fand – in Mahler- und Bruckner-Symphonien, Schubert-Quartetten, Weberns akustischen Splittern, Johann Sebastian Bachs Passionen oder Arvo Pärts und Sofia Gubaidulinas Klängen. Doch hatte er in den letzten beiden Jahren keine Musik mehr gehört, sie war nur noch fragmentarisch in seinem Gedächtnis erhalten. Seine Leidenschaft für Bücher und Bilder hatte dafür zugenommen.
An der Station Elisabetta musste er nicht lange warten. Nachdem er aus der Wartehalle auf den Steg getreten war, sah er schon das Vaporetto kommen, in dem, wie er beim Einsteigen registrierte, Migranten saßen, die irgendwo Schwarzarbeit verrichten würden. Ihr Anblick erfüllte ihn mit Scham darüber, dass er dabei war, sein Leben wegzuwerfen, obwohl es ihm, verglichen mit den Flüchtlingen und Zuwanderern, mehr als gut ging. Einige stiegen jetzt aus und machten sich stumm davon, und Lanz blickte ihnen nach, als gingen sie in den Tod und nicht er. Sie waren, um ihr Leben zu verbessern, nach Europa gekommen, voller Träume und Hoffnungen wie Franz Kafkas Karl Roßmann im Roman »Der Verschollene«, dachte er. Darin verlässt der sechzehnjährige Karl seine Heimat und gelangt in Amerika unschuldig auf die berühmte schiefe Bahn. Der Roman hatte sich für Lanz wie ein Slapstik-Film mit Untertiteln gelesen. Immer wieder in seinem Leben hatte er das Buch zur Hand genommen und sich – wie auch bei den Erzählungen und anderen Romanen Kafkas – gefragt, woher der Dichter das alles wusste, denn jede Zeile kam ihm wie das Untersuchungsprotokoll vor, das ein Psychiater über seinen Patienten verfasst und sich dabei jedes Kommentars enthalten hatte. Roßmann schlittert von einer Katastrophe in die nächste, bis er endlich – angelockt von einem Plakat, auf dem Arbeitskräfte gesucht werden – in das »Naturtheater von Oklahoma« reist, wo er von Engeln mit Posaunen empfangen wird. Tatsächlich sind die Engel aber verkleidete Frauen in einem riesigen Wandertheater, mit dem er zukünftig auf Tournee gehen wird. Oder aber Karl ist bereits gestorben und befindet sich im Jenseits.
Lanz fiel unvermittelt ein, dass er auf einer Reise nach Hamburg auch in Bremerhaven haltgemacht und dort das berühmte »Deutsche Auswandererhaus« besucht hatte. Zuerst hatte er eine hohe Ausstellungshalle betreten, in der die riesige Bordwand des Dampfers »Lahn« im Wasser zu sehen gewesen war. Davor, am nachgebauten Kai, standen im Halbdunkel an die dreißig wartende Männer, Frauen und Kinder in Form lebensgroßer Puppen. Die Männer mit Kappen, Mützen, Hauben oder barhäuptig, die Frauen mit Kopftüchern. An der Kleidung war die Armut der Auswanderer zu erkennen. Lanz hatte den Eindruck gehabt, er befände sich im Jahr 1888, mitten unter den Flüchtlingen »aus allen Regionen Europas«, wie der Katalog vermerkte. Er hatte über einen Lautsprecher die Stimmen der Wartenden, die Geräusche des Hafens gehört und Gepäckstücke – Koffer, Taschen, Kisten – gesehen. Die Besucher des Museums hatten sich unter die Figuren gemischt, so dass alles einen lebendigen Eindruck machte. Er war, wie die Figuren es scheinbar vorhatten, die Gangway hinaufgestiegen und hatte auf die großen Puppen und Menschen unter sich hinuntergeblickt.
Später betrat er die »Galerie der 7 Millionen Auswanderer«, einen langgestreckten Raum im Dämmerlicht, der mit blauen Kästen voller Schubladen, in denen Briefe, Fotografien, Passagierlisten, Erinnerungs- und Fundstücke von namentlich genannten Exilanten aufbewahrt werden, die von 1880 bis zum Jahr 1913 zurückreichen. Er zog einige Laden heraus und erblickte einen Kamm, Schlüssel, eine Schwarzweißfotografie eines Paares mit Kind in einem Garten, einen Aschenbecher, eine Bürste, Ausweise und ausländische Münzen, aber auch eine Bibel und eine kaputte Taschenuhr. Alles kam ihm wie Beweisstücke aus einem Gerichtsverfahren vor, das klären sollte, warum die Betreffenden Europa verlassen hatten.
Im spärlich besetzten Vaporetto dahinfahrend, erinnerte sich Lanz jetzt weiter an das Auswandererschiff und an den schmalen weißen Gang zu den Kajüten. Vor den auf Höhe der Meeresoberfläche liegenden Bullaugen wurden die Wellenbewegungen des Wassers vorgegaukelt, und der Gang schwankte außerdem hin und her. Die kleinen, niederen Kabinen waren vollgestopft mit Stockbetten, Menschenpuppen und Gepäckstücken und nicht weniger mit einem Gemisch aus Angst, Verzweiflung und Hoffnung. Die Auswanderer kamen aus Deutschland, Österreich, Irland, England und den meisten damals existierenden Staaten Europas. Insgesamt zwanzig Millionen, hatte man geschätzt. Sie hatten alles zurückgelassen – sogar ihre geliebten Menschen – und waren lieber ins Ungewisse geflüchtet, als in der Gewissheit des Elends weiterzuleben, das sie zu verschlucken drohte.
Er staunte, im Vaporetto sitzend, darüber, was in ihm vorging und mit welcher Geschwindigkeit sich alles in seinem Kopf abspielte. Das Zwischendeck auf dem Schiff im Auswanderermuseum von Bremerhaven mit den Hunderten gestapelten, verschiedenfarbigen Koffern und Holzkisten der Passagiere tauchte jetzt vor ihm auf, Modelle der Dampfschiffe in gläsernen Vitrinen und zuletzt die vergitterten Zellen auf Ellis Island vor New York, die »Menschenkäfige«, wie er sich damals gesagt hatte. Schließlich folgte – ähnlich wie in Kafkas »Naturtheater in Oklahoma« – ihr Eintritt in die andere Welt, die jedoch nur im Kopf existierte und in der Wirklichkeit zumeist wohl vergebens gesucht wurde.
Das alles fiel ihm ein, während er die nächsten müden Migranten das Vaporetto verlassen sah, und zugleich wurde ihm bewusst, dass er gerade dabei war, in den Tod auszuwandern. Das Vaporetto nahm wieder Fahrt auf, und er bemühte sich, seinen Kopf zu beruhigen, denn es fielen ihm andere Reisen ein, andere Museen, andere Begegnungen, die ihn allesamt verwirrten und womöglich die innere Leere, die er empfand, auflösten, was zur Folge haben konnte, dass er seinen Entschluss, sich das Leben zu nehmen, in Frage stellte.
Die Fahrgäste saßen bewegungslos und stumm auf ihren Sitzen, die meisten blickten hinaus auf die Lagune. Ein jüngerer Mann las einen offenbar umfangreichen Artikel in einer Zeitung, ein Arbeiter in Anorak und Kapuze war eingeschlafen, sein Kopf zur Seite gefallen, und sein Nachbar starrte abwesend vor sich hin. Auch Hausfrauen, übergewichtig und müde, mit Taschen oder Einkaufstrolleys, zwei mit Kinderwagen, in denen Babys schliefen, und verloren wirkende Alte befanden sich unter den Passagieren.
Das Meer war grüngrau, Möwen schwammen auf dem ruhigen Wasser, und nicht weit entfernt erblickte er die Friedhofsinsel San Michele, die er früher oft besucht hatte. Vor der Ziegelmauer, die die Insel umgab, erblickte er die schwarze Bronzeskulptur der »Barca della Morte« im Wasser – ein einfaches Boot, darauf zwei Männerfiguren mit kleinen Köpfen, in Mänteln. Einer von beiden zeigte mit ausgestrecktem Arm auf den Friedhof. Er vermutete, dass sie Vergil und Dante auf ihrer Reise in die Hölle, durch das Fegefeuer und zuletzt in das Paradies darstellten.
Seine Angst vor dem Tod hatte sich, als er erwachsen wurde, allmählich verflüchtigt. Nur wenn er die kleinen Gräber von Kindern sah, erinnerte er sich daran, dass ihm – besonders als Volksschüler und in der Unterstufe des Gymnasiums in Bozen – die Auseinandersetzung mit dem Tod düstere und unheimliche Gedanken beschert hatte. Während seiner Pubertät hatte er sich dann mit dem Selbstmord auseinandergesetzt und ihn später sogar mehrmals und ernsthaft in Betracht gezogen. Natürlich hatte er sich auch mit der Literatur, die dieses Thema behandelt, beschäftigt, mit Goethe, Dostojewski oder Camus. Bald war er sich darüber im Klaren gewesen, dass er sich nicht aus Verzweiflung umbringen würde, sondern in einem Moment der Gleichgültigkeit und Leere. Sosehr ihn die Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber anderen Schicksalen wütend machte, so sehr wünschte er sich, dass bei seinem Sterben alles um ihn das Nebensächlichste ausstrahlte und er Monate später wie ein toter Bergsteiger in einer Gletscherspalte aufgefunden würde, der sich bereits in einen Teil der Landschaft verwandelt hatte.
Vor einiger Zeit, fiel ihm jetzt wieder ein, hatte er auf Wikipedia gelesen, dass die Insel Sant’Ariano in der »Laguna morta« im Nordosten hinter Torcello und Murano bis 1837 als Ossarium, als Schädelstätte »unter freiem Himmel«, wie es hieß, für die Friedhöfe der Umgebung gedient hatte. Eine zwei Meter hohe Mauer umfasste noch immer das Areal von der Größe eines Sportplatzes. Hinter undurchdringlichem Brombeergestrüpp seien dort bis heute die Gebeine Verstorbener »meterhoch aufgetürmt«. Aber er hatte nicht die Absicht, sich neben Tausenden Schädeln und Gebeinen zu erschießen, das kam ihm abgeschmackt vor. Er beabsichtigte nur, einfach zu verschwinden.
Ein großer Bagger mit Saugrohr, der den Lagunenboden vertiefte, lenkte Lanz ab. Rundherum entdeckte er keine Menschen, kein Leben, auch nicht auf dem automatisch arbeitenden Schiff, und am Himmel sah er keine Vögel. Ohne das Dröhnen des Vaporettomotors und des Baggers, fiel ihm ein, würde man sich auf einem Wasserfriedhof wähnen. Er dachte tatsächlich »wähnen«, weil er seine Gedankenspinnereien nur zu gut kannte. Doch sein Gehirn überrumpelte ihn gleich darauf mit dem Einfall, alle Passagiere seien Tote, die auf der Fahrt ins Jenseits unterwegs waren.
Das Vaporetto erreichte die »Gemüseinsel« Sant’Erasmo. Vom Schiff aus betrachtet, ähnelte sie einem flachen landwirtschaftlichen Gebiet mit Bäumen, Sträuchern, Äckern, alles erdfarben und in allen Schattierungen von Grün, das sich im Vorbeifahren in monochrome Monotonie verwandelte. Beim Anblick der Magazingebäude fielen ihm dann abwechselnd Gefängnisse und Hütten ein. So früh am Morgen war alles noch unbelebt, und Sant’Erasmo machte auf ihn den Eindruck, für immer von Menschen verlassen zu sein wie ein unwirkliches Gestade am Meer.
Er war im vergangenen Sommer mit seinem Außenbordmotorboot vom Lido aus zur Insel gefahren und dann bis Sant’Erasmo Chiesa gewandert, vorbei an den verstreuten kleinen Villen mit zum Trocknen aufgehängter Wäsche, den Gewächshäusern unter Biofolien, vorbei an freundlich grüßenden Radfahrern und kleinen Transportwagen mit drei Rädern, den Ape, an Feigenbäumen, Pinien, Ginstersträuchen und großen Gemüseäckern. Er hatte die Ruhe genossen und durch die Abgeschiedenheit ein Gefühl der Sicherheit empfunden. Bäume und Sträucher umgaben die Grundstücke und spendeten Schatten. Mitten in die kurzen idyllischen Abschweifungen hinein war ein Schwarzweißbild in seinem Kopf aufgetaucht wie aus einem Dokumentarfilm: Er hatte die Insel für einen Augenblick entlaubt, zerstört und tatsächlich menschenleer gesehen.
Häufig dachte er an eine atomare Katastrophe, die das Leben zum Stillstand bringen würde und Tod und Zerstörung zur Folge hätte, wie in Fukushima oder Tschernobyl. Er fand die Fahrt mit dem Vaporetto, die er eigentlich liebte, plötzlich nur noch anstrengend. Die Einförmigkeit der gewohnten Eindrücke verstärkte in ihm noch das Wissen, unterwegs in die Zeitlosigkeit zu sein.
An der Station Punta Sabbioni stiegen alle Passagiere aus und verließen die Anlegestelle, nur er blieb zurück und wartete auf das Vaporetto, das nach Torcello fahren würde. Eigentlich hätte er sich hier gleich erschießen können, um dann ins Wasser zu fallen, aber auch das war ihm zu dramatisch. Vor ihm breitete sich weit die Lagune aus, nur in der Ferne erkannte er noch die Umrisse von Sant’Erasmo, aber so klein wie ein Vermerk, der auf einer bunten Ansichtskarte von der Lagune in winziger Handschrift zwischen Himmel und Erde geschrieben war. Hinter ihm ein trostloser Erdhügel und noch weiter dahinter der Badeort Jesolo.
Auf einer Tafel las Lanz, dass das Vaporetto nach Torcello erst in einer Viertelstunde anlegen würde, das bedeutete auch, dass er vielleicht eine Viertelstunde länger am Leben blieb. Vom angrenzenden Betongebäude führten Stiegen zu zwei weiteren Anlegestellen. Die Betonpfähle, auf denen die Stege ruhten, sah Lanz, waren unter der Wasseroberfläche von einer dicken Kruste Muscheln bedeckt.
Ein älteres Ehepaar hatte sich ihm unbemerkt genähert, und als er gerade eine verrostete Eisenkette – ebenfalls mit Muscheln bedeckt – betrachtete, fragte ihn die Frau auf Englisch, was es hier zu sehen gäbe.
Als Lanz »nothing« antwortete, blieben beide ernst und mit einem Ausdruck von Langeweile stehen. Sie seien mit Freunden nach Venedig gefahren, die den ganzen Tag schliefen, sagte die Frau. Sie redete offenbar gern, der Mann hingegen schwieg. Von der Accademia, dem Museum mit Renaissance-Bildern, wolle er »nichts mehr hören«, sagte er schroff, als seine Frau mit Lanz darüber ein Gespräch beginnen wollte. Das Ca’Rezzonico mit dem Blick in das 17. und 18. Jahrhundert sei »terrible«, von all den Museen und Palästen wolle er »nichts mehr wissen«. Er sei mit seiner Frau, bemerkte er herablassend, einmal vom Bahnhof, wo sich ihr Hotel befinde, bis zum Markusplatz gegangen. »Furchtbar.« Auch in Murano, wohin er gestern gefahren sei, sei es »entsetzlich langweilig« gewesen. Lanz hörte ihm schweigend zu, ohne Absicht, sich darauf einzulassen. Als die Frau ihrem Mann gegenüber den Friedhof San Michele erwähnte, blitzte Verachtung in seinem Gesicht auf, und bei ihrer Bemerkung über »das faszinierende Ghetto« schloss er nur noch peinlich berührt die Augen und blies aus vollen Wangen Luft aus. »Wir haben doch einen Henry James, der über Venedig geschrieben hat, und einen Ruskin!«, warf sie ihm vor. »Was hast du?« Der Mann drehte sich zur Seite, spuckte ins Wasser, und das Gespräch erstarb.
Im Vaporetto setzte sich das Paar zwar in dieselbe Reihe wie Lanz, sie redeten jedoch nicht mehr miteinander. Angestrengt blickte er hinaus. Die Lagune war von gelbem Schilf bewachsen, rechter Hand erschienen flache kleine Inseln – auf denen er weder Menschen noch Tiere noch Arbeitsgeräte entdeckte –, die sich weiter bis zum Horizont fortsetzten und den Eindruck vermittelten, dass die sumpfige Landschaft alles verschluckte. Wenn sie anderen Vaporetti begegneten, blendeten ihn auf deren Frontscheiben fließende Spiegelungen von Wasser und Sonne.
Linker Hand erkannte er jetzt den Glockenturm von San Francesco del Deserto. Das Kloster auf der winzigen Insel – eigentlich »mitten im Wasser« gelegen – musste ein seltsamer Ort sein, dachte er. Hier konnte man vielleicht das Leben einer Möwe führen. Rund um das Ufer waren Zypressen gepflanzt, die den Eindruck eines Vogelnestes erweckten. Fast überall in der Lagune gab es grün bewachsene Sandbänke im flachen Wasser, die, vom Schiffsdeck aus gesehen, das Bild einer dreidimensionalen Landkarte erzeugten und im Betrachter das Gefühl hervorriefen, sich in einem riesigen maritimen Landschaftsmodell zu bewegen. Sie kamen an einer kleinen Insel vorbei mit einem ehemals großen, verfallenen Gebäude. Es hatte kein Dach mehr. Anstelle der Fenster sah er eine Serie rechteckiger, schwarzer Löcher: Pflanzen überwucherten die Ziegelruine. Die folgende, noch kleinere Insel wies nur noch das Fragment einer Mauer auf, die nächste nichts als Schutt, Abfall, Gebüsch, ein zerstörtes Ruderboot und die Reste eines bemoosten, hüttenartigen Baus. Gute Orte, um sich zu erschießen, ging es ihm durch den Kopf.
Sie überholten sechs Paddelboote mit Männern und Frauen. Gleich darauf erkannte er den schiefen Glockenturm der Insel Burano, die er am Anfang der Bekanntschaft mit seiner späteren Frau Alma besucht hatte.