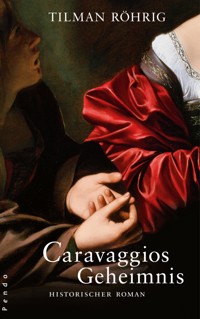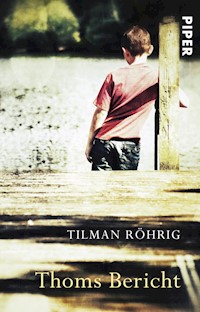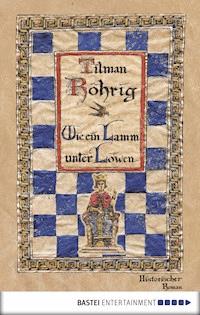
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Staufer-Roman
Im Jahre 1194 wird am zweiten Weihnachtstag auf dem Marktplatz von Jesi ein Kind geboren: Friedrich, der Sohn des Kaisers Heinrich und seiner Frau Konstanze. Wild und ungebändigt wächst der Junge in den Gassen von Palermo auf, regiert später das Kaiserreich und stirbt 1250 nach einem erfülltem Leben - und jahrelanger Auseinandersetzung mit dem Papst.
Im Jahre 1284 verkündet ein würdiger alter Mann mit schneeweißem Haar auf dem Marktplatz von Köln: "Ich bin Friedrich der Staufer. Ich bin nicht, wie ihr glaubt, vor vielen Jahren gestorben, sondern nach einer langen Pilgerfahrt aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, um Frieden zu bringen." Die Zuhörer sind erstaunt, welche Einzelheiten aus dem Leben des Kaisers der Unbekannte kennt. Der Mann kann kein Betrüger sein! Aber wer ist er dann?
Die Gestalt Friedrichs II., den man "das Staunen der Welt" nannte, steht im Zentrum des Mittelalters. In seinem farbenprächtigen Roman schildert Tilman Röhrig das Leben des Herrschers - und dasjenige des Mannes, dessen einzige Aufgabe es war, Friedrich zu dienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1147
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
ERSTES BUCH – Die Geburt zu Jesi
ZWEITES BUCH – Das Kind von Pülle
DRITTES BUCH – Das Staunen der Welt
VIERTES BUCH – Der falsche Kaiser
Personen
Stammtafel
Karte
TILMAN RÖHRIG
Wie einLamm unterLöwen
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© Copyright 1998 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Agentur Spezial, Illsende
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0346-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
ERSTES BUCH
DieGeburtzuJesi
1194-1212
Der Zauberer Merlin öffnete die Faust.Krötenknochen fielen auf die schwarze Steinplatte.Was er von den Gestirnen schon wusste,las er jetzt wieder aus dem verästelten, beinernen Gebilde:»Eine unverhoffte und wundersame Geburt.Unter den Geißen wird das Kind ein Lamm sein.Es wird von ihnen zerrissen,aber niemals verschlungen werden. Dann wird esein wütender Löwe werden. Und zu jener Zeit wird sichdas Meer vom heiligen Blute röten.«
Schaum flog dem Pferd von Maul und Nüstern. Über die Mähne gebeugt, trieb der Knappe den Hengst von Ancona nach Westen. Keine Rast! Ihm, Lupold, war das Geheimnis anvertraut, und von keinem anderen, nur aus seinem Mund sollte der Kaiser die großartige, wunderbare Nachricht erfahren.
Staub wirbelte unter den Hufen, zog als Fahne hinter dem Reiter zwischen Pinien und Ginstersträuchern her, zeichnete seine Wegspur durch ausgedorrte Hügellandschaften. Zum dritten Mal stieg hinter ihm die Augustsonne in den blauleeren italienischen Himmel, verbrannte die Zeit.
Erst am späten Nachmittag erreichte der Kurier das kaiserliche Heerlager. Bunte Wimpel, Wappenstandarten empfingen ihn. Ohne sein Pferd zu zügeln, hetzte Lupold durch die Zeltreihen. Vor dem streng gesicherten Mittelplatz sprang er ab, überließ den Wachen das Halfter und lief zur wabenförmig errichteten, weiß-blauen Zeltburg hinüber.
Gelassen verwehrte der alte Hofmeister dem blond gelockten Edelknappen aus dem Gefolge der Kaiserin den Zutritt. »Seine Majestät ruht.«
Lupold drängte. Jetzt, sofort! Die Botschaft duldete keinen Aufschub. »Beim heiligen Georg, meldet mich!«
»Was ist es?«
Nein. Er hatte Befehl. Die Hand fuhr zum Dolchgriff. Nur vor dem Fürsten selbst durfte er sprechen. »Und wehe Euch, wenn Ihr mich nicht sofort vorlasst.«
Sein respektloser Zorn, seine Entschlossenheit verunsicherten den Alten. Mit einem Seufzer verschwand er im Innern der Zeltburg. Wenig später kehrte er zurück, ließ sich die Waffe aushändigen und führte den Knappen durch den Vorraum. Einen Spaltbreit öffnete er die hängenden Leintücher. »Lupold, Sohn des Albertus von Breisach. Der Bote Ihrer Majestät, der Kaiserin Konstanze!«
Hitze, die Luft lastete. Im grauen Untergewand lehnte Heinrich VI., von Kissen gestützt, auf dem Lager. Zwei Pagen fächelten ihm mit abwechselndem Schwung der Pfauenwedel Kühlung zu.
Reglos wartete Lupold. Zum zweiten Mal stand er vor dem mächtigsten Fürsten der Welt, dem Gemahl seiner Kaiserin. Im Frühjahr, bevor das Heer von Deutschland aufbrach, waren Lupold und sein Ritter vom Herrscher höchstselbst dem Gefolge Konstanzes zugeteilt worden. Wie damals verspürte der Knappe auch heute beim Anblick des Kaisers wieder einen kalten Schauer, trotz des sommerheißen Tages. Eine hagere, schwächliche Gestalt: das Gesicht bleich, ein dünner Bart, strähnig das blassrote Haar; unter der hohen Stirn musterten ihn nackte, helle Augen. Lupold wagte kaum zu atmen.
»Nun, was gibt es?« In dem gelangweilten Ton schwang gefährlicher Spott. »Was hat Uns Unsere so geliebte Gemahlin auszurichten, das du meinem Hofmeister nicht anvertrauen willst? Was ist so wichtig, dass du meine Ruhe störst?«
Nach zwei Schritten beugte der Knappe das Knie. »In aller Ergebenheit …«
Ungehalten wischte Heinrich die Förmlichkeiten beiseite. »Komm zur Sache.«
Lupold schluckte, begann von Neuem: »Die Kaiserin lässt Euch sagen, dass sie ein Kind trägt.«
Schweigen. Nur einen Augenblick. Jäh sprang Heinrich vom Lager hoch. Seine Pagen waren zu langsam; er stieß sie samt den Pfauenwedeln beiseite. In kurzen Schritten stürmte er auf und ab. »Bei deinem Leben, Kerl, wenn du lügst …« Er brach ab, seine Lippen bebten.
Mit allem Mut fuhr Lupold fort: »Ich soll ausrichten, der Leibarzt und die Kaiserin sind sich ganz sicher.«
Heinrich blieb stehen. »Nein, Zwerg, du wagst es nicht. Du sagst die Wahrheit.« Er kehrte zum Lager zurück. Sein Rücken versteifte sich. »Und doch, es kann nur Lüge sein. Diese alte Frau und ein Kind! Niemals.« Der Kaiser schien die Anwesenheit des jungen Kuriers vergessen zu haben. Konstanze, du konntest mich noch nie ertragen. Deshalb quälst du mich jetzt mit dieser Nachricht. Neun Jahre habe ich beim Beischlaf in dein abweisendes Gesicht gestarrt. Kein Laut, nicht ein Seufzer. Glaubst du, mir hat es in deinem welken Fleisch je Lust bereitet?
Von seinem Vater war Heinrich in diese Ehe gezwungen worden. Und nie hätte er gewagt, sich gegen den übermächtigen Barbarossa aufzulehnen. Friedrich I., von Gottes Gnaden immer erhabener Herrscher! Eine Heirat seines zweiten Sohnes mit der Tochter des verstorbenen Königs Roger sollte endlich die Aussöhnung zwischen dem deutschen Kaiserreich und dem normannisch-sizilischen Königshaus bringen. »Allein der Politik habe ich gehorcht«, stöhnte Heinrich. »Jedes junge Weib hätte mir längst einen Sohn geboren.« Mit dem Fuß stieß er gegen die Bettstatt. »Aber du bist zu alt!« Er schnellte herum. »Oder? Sag es mir, Kerl.«
Lupold begriff nichts. Hilflos schwieg er. Unter allen Edelknappen war er von der Kaiserin ausgewählt, zum Lohn für treue Dienste mit dieser ehrenvollen Aufgabe betraut worden. Wie sehr hatte er während des Ritts diesen Moment herbeigesehnt: Freude, Jubel, Lohn für ihn, den Kurier, und am Abend ein Fest.
Das hatte er erwartet.
Sein Zögern schürte das Misstrauen. Heinrich flüsterte: »Was sollst du mir ausrichten?«
Angst würgte den Knappen.
»Wiederhole es, Zwerg!«
»Ihre Majestät Kaiserin Konstanze trägt ein Kind.«
»Nein, nein. Du lügst nicht.« Sein Blick umklammerte den Jungen, beinah sanft setzte er hinzu: »Vielleicht hat sie dir eine Lüge aufgetragen. Und weil du es nicht besser weißt, bringst du sie als Wahrheit zu mir. Doch das schützt dich nicht. Wenn Uns Unsere geliebte Gemahlin nur täuschen will, dann werden Wir dir die Zunge herausreißen.«
Heinrich schloss die Augen. Kurz vor der Eheschließung hatte er Konstanze das erste Mal gesehen. Es gab keine andere heiratsfähige Prinzessin in Sizilien, nur die einzige Tochter König Rogers, und sie war ledig geblieben. Als Nonne, längst von der eigenen Familie vergessen, wurde sie damals mit zweiunddreißig Jahren für diese Verbindung aus dem Kloster gezerrt und dem einundzwanzigjährigen Kaisersohn vermählt. Aller Hochzeitspomp in Mailand, die unermesslich reiche Mitgift, die Krönung des Paares mit der eisernen lombardischen Krone gehörten zum Schachzug Barbarossas. Ohne Widerspruch fügten sich Konstanze und Heinrich. Keine Nähe. Bis auf den Zwang, für einen Erbfolger zu sorgen, mieden sie einander. Das eheliche Lager war in den vergangenen neun Jahren stets mit Ekel, Erduldung und schweißtreibender Pflichterfüllung beladen. Der erhoffte Sohn blieb aus.
Gleichzeitig aber ritt der Tod dem Aufstieg Heinrichs voran. 1189 starb der königliche Bruder Konstanzes, kinderlos. Der Thron des Südreiches schien zum Greifen nah, doch der sizilische Adel widersetzte sich dem gefürchteten Staufersohn und wählte einen Gegenkönig, einen Bastard König Rogers. Heinrich wartete. Vor vier Jahren, im Juni 1190, ertrank Friedrich Barbarossa auf dem Kreuzzug. Viel früher als je erträumt wurde Heinrich zum Kaiser gekrönt. »Ich bin die Macht!« Seine Träume wucherten, versetzten ihn in wilden Rausch; er wollte Herrscher über alle christlichen Königreiche werden. So fasste er Pläne, kalt berechnend, und war bereit, sie mit allem Geschick und unbarmherziger Härte durchzusetzen. Zunächst musste sein Einfluss bis in die Südspitze Italiens ausgedehnt werden. Allein die königliche Verwandtschaft seiner Gemahlin stand noch im Weg. Der erste Feldzug scheiterte kläglich vor Neapel. Heinrich wartete. Da starb im Frühjahr der gewählte König Siziliens, der Bastardbruder Konstanzes.
»Palermo, das Südreich gehört mir, mir allein!« Sofort war der Staufer wieder mit einem großen Heer nach Italien aufgebrochen.
Die verbündeten Truppen in den Häfen von Genua und Pisa warteten nur auf seinen Befehl, die Kriegsschiffe zu besteigen. Und gerade jetzt schickte ihm Konstanze diese Nachricht. Wollte sie ihn damit aufhalten, ihn daran hindern, sich das zu nehmen, was ihm rechtmäßig zustand? »Das wagst du nicht!«, stieß Heinrich durch die Zähne heraus. Ein Sohn? Er gab dem Gedanken nach. Ein Erbfolger würde alle Erfolge mit noch größerem Triumph krönen. Nein, keine unnützen Träume; nur Gewissheit zählte.
»Den Mantel«, befahl er seinen Pagen. »Und du«, er schnippte dem Knappen, »verschwinde! Warte draußen.«
Gebückt verließ Lupold den stickigen Zeltsaal. Kaum hatten sich die Leintücher wieder geschlossen, da wurde seine Schulter gepackt. Er warf den Kopf herum.
»Still.« Der Hofmeister schob das Gesicht näher. »Ist es wahr?«
Wortlos nickte Lupold.
Da strahlte der alte Mann. »Guter Junge.« Er schickte ihn zum Küchenzelt: Wein, Brot und Dörrfisch, der Knappe sollte sich sattessen.
Endlich ausatmen. Müde streckte sich Lupold nach der Mahlzeit. Da hörte er Schritte. Schon standen zwei Wachposten vor ihm. »Komm mit.« Sie rissen ihn hoch. »Auf Befehl Seiner Majestät, du bist verhaftet.«
»Warum?« Lupold wehrte sich, stammelte: »Das dürft ihr nicht. Ich bin Kurier … Ich stehe unter dem Schutz …«
»Halt’s Maul!« Sie schlugen auf ihn ein, fesselten ihm die Hände und warfen den Unglücklichen in ein ausgeschachtetes Loch zwischen den Wachzelten, das sie mit Schilfmatten verschlossen.
Früh am nächsten Morgen brach der kaiserliche Leibarzt Berard nach Ancona auf. Die Abordnung führte der Oberbefehlshaber des Heeres selbst, Markwart von Annweiler, der machthungrige Truchsess, die starke Faust Heinrichs. Vom kleinen Hofbeamten hatte er sich bis zur Spitze der Reichsminister emporgedient.
»Bald, Markwart, werde ich dich in den Stand der Freien erheben. Ich denke daran, dich mit einem Herzogtum und mehr zu beschenken.«
Dieses Versprechen fesselte den stiernackigen Mann noch enger an Heinrich, ließ ihn zum treu ergebenen Bluthund werden. Und wie sein Kaiser war Markwart von tiefem Misstrauen gegen Konstanze erfüllt; er würde sich nicht täuschen lassen.
»Kein Wort! Zu niemandem!«, lautete der strikte Befehl. Heinrich VI. wollte sich nicht dem Gespött seiner Truppe aussetzen. »Erst will ich Gewissheit.«
Mit dem Ergebnis der Untersuchung kehrte die Abordnung nach fünf Tagen zurück.
»Jeder Irrtum ist ausgeschlossen«, berichtete der Medicus. »Ihre Majestät die Kaiserin, ist schwanger. Noch in diesem Jahr wird sie niederkommen.«
Ein erstes Lächeln. Ehe es sich ausbreiten konnte, warnte Markwart von Annweiler: »Mein Fürst, es ist wahr. Ihr Bauch ist angeschwollen, das Pendel kreiste, im Urin färbte sich die Eisennadel. Doch vergesst nicht: Sie ist eine sizilische Normannin und eine alte Frau. Ihr Arzt versteht die geheimen Künste. Vielleicht trügt der Anschein; vielleicht ist ihr Zustand nur eine geschickt vorbereitete Täuschung.«
Heinrich sah von einem zum anderen; langsam schüttelte er den Kopf. »Nein, mein Freund. Nach nichts sehnt sich Unsere geliebte Gemahlin mehr, als mich zukünftig von ihrem Bett fernzuhalten. Ich glaube nicht länger an einen Betrug, und ich befehle dir, über deinen Verdacht zu schweigen. Geh jetzt.«
Zurechtgewiesen, fortgeschickt wie ein Diener! Der Truchsess ertrug die Schmach nicht. »Mein Fürst, die Aussicht auf einen Erben blendet Eure …«
»Wage es nie mehr!« Jähzorn loderte in den Augen.
Sofort senkte der grobschlächtige Heerführer die Schultern; wortlos wandte er sich ab.
Kaum hatte Markwart von Annweiler das Zelt verlassen, kniete Medicus Berard nieder und drückte die Lippen auf den Fuß seines Herrn. »Endlich. Der Allmächtige ist gnädig mit Euch. Das lange, vergebliche Warten hat ein Ende.«
»Aber wie kann es sein?«, flüsterte Heinrich. »Was ist das für ein Kind?« Eine nie gekannte Unruhe erschütterte den sonst so kalten, rücksichtslos klaren Verstand. Noch waren seine Zweifel stärker als die Freude. Er verlangte Antworten – Antworten, die ihm der Arzt nicht geben konnte.
Heinrich rief Joachim von Fiore zu sich. Seit der Zisterzienserabt vor Jahren in Palästina dem Brunnenschacht am Berg Tabor entstiegen war, erfüllte ihn die göttliche Erleuchtung. Wenige Jahre später, zu Pfingsten 1190, hatte sich ihm die Heilige Schrift offenbart.
Seine Arme gekreuzt an die Brust der hellgrauen Kutte gepresst, stand der hagere Abt in der Zeltburg Heinrichs. Die Ungeduld des Kaisers kümmerte ihn nicht. »Als ich an jenem Pfingstmorgen aus dem Schlaf erwachte, nahm ich zur Meditation die Schrift in die Hand. Da durchfuhr plötzlich eine Helligkeit der Erkenntnis die Augen meines Geistes. Ich sah den Lauf der Menschheitsgeschichte klar vor mir.«
»Schweigt davon! Ihr habt es schon erzählt.« Heinrich bemühte sich um Mäßigung. »Erklärt mir nicht die Welt, ehrwürdiger Vater. Antwortet endlich auf meine Frage.«
Die Falten im schmalen, scharfkantigen Gesicht des Abts vertieften sich. »Papst und Kirche haben mein Wort gehört. Es ist längst an der Zeit, dass auch du begreifst. Erst dann wirst du das furchtbare Gewicht meiner Prophezeiung ermessen können.«
Mit einem Seufzer lehnte sich der Kaiser zurück, stützte den Kopf in die Hand. Unbeirrt nahm Joachim von Fiore den Gedanken wieder auf: »Drei Weltordnungen bauen sich aufeinander. Das erste Reich war das Zeitalter des Vaters, der Knechtschaft; es brachte Wasser. Diese Epoche ging mit Christus zu Ende. Das zweite Reich war das Zeitalter des Sohnes, der Gnade; es brachte uns Wein. Auch diese Epoche ist schon zu Ende. Begreifst du, mein Fürst, nur noch wenige Jahre der Vorbereitung bleiben dem sündigen Menschen, ehe das Reich des Ewigen Evangeliums anbricht, der Freunde und Liebe; es wird ewiges Öl bringen.«
»Spart Euch das für Eure Predigt. Ich will es nicht hören.«
»Auch wenn du dich taub und blind stellst, du hältst den Lauf nicht an.«
Heinrich straffte den Rücken: »Wie redet Ihr mit mir? Ich gestalte die Ordnung der Welt.«
»Du kleiner Mensch! Dein Tod ist nahe. Ich sehe dich sterben. Noch wenige Jahre, und bei Messina wirst du diese Welt verlassen. Was nützt dir also deine Macht?« In den tiefen Augenhöhlen entstand ein Glühen. »Das dritte, das tausendjährige Reich des Heiligen Geistes bricht im Jahre 1260 an. So habe ich es aus der Schrift errechnet. Vorher aber wird der Antichrist versuchen, die Menschheit zu blenden. Er wird gezeugt, wie es geschrieben steht, unter Mitwirkung des Teufels und geboren von einer Nonne.«
»Meine Geduld …«
Der Finger des Abts schnellte vor. »Höre die Antwort auf deine Frage! Deine Frau ist von einem Dämon beschlafen worden. Ja, die Nonne ist schwanger.«
Nichts regte sich im bleichen Gesicht Heinrichs. »Sagt mir mehr.«
»Sie trägt einen Sohn.«
Der Kaiser nickte und starrte den Propheten an. »Wenn er mein Thronerbe ist, so will ich gern der Dämon sein.«
Joachim von Fiore war längst wieder gegangen, da saß der Herrscher immer noch unbeweglich in seinem Zelt. Den geweissagten eigenen Tod verbannte er aus seinem Denken. Ein Sohn! »Durch mich und dann durch ihn wird das Geschlecht der Staufer weiterleben.« Alle Ziele erhielten damit ein zweifaches Gewicht.
Der Hofmeister glitt durch den Spalt der Leintücher. Als Heinrich ihn bemerkte, ihn freundlich näher winkte, glaubte der alte Mann an eine milde Regung seines Herrn und bat um die Freilassung des jungen Knappen. »Seit mehr als einem Monat liegt er nun schon in dem Loch. Hitze und Enge werden ihn töten.«
»Hat er nicht Schatten genug? Vier Wände und ein Schilfdach? Täglich Wasser und Nahrung, ohne dafür arbeiten zu müssen? Das ist mehr, als einem Knappen zusteht. Wir gewährten ihm diese Gunst, weil er Uns die frohe Kunde Unserer Gemahlin überbracht hat. Lassen Wir ihn noch eine Weile den Lohn genießen.«
Ohne den sanften Tonfall zu ändern, ordnete der Kaiser eine Lagebesprechung seiner Heerführer für den nächsten Tag an. Die Ruhe in ihm war zurückgekehrt. Kühl überdachte er seinen Plan. Die bevorstehende Geburt des Sohnes hinderte ihn nicht, Sizilien zu unterwerfen; im Gegenteil, sie förderte sein Vorhaben. Als Schwangere musste Konstanze in Ancona zurückbleiben.
»Du bringst mir den Erben und gibst mir gleichzeitig freies Spiel auf meinem Weg nach Palermo. Allein werde ich dem Adel und deinen normannischen Verwandten gegenübertreten.« Er strich das blassrote, strähnige Haar zurück. »Für beides danke ich dir, Konstanze. Mehr, als du ahnst, entschädigst du mich für die Abscheu in deinem Gesicht während unserer ehelichen Nachtstunden.«
Noch einmal ließ Heinrich die versammelten deutschen Herzöge, Barone und Ritter in den Plan des Feldzuges einweisen. Seine Astrologen errechneten Tag und Stunde für das Auslaufen der Flotte. Die verbündeten Pisaner und Genuesen sollten von See her den Hauptangriff auf die wichtigsten Städte des Südreiches führen.
Fanfaren und Trommelwirbel rissen die deutschen Kriegsknechte aus ihrer Untätigkeit. Das zermürbende Warten unter der Glutsonne hatte ein Ende. Zelt für Zelt brachen sie das Heerlager ab, banden Stoffe, Stangen und Essgeschirr auf die Lasttiere. Kuriere jagten von einem Tross zum andern.
Am Tag vor dem Aufbruch rief Heinrich seinen Oberbefehlshaber zu sich. »Wenn ich dich gekränkt habe, verzeih. Ja, dein Misstrauen ehrt dich, zeigt es doch, wie sehr du nur mir und meiner Sache dienst. Um dir mein Vertrauen zu beweisen, darfst du jetzt Zeuge sein.« Im Beisein des Annweilers diktierte der Kaiser seinem Ersten Notar und Geheimschreiber, Magister Gerhard, den Befehl an Konstanze und siegelte ihn mit seinem Ring. »Sie wird sich zieren, Schamröte wird ihr Gesicht verfärben, aber sie muss gehorchen. Damit ersticke ich jedes falsche Gerücht, und sie wird mir und aller Welt den Beweis liefern.«
Breit grinsend kratzte Truchsess Markwart befriedigt den struppigen Bart.
Vier Tischreihen zum Geviert gestellt. Nach Sonnenuntergang war die Tafel draußen auf dem Platz vor der Zeltburg gedeckt. Der gestampfte Boden noch warm vom Tag. Ein lauer Wind. Zikaden schrillten zu Lautenklängen. Im Innern des Tafelvierecks rollte sich der Hofnarr zur Melodie wie eine bunte Kugel zwischen den Musikanten her und hin; mal quiekte er, mal schnaubte er, dann wieder gab er Hundegebell zum Besten.
Heinrich speiste im Kreise seiner engsten Vertrauten. Sklavinnen der Herzöge, Barone und Kleriker oder Huren aus dem Tross waren zu diesem Mahl nicht gebeten worden. Ohnehin verabscheute es Heinrich, mit aufgeputzten Damen bei Tisch zu sitzen; nur wenn es das höfische Protokoll vorschrieb, duldete er ihre Gesellschaft. Heute aber wollte er unter Männern sein.
Nach gespicktem Hasen, scharf gewürztem Gemüse und gefüllten Rebhühnern, ehe der nächste Gang aufgetischt wurde, befahl der Kaiser dem Narren zu schweigen und den Spielleuten, ihre Instrumente beiseitezulegen.
Als aller Augen erwartungsvoll auf ihn gerichtet waren, leckte er die vom Fett triefenden Finger ab und winkte seinem Hofmeister. »Du enttäuschst mich. Ein Gast fehlt bei unserer Feier.«
»Ich bitte um Vergebung« – hastig sah der Alte in die Runde –, »doch alle geladenen Herren sind versammelt.«
»Ich vermisse den Knappen Unserer Gemahlin. Mit einem Trinkspruch wollen Wir ihm für die frohe Nachricht danken. Hat er es gewagt, sich zu entschuldigen?«
»Nein, mein Fürst.« Trotz der Rüge glitt Erleichterung über das Gesicht des Hofmeisters. »Gleich, mein Fürst. Sofort.«
Zwei Knechte stützten Lupold, halb trugen sie ihn zur Tafel. Eine hilflos zitternde Gestalt, das flaumbärtige Gesicht grau von Dreck und Ungeziefer, die grindigen Lippen aufgeplatzt. Heinrich schien den Zustand nicht zu bemerken. Er grüßte den Knappen, als wäre sein Rock nicht kotverschmiert, sondern farbenprächtig, wie das Gewand der übrigen Herren, blau und gelb oder grün und rot. »Endlich, junger Freund. Mit Ungeduld haben Wir dich erwartet.« Sein Fingerschnippen ließ die Vasallen an der Längsseite der Tafel etwas zusammenrücken. Großzügig wies er auf die frei gewordene Ecke, seinem Sitz schräg gegenüber. »Gebt ihm diesen Ehrenplatz.«
Die Knechte setzten den Geschwächten auf einen Schemel. Lupold klammerte sich mit den Händen an der Tischplatte fest, versuchte zu danken, doch nur Krächzen entrang sich seiner Kehle.
»Nein, nein, keine Förmlichkeiten. Entspanne dich, genieße den milden Abend.« Heinrich hob den Becher: »Meine Ritter, trinken wir diesen süßen Malvasier auf den Edelknappen Unserer geliebten Gemahlin. Seine frohe Kunde hat Uns Glück beschert.«
Zurufe. Sie ließen den Ehrengast hochleben. Doch keiner trank, sie warteten. Nur gemeinsam mit dem so laut Gepriesenen durften sie die Becher leeren. Unbemerkt war der Narr unter den Tisch gekrochen, jetzt tauchte er dicht neben dem Schemel auf. Er schnüffelte gierig an dem stinkenden Kittel hoch bis zu Lupolds Gesicht, jaulte; schnell streifte er seine Leibhose hinunter, strich und rieb das Glied zur Freude der Gesellschaft lang; hechelnd drehte er sich um, rückte den Hintern nah ans Gesicht des Knappen und hob das Bein.
Lupold bemerkte nichts. Aus verquollenen Lidern starrte er auf den gefüllten Becher. Immer wieder versuchte er danach zu greifen, doch kaum löste er die Hand von der Tischplatte, drohte er das Gleichgewicht zu verlieren. Der Hofmeister sah die Not; entschlossen trat er hinter ihn und stieß den Narrenhintern beiseite. Mit festem Griff packte er den Haarschopf; behutsam führte er das Tongefäß an die wunden Lippen.
»Er soll hochleben!«
Der erste Schluck gelang Lupold, der zweite aber nahm den Atem. Er hustete, würgte.
»Trink, Junge«, raunte ihm der Alte zu. »Du musst trinken.«
Lupold rang nach Luft. Barmherzig schüttete ihm der Hofmeister den Wein übers Kinn, setzte den geleerten Becher hart und zugleich mit den anderen Herren zurück.
Voll kaiserlicher Milde wandte sich Heinrich wieder an den Knappen: »Morgen wirst du mit einem versiegelten Schreiben an Unsere geliebte Gemahlin nach Ancona zurückkehren. Nur aus deiner Hand soll sie Unsere Botschaft entgegennehmen. Und als großzügiges Zeichen Unserer Dankbarkeit darfst du die Reise auf einem Karren in Begleitung zweier Eseltreiber genießen.«
Heinrich lachte; der Narr jauchzte, und pflichtschuldig fiel die Tischgesellschaft mit ein.
Ich bin frei. Lupold begriff. Dieser Gedanke nistete sich ein. Von fern, wie vom Ende einer Steinwüste her, hörte er das Gelächter, dann sank er zu Boden.
Sofort war der Hofmeister zur Stelle. »Verzeiht, mein Fürst, seine Jugend. Der Genuss des schweren Weins ist ungewohnt.«
Nur ein kurzer Handschlenker. »Schaffe ihn weg. Sorge dafür, dass er zu Kräften kommt.«
Der dritte Gang wurde aufgetischt: sauer eingelegter Fisch, dazu Wachteln in Schmalz gebacken. Die Krüge kreisten. Als der Mond stieg, wurden lodernde Stockfackeln rund um die Tafel gesteckt.
»Edle Herren, meine tapferen Vasallen.« Zungenschwer verlangte der Kaiser nach Aufmerksamkeit. »Morgen brechen wir auf und werden nicht rasten, bis wir unser Ziel erreicht haben. Doch ehe wir diese Tafelrunde verlassen« – der Ton verlor alle gewohnte Härte, ein wässriger Glanz schimmerte in den Augen –, »dienen wir der höchsten Tugend eines deutschen Ritters.«
Die versammelten Barone, Herzöge und Kleriker nickten; jeder ahnte, was nun folgte. Selbst der Narr wagte keinen Scherz mehr.
Von einem der Spielleute ließ sich Heinrich die Mandora reichen. Er stand auf; versonnen zupfte er an den Saiten. »Mein Lied soll Eure Herzen erfreuen. Ich habe es für mich und für Euch gedichtet.«
Er hob die Stimme, sprach mehr, als er sang:
»Ich grüß’ mit Gesang die Schöne,die ich nicht missen will und kann.Seit ich ihr selber brachte meine Grüße,verrann, o Leid, so mancher Tag.Wer immer dies Lied nun singt vor ihr,die ich so unsagbar entbehr’,sei es Mann oder Weib, der bringt ihr Grüße von mir.«
Becher wurden in den schweren Fäusten gedreht. Gedanken verloren sich in der lauen Nacht.
Geruch nach salziger Gischt wurde mit der Brise an Land getragen. Pfiffe, Johlen der Gassenjungen weit vorn auf den Felsen der See-Einfahrt von Ancona. Winken ins Innere des Hafenbeckens zu den dicht an dicht geschachtelten Hütten hinüber. Wenig später standen Frauen an der Ufermauer, schirmten die Augen mit der Hand. Jede suchte weiter draußen auf dem Meer und fand das eine unter den vielen Segeln. Große geflochtene Körbe standen bereit. Die Fischer kehrten vom Fang zurück; tief lagen die Boote im Wasser.
Schwach drang der Lärm vom Hafen durchs offene Fenster in den kühlen Saal des Stadtpalastes. Kaiserin Konstanze hielt das Schreiben ihres Gemahls in der Hand. Noch hatte sie das Siegel nicht erbrochen. Auf einen Wink hin entfernte sich der Ratgeber und engste Vertraute, Baron Hermann von Baden, einige Schritte.
Ihre erste Sorge galt dem Überbringer der Botschaft. »Was hat man dir angetan?«
»Nichts, Herrin. Die Reise war beschwerlich.« Lupold versuchte ein zaghaftes Lächeln. Der grindige Schorf auf seinen Lippen platzte auf, und er schmeckte Blut. Gleichgültig. Nein, keine Schwäche, nicht vor ihr.
»Meine Augen täuschen mich nicht. Berichte.«
Einen Moment hielt Lupold dem teilnahmsvollen Blick stand. Wie voll das lange, sorgfältig gescheitelte Haar bis weit über die Schultern fiel; helle Strähnen durchwirkten das Schwarz wie Silberfäden. Er senkte den Kopf. Wie die anderen drei Edelknappen des Gefolges schwärmte auch Lupold heimlich von der Kaiserin. Sie beherrschte zwar das Deutsche, sprach es aber in der weichen Melodie des Französischen. So weit entfernt von zu Hause linderte ihr Anblick, ihr mütterliches Wesen bei Tag das Heimweh der jungen Männer, und jeder suchte mit einem oft nur vorgeschobenen Grund, den Palast zu betreten. Auch wenn er die Herrin nicht sah, so bedeutete in ihrer Nähe zu sein schon ein kleines Glück. Bei Nacht auf dem Stroh in der gemeinsamen Stallunterkunft wuchs die Sehnsucht der Knappen nach Lust und Zärtlichkeit. Nicht miteinander; sie stillten die heißen Träume an sich selbst, und jeder ließ den Nachbarn gewähren. Auch Lupold gab sich der einsamen Lust hin. Sie, die Unerreichbare, wurde zur Geliebten. Ihre schweren Brüste neigten sich über seine Lippen. Ihre weichen Schenkel schlossen ihn ein. Während seiner qualvollen Haft in der Enge des Erdlochs hatte sich Lupold nur ihr Gesicht herbeigedacht, es in seinen Gedanken ausgemalt, sich nach dem Blick ihrer dunklen Augen gesehnt. Ein Lichtschimmer, wenn die Verzweiflung ihn ganz zu besiegen drohte. Jetzt war er zurück, auferstanden aus dem nach Kot und Urin stinkenden Loch. Jetzt atmete er frei, und er wollte nicht vor seiner Kaiserin klagen wie ein Junge.
»Ich warte.« Konstanze schmunzelte, sie lockte ihn: »Habe ich mich in dir geirrt? Ich hoffte, du wärst nicht solch ein abgestumpfter Deutscher, der selbst den größten Schmerz leugnet. Ja, ich glaubte, du wärst nicht so wie die meisten Herren meines Gefolges. Deshalb nur gab ich dir den Auftrag. Enttäusche mich nicht. Was hat man dir angetan?«
Das sanfte Drängen brach den Widerstand. So beiläufig, wie es ihm möglich war, berichtete Lupold von den vergangenen Wochen im Heerlager; dabei starrte er unverwandt auf die Spitzen seiner zerschlissenen Lederstiefel.
Kaiserin Konstanze schlug das versiegelte Schreiben auf die Lehne des Sessels. »Das also meinte dieser Grobian Markwart von Annweiler, als er mit dem Medicus hier war, um sich von meiner Schwangerschaft zu überzeugen. Ich fragte ihn nach dir, weil mich dein unerlaubtes Fortbleiben verwunderte. ›Euer Knappe genießt das Lagerleben in vollen Zügen.‹ Dabei lachte er. ›Eine gute Vorbereitung, wenn er demnächst in den Ritterstand erhoben wird.‹ Ich glaubte ihm und bereue es heute.«
Sie befahl: »Geh zum Bader, er soll dich mit Salben und Tinkturen behandeln. Ich befreie dich von allen Pflichten, bis du wieder wie ein Mensch aussiehst.«
»In aller Ergebenheit, Herrin, aber ich werde auch ohne …«
»Das ist ein Befehl, Lupold von Breisach!«
Die Kaiserin wartete, bis der Knappe den Saal verlassen hatte. Kopfschüttelnd sah sie ihm nach. »Wir hätten besser einen Unserer Beichtväter in die Höhle dieses staufischen Raubtieres schicken sollen und nicht einen unschuldigen Knaben.«
Baron Hermann versuchte zu vermitteln: »Der Kerker hat ihn nicht zerbrochen. Und, meine Fürstin, ich versichere Euch, nicht alle Deutschen sind Barbaren, wie es das Gerücht in Apulien und auf der Insel Sizilien verbreitet; nicht allen von uns ist der Mordsinn angeboren. Raubsucht und Zügellosigkeit gehören nicht zu den Haupteigenschaften meines Volkes.«
»Zu wenige haben mich bisher eines Besseren belehrt.« Konstanze presste mit den Fingern die Schläfen. »Ach, mon cher ami, wären alle so wie Ihr und einige, die hier um mich sind. Mich würden keine Angstträume quälen, sooft ich an Sizilien, an die Zukunft meiner Verwandten in Palermo denke.« Sie reichte dem Baron das Schreiben. »Lest Ihr, und tragt mir den Willen meines kaiserlichen Gemahls mit Euren Worten vor. Ganz gleich was es ist, aus Eurem Mund klingt es freundlicher.«
Hermann von Baden erbrach das Siegel. »Wie stets entbietet Heinrich Euch seinen höflichen Gruß. Er wünscht Euch Gesundheit und ein kräftiges Gedeihen des ungeborenen Sohnes. Er verlangt …« Dem besonnenen Mann zitterte die Hand, seine Stimme versagte; stumm las er weiter, studierte die Zeilen. Alle Farbe war aus dem schmalen Gesicht gewichen. »Ich … Nein, meine Fürstin, dieser Befehl beschämt selbst mich. Er lässt sich nicht mit schönen Worten mildern. Wappnet Euch, und lest selbst.«
Zögernd nahm Konstanze das Schreiben zurück. Als sie geendet hatte, erhob sie sich; Tränen standen in ihren Augen. »Das darf er nicht verlangen! So sagt es doch, Hermann. Keine Mutter, auch nicht die geringste Magd, darf so erniedrigt werden.«
»Es ist der unwiderrufliche Befehl des Kaisers. Bedenkt, Euer Gemahl hat heimlich Vorsorge getroffen. Gewisse Herren Eures Gefolges, selbst einige Mönche unterrichten ihn von jedem Eurer Schritte. Auch wenn mir das Herz vor Zorn zerspringt, Ihr werdet Euch fügen müssen.«
Schwer fiel Konstanze der Weg zum Fenster. Sie atmete den Geruch des Hafens. »Was sagtet Ihr gerade noch über die Deutschen? Das Bild sei falsch? Ich stimme Euch zu. Ihr habt die Eigenschaften ›unwürdig‹ und ›entehrend‹ vergessen.« Sie legte ihre Hände über den vorgewölbten Leib. »Mein Sohn, wie soll ich dich nur beschützen vor diesem Vater?« Und nach einer Weile setzte sie bitter hinzu: »Der deutsche Winter erfriert die Sonne. Das, Heinrich, nur das fühlte ich jede Nacht, in der ich dich ertragen musste.«
Aus dem Tafelbuch der Zeit
SIZILIEN
Blutgierige Riesen
Kaum Widerstand, kaum Gegenwehr. Mithilfe der Flotten von Genua und Pisa fallen Heinrich VI. die Städte des Südreiches beinahe kampflos in die Hand.
Markwart von Annweiler, stolzgebläht, zieht an der Spitze des Heeres. Sein Kaiser misstraut dem Jubel in den Straßen. Er weiß: Nicht aus Hingabe unterwerfen sich ihm die Menschen. Eine Schwäche, eine Nachgiebigkeit, und sie werden den Dolch gegen ihn ziehen. Nur ständige Furcht schützt vor Rebellion.
Doch Markwart ist kein Narr; der Truchsess hat seinen Herrn sehr wohl verstanden.
Salerno geht in Flammen auf. Furchtbar ist die Qual der Bürger. In den folgenden Wochen lässt Markwart auf dem Eroberungszug durch das Festland des Südreiches immer wieder einige der apulischen Dörfer verwüsten, die Männer und das Vieh verstümmeln. An jungen Frauen und Mädchen stillen die Kriegsknechte ihre Wollust, ehe sie ihnen die Kehle durchschneiden. Schreckensmeldungen eilen den deutschen Rittern zur Insel voraus; das Gerücht lässt sie zu blutgierigen Riesen auf schwerfüßigen, mit Kettendecken gesattelten Ungeheuern werden.
Kampf um Palermo
Nach dem Tod König Tankreds im Frühjahr 1194 liegt Sizilien jetzt im Herbst schutzlos da.
Königin Sibylle, die Mutter des siebenjährigen Thronfolgers, versucht den Angreifern die Stirn zu bieten. Sie ist zu schwach. Nur ein zwar im politischen Schachspiel meisterlicher, doch im Kampf unerfahrener Kanzler steht ihr zur Seite.
Heinrich VI. betritt leichten Schrittes den kostbaren, von Normannen, Sarazenen, Juden und Griechen gemeinsam durch Jahrzehnte hindurch bunt gewebten Teppich. Er befleckt ihn mit Blut. Schnell ist der Kampf um Palermo entschieden, und über den Mauerzinnen weht die weiße Fahne.
Nahe des Osttores hält der siegreiche Eroberer einen Hoftag ab.
Eskortiert von zwei Bannerträgern ritt der kaiserliche Ausrufer in die Stadt. Bei seinem Anblick huschten die Kinder davon; versteckt hinter Mauern oder im Hausschatten begleiteten sie den Fremden. Vor dem Palast der normannischen Könige stieß er ins Horn. »Bürger Palermos, Edle und Herren!« Lang war die Litanei aller Titel und Kronen, die Kaiser Heinrich VI. auf seinem Haupt vereinte. »Wer die Gnade des mächtigsten Herrschers der christlichen Welt erlangen will, darf sich ihm zu Füßen werfen.«
In Kutschen oder zu Pferd eilten Mitte November 1194 die Würdenträger des geistlichen und weltlichen Adels, die Oberhäupter der einflussreichsten Familien Palermos hinaus ins Heerlager.
»Sind alle gekommen?«
Der Hofmeister überreichte Heinrich die Liste. »Ohne Ausnahme, mein Fürst. Auch Madame Sibylle, die Witwe des verstorbenen Königs. Sie bringt Euch ihre kleinen Töchter und den jungen Erbfolger Wilhelm II., den Neffen Eurer Gemahlin. Soll die Audienz beginnen?«
»Warte noch.«
Der Kaiser studierte die Namen. »Normannen, in den Palästen, in den Kirchen, wie Schlinggewächs durchwuchern sie das Staatsgebilde.« Eine steile Falte furchte die Stirn. Mit der sizilischen Krone erstreckte sich sein Imperium vom hohen Norden bis zur südlichsten Spitze am Mittelmeer. An Machtfülle würde er den ungeliebten Vater Barbarossa übertreffen. Normannen? Für sie gab es keinen Platz in seinem Reich. Nach einer Weile flüsterte er: »Konstanze, meine Liebe, ich höre dich seufzen. Allein, nur mit einem scharfen Messer wird es dem Gärtner gelingen, dieses Paradies vom Wildwuchs zu säubern.«
Sein Entschluss stand fest. Ehe er sich den Vornehmen der Stadt zeigte, befahl er Markwart von Annweiler und seinen Ersten Notar, Magister Gerhard, zu sich. Dem Hofmeister drohte er lächelnd: »Und dir verbiete ich zu lauschen. Nein, ich kenne deine Schwäche; besser, ich lasse dir heißes Wachs in die Ohren gießen.«
Die Vorstellung entsetzte den Alten. »Das wäre der Mühe zu viel, allergnädigster Herr. Bei allen Heiligen, ich entferne mich.«
Während der kurzen Besprechung erhielten Truchsess und Geheimschreiber genaue Anweisung. In seinen Plan weihte Heinrich sie nicht ein.
Der Heerführer verschränkte die Arme. »Mein Fürst, habt Ihr kein Vertrauen?«
»Geduld! Wie oft hast du mich schon auf die Falkenjagd begleitet? Ein vorschnelles Wort verschreckt das Wild. Ich aber will die ganze Beute. Also gedulde dich!«
Draußen nahm der Kaiser unter dem girlandenumrankten Baldachin Platz. Markwart von Annweiler stand breitbeinig neben dem Thronsessel; der Erste Notar hockte in seinem Schatten.
Mit ausgebreiteten Armen begrüßte Heinrich VI. die versammelten Patrizier, Barone und Prälaten, nahm huldvoll ihre Demutsbezeugung an. Jeden, der vor dem hohen Stuhl niederkniete, befragte Markwart nach seiner Stellung und Herkunft; war es ein Normanne, ein Verwandter oder auch nur Freund des sizilischen Königshauses, so erhielt Magister Gerhard einen Wink.
Viel Zeit gewährte Heinrich der Königswitwe Sibylle. »Bringt einen Stuhl, einen Schirm gegen das Sonnenlicht.« Mit keinem Wort erniedrigte er sie; rasch zerstreute er alle Befürchtungen. »Madame, Wir kommen nicht als Sieger in Euer Land, das auch das Unsere ist. Wir wollen nicht vertreiben, sondern erwarten nur, dass Ihr Euren unmündigen Sohn bittet, auf die Krone zu verzichten, die Uns und Unserer Gemahlin Konstanze rechtmäßig zusteht.«
Sibylle war bereit, alle Macht in seine Hände zu übergeben. »Doch lasst meinem Wilhelm die ererbte Grafschaft in Apulien.«
Eine Forderung? Nackt und kalt wurde der Blick. Schon beim nächsten Lidschlag kehrte die Milde zurück, die das Vertrauen aller gewinnen wollte. In väterlicher Güte betrachtete der Kaiser den Siebenjährigen. Aufrecht stand er beschützend vor seinen drei blondlockigen Schwestern. »Ich soll dir Grüße von deiner Tante ausrichten.«
»Meinen Dank«, antwortete der Kleine mit heller Stimme. Seine galante, sichere Art verblüffte die Umstehenden. »Ich hoffe, die Kaiserin befindet sich bei guter Gesundheit.«
»Danke der Fürsorge«, nickte Heinrich. »Es geht ihr den Umständen gemäß«, und versprach der Königswitwe: »Sorgt Euch nicht um die Zukunft, Madame. Euer Sohn soll seine Grafschaft behalten, und obendrein werden Wir ihm noch ein Fürstentum schenken.«
»Willkommen!«, riefen die Vornehmen Palermos und priesen den gnädigen Herrscher. Sie erbaten sich noch einige Tage der Vorbereitung, um den Stauferkaiser festlich empfangen zu können, und kehrten hoffnungsvoll in die Stadt zurück.
Den Mantel eng um die schmächtigen Schultern geschlungen, saß Heinrich gleich nach der Audienz mit Markwart von Annweiler und dem Ersten Notar zusammen. Er diktierte vier kurze Briefe; jeder musste in einer anderen Handschrift abgefasst werden. Der Inhalt ließ keinen Zweifel. Sorgfältig wählte Heinrich einige Personen aus der angefertigten Liste. »Das erste Schreiben richtest du an diesen normannischen Baron und unterschreibst es mit dem Namen seines sizilischen Schwagers.« So fuhr er fort, ließ die Briefe mit adeligen Empfängern und Absendern versehen.
Jetzt erst durchschaute der Truchsess den Plan seines Kaisers. »Wann soll die Jagd beginnen?«
»Geduld! Den Zeitpunkt teile ich dir mit. Bis dahin wird jeder von euch zwei dieser Briefe bei Tag und Nacht unter dem Rock tragen.« Die Leichtigkeit der Stimme ließ Magister Gerhard das Blut gefrieren, und selbst Markwart erbleichte. »Hütet sie wie euren Augapfel! Wenn man sie bei euch findet, geratet ihr selbst in den Sog, und nichts wird euch retten können. Ich weiß, dies ist eine unnötige Warnung, denn ich bin fest von eurer Treue und Verschwiegenheit überzeugt.« Damit überreichte er ihnen die Schreiben.
Am 20. November war Palermo geschmückt: Teppiche hingen aus den Fenstern. Lampions und Girlanden schaukelten, die Straßen waren mit Palmenzweigen übersät, Wohlgerüche stiegen auf. An den Seitenrändern drängte sich das Volk. Die Vornehmen zogen mit ihren Söhnen dem Herrscher entgegen.
Sarazenische Trommler und Schalmeibläser empfingen die Sieger und tänzelten dem eisenstarrenden Trupp voran. Fahnen flatterten; auf ihrem gelben Grund prangten schwarz die drei staufischen Löwen; Wappenschilde wippten an den Schulterplatten; matt blinkten die Kettenhemden der deutschen Ritter und Kriegsknechte unter den farbenprächtigen Umhängen; Wimpel zierten die Lanzenspitzen.
Hoch zu Ross: Heinrich VI.! Sein bleiches Gesicht zu einer Maske erstarrt, die edelsteinfunkelnde, achteckige Krone auf dem Haupt, der Mantel fiel in schweren Falten bis über den Sattel; so ritt er durch Palermo. Bei seinem Anblick sanken die Bürger furchtsam nieder, huldigten mit erstickter Stimme dem Eroberer Siziliens.
Zäh verstrichen die Tage in Ancona, Tage des Wartens auf die bevorstehende Niederkunft der Kaiserin. Nicht allein für Dienerschaft und Waffenknechte war der Aufenthalt an diesem kriegsfernen Ort längst zur Qual geworden. Von den zehn Rittern waren nur vier mit Titel und Amt bekleidet, waren abgesichert durch riesige Ländereien in der Heimat; ihnen standen ausreichende Geldmittel zur Verfügung. Jeder der kleinen Ritter aber rüttelte bekümmert den abgemagerten Beutel, seufzte und fluchte. Aus verdammter Lehnspflicht war er mitgezogen. Warum hatte gerade ihn das Los getroffen, zum Tross der Fürstin zu gehören? Erst nach Beendigung der Heerfahrt würde er aus der kaiserlichen Kasse einen Anteil erhalten. Wenn er Glück hatte, dann deckte die Summe gerade einmal den eigenen finanziellen Aufwand für Rüstung, Pferde, Soldknechte und Knappen. Bei jeder Erfolgsnachricht vom Feldzug in den Süden wuchs der Neid. Nur wer mit der kämpfenden Truppe zog, wer nach der Eroberung die Stadt plündern durfte und heimlich Beute beiseiteschaffte, nur der kehrte wirklich mit Reichtum in die Heimat zurück. Das tatenlose Zusehen hier in Ancona leerte den Beutel, schürte die Unzufriedenheit.
Nach oben hin wagte keiner der armen Ritter eine laute Beschwerde. Ihren Zorn entluden sie über die Dienerschaft. Ohrfeigen, Fußtritte und wahllose Schinderei nahmen zu. Obwohl ihre Rüstungen glänzten, ließen die Edlen täglich Schwert, Helm und Brustplatten putzen und blank reiben. Und wehe dem Knecht, wenn der Herr einen verbogenen oder rostigen Eisenring am Kettenhemd entdeckte!
Auch die vier Edelknappen hatten unter der wachsenden Ungeduld ihrer Barone zu leiden. Vor allem Lupold; er wusste kaum noch ein und aus. Nach seiner Genesung hatte er Morgen für Morgen die erschlafften Muskeln durch Steinstoßen, Laufen und Schwimmen gestählt, hatte mit Lanze und Keule in den Fäusten das Pferd allein mittels Schenkeldruck geführt, aus scharfem Galopp gewendet, vorwärtsgejagt, erneut hart gewendet, und schließlich hatte er den Dienst wieder angetreten. Er fühlte sich kräftig wie zuvor, verrichtete die Arbeiten gewissenhaft, doch nichts genügte; schlimmer noch, sein Herr traktierte ihn obendrein mit Wut und Verachtung. »Salben! Tinkturen! Erst bleibst du einen Monat fort, dann lässt du dich wochenlang wie ein Weib bepinseln und beschmieren. Und warum? Weil der feine Knabe ein paar Tage eingesperrt war.« Nach jeder Schelte griff er zum Stock. »Abhärten werde ich dich! Dreh dich um. Sonst zerschlage ich dir das Gesicht.«
Stumm ertrug Lupold die Hiebe, ließ den Wortschwall über sich ergehen.
»Ein Ritter soll aus dir werden und keine Memme, das habe ich deinem Vater aus Freundschaft versprochen. Jeden anderen faulen Knecht hätte ich längst davongejagt.«
Zerstreuung suchten die Vornehmen beim Schach und beim Würfelspiel; manchmal ritten sie mit der Hundemeute zur Jagd. Im Schutz der Dunkelheit streiften Liebeshungrige durch die engen Hafengassen: Ritter, Soldknechte, auch Mönche waren unterwegs, maskiert oder vermummt. Schon ein Silberstück öffnete die Hinterzimmer der Tavernen und Spelunken. Gut verdienten die stadtbekannten Huren, allein aber konnten sie den Durst nach lüsterner Abwechslung nicht stillen. An mehr und mehr Fischerhütten flackerten nachts schwache Öllichter; hinter den Türen boten Mütter, unterstützt von halbwüchsigen Töchtern, den zahlungskräftigen Gästen ihre Brüste und Schenkel feil. Und oft genug schleppte ein Knappe spät in der Nacht seinen von Wein und Lust entkräfteten Herrn zurück in die Unterkunft des Palazzos.
Die Nachricht von der bedingungslosen Unterwerfung Siziliens erreichte Ancona in den ersten Dezembertagen. Seitdem erschien Kaiserin Konstanze nicht mehr bei dem gemeinsamen Mahl; betreut von der Hebamme, blieb sie in der Obhut ihrer Dienerschaft. Zwei Wochen schon hatte sie die Gemächer nicht mehr verlassen.
»Unsere Fürstin entbietet Ihren Gruß und lässt sich entschuldigen.« Wie an den Abenden zuvor sah Hermann von Baden auch heute in die gespannten Gesichter. Betont heiter gab er Antwort auf die stumme Frage: »Geduld, meine Herren. Auf Anraten des Leibarztes ruht die Fürstin. Noch ist ihr Zustand unverändert.« Es bedurfte keiner geschickten Ausrede; die Schwangerschaft war Grund genug. Nur er wusste von der Verzweiflung, den Tränen Konstanzes, seit Palermo in der Hand des Stauferkaisers war. Schwer trug sie an ihrem Kind.
Ehe er sich setzte, blickte Hermann von Baden zu den Tischen im niederen Bereich des Saales, kurz verharrte er bei einem der Mönche, suchte einen zweiten und dritten, dann kehrte er zur erhöhten, herrschaftlichen Tafel zurück; auch hier blieb sein Blick kurz bei einem der Barone und dessen Tischnachbarn, dem spitzgesichtigen Prälaten Winfried von Heilbronn. Dies war der Kreis der Spitzel. Zwar sprach er zu allen Anwesenden, meinte aber diese heimlichen Zuträger Heinrichs VI. »Das große Ereignis steht unmittelbar bevor. Vielleicht in der nächsten, sicher jedoch in der darauffolgenden Woche. Und ich darf Euch versichern, nichts wird ohne Euer Wissen geschehen.«
Ausgiebig tafelte die Gesellschaft. Jeder Herr wurde vom eigenen Knecht oder Edelknappen bedient. Mit geübtem Auge wählte Lupold das zarteste Stück des Spanferkels; ehe es einer der anderen Diener entdeckt hatte, stach er das Messer hinein und reservierte es seinem Ritter. Geschickt löste er die Lende heraus; auf der mit flachem Brot ausgelegten Zinkscheibe zerschnitt er das duftende Fleisch in mundgerechte Happen. Keiner der Edelknappen übertraf Lupold beim Aufwarten, stets sorgte er für die fettesten Keulen, die knusprigsten Flügelstücke, wählte den besten Fisch, sehr zum Ärger der übrigen Herren.
Der Wein schmeckte. Als die letzten Knochen abgenagt unter den Tisch fielen, die Stimmen lauter wurden, rief einer der Edlen: »Ein Kampfspiel! Wir wollen unsere vier Knappen morgen gegeneinander kämpfen lassen.« Der Vorschlag wurde begierig aufgenommen. Zustimmend nickte auch der Prälat. Eine Abwechslung und gleichzeitig eine gute ritterliche Übung. Nicht zu Pferd mit Lanzen, die wertvollen Tiere mussten geschont werden. Kein Turnier. Zweikämpfe zu Fuß, dennoch in Harnisch und Helm. Schnell waren die Regeln abgesprochen. Dem Baron des siegreichen Knappen zahlten die anderen eine Prämie; außerdem durften bei jedem Kampf zusätzliche Wetten abgeschlossen werden.
Prälat Winfried hob den Finger. »Nur eine Bitte! Nur eine Bitte!« Er wiederholte es, bis die Tafelrunde ihm zuhörte. Jetzt beugte er sich leicht zu Hermann von Baden: »Vielleicht gewährt uns die Fürstin eine Gunst und schaut dem Kampfspiel zu. So lange haben wir ihren Anblick entbehren müssen. Verwendet Euch doch für uns; ihre Anwesenheit würde das Spiel mit Glanz schmücken.«
Beifällig stießen die Barone ihre Becher auf die Tischplatte. Für den Vertrauten der Kaiserin gab es keine glaubwürdige Ausrede, das Begehren abzuschlagen. Er willigte ein.
Im Schlafraum der vornehmen Ritter entkleidete Lupold seinen Herrn, bereitete das Lager, glättete den Leinensack. Ehe er entlassen wurde, packte der Baron das braun gelockte Haar und zog den Knappen dicht an sich heran. »Wenn du mir morgen Schande bereitest! Wenn ich auch nur ein Silberstück verliere! Dann …«
»Sorgt Euch nicht, Herr«, versicherte Lupold. Er blickte zu den drei Freunden hinüber. Sie waren noch mit dem Auskleiden ihrer Ritter beschäftigt. An Kraft und Geschicklichkeit mit Keule oder Stock war er stets jedem überlegen gewesen. »Ich werde gewinnen.«
Auf dem freien Feld vor der Stadtmauer war bei Tagesanbruch die kleine überdachte Holztribüne errichtet worden. Ein breiter Lehnstuhl wurde gebracht, Zofen polsterten ihn mit Kissen aus. Die Fürstin Konstanze hatte ihren Besuch angesagt.
Zu Füßen der Empore reihten sich Hocker für die Vornehmen; mehr Aufwand wurde nicht betrieben. Keine Erregung herrschte wie sonst vor einem großen Turnier. Durchs Los bestimmten die adeligen Herren die Reihenfolge der Zweikämpfe. Sie wählten einen der gewöhnlichen Ritter zum Schiedsmann und Ausrufer; ihm händigten sie die Preissumme aus. Wetten wurden verabredet. Keine Rüstung, kein Pferd würden sie verlieren, doch hier im eintönigen Lagerleben verursachten selbst bescheidene Einsätze schon ein Prickeln unter der Haut. Schwatzend und lachend lagerten Mägde, Stallknechte, Mönche und Bürger Anconas rund um den Kampfplatz. Ein klarer Morgen; frisch wehte der Wind von See her.
In den vier Zelten, der Tribüne gegenüber, halfen Knechte den Kämpfern bei den letzten Handgriffen. Lupold betastete an seinem Hals die Verschlusshaken des knielangen Kettenhemdes. »Was ist mit den Lederriemen?« Gewissenhaft überprüfte sein Helfer die Schlaufen der Schuhe, die Gurte der Metallschienen an den Unterarmen. Lupold streifte sich die mit Eisenringen besetzte Stoffhaube über und schnürte sie unter dem Kinn. Eng saß sie am Kopf, ließ nur das Gesicht frei. »Den Helm befestigst du mir erst kurz vor dem Kampf. Denk an die zweite Keule, falls mir die erste zerbricht.«
Die Businen erschallten, festliche lang gezogene Stöße. Lupold trat vors Zelt. Vom Stadttor her näherte sich die geschlossene Sänfte der Fürstin. Gleichmäßig schritten die Träger, setzten ihre Last an der Tribünentreppe ab. Hermann von Baden öffnete selbst den Schlag.
Beim Anblick der Kaiserin ging Flüstern und Staunen durch die kleine Schar der Zuschauer. Neugieriges Hälserecken. Mützen wurden geschwenkt. Konstanze ließ sich von ihrem Ratgeber die wenigen Stufen hinaufführen und nahm im Lehnstuhl Platz.
Mit lauter Stimme forderte der Ausrufer die vier Knappen vor die Tribüne. Gleichzeitig beugten sie das Knie. Meine Kaiserin! Lupold spürte den Herzschlag aufsteigen.
»Erhebt euch«, forderte der Schiedsmann.
Ein kurzer Moment blieb Lupold. Ihr Gesicht war müde, die Lider halb geschlossen, das Haar unter der grünen Haube verborgen. Edelsteine funkelten am Kronreif. Der ärmellose Mantel fiel über die vollen Brüste, umhüllte faltig das Kind unter ihrem Herzen. Konstanze sah von einem zum anderen. Keinem der Knappen schenkte sie besondere Aufmerksamkeit. Einen Atemzug lang war Lupold enttäuscht.
»Möge der Tapferste gewinnen …« Nur leicht hob sie die Hand.
Rasch kehrten die jungen Männer vor ihre Zelte zurück. Der Schiedsmann rief das erste Paar in die Schranken.
Lupold war noch nicht gefordert. »Gut so«, murmelte er. Als Zweiter zu kämpfen gab ihm etwas mehr Zeit, die Muskeln an das schwere Gewicht des Kettenhemdes zu gewöhnen. Inzwischen hatte jeder der beiden ersten Streiter seinen Wimpel rechts oder links der Tribüne erreicht. Die geschlossenen Topfhelme verwandelten sie in gesichtslose Eisenpuppen; allein das Wappen ihrer Herren auf dem runden, lederbespannten Holzschild unterschied sie voneinander.
Ein schriller Trompetenstoß beendete den Trommelwirbel. Schon stampften die Knappen über das Kampffeld. Eisenbeschlagene Keulen prallten gegeneinander, dröhnten an den Schilden. Lauernd umkreisten sich die Männer, sprangen vor, zurück, wichen aus und suchten die Deckung zu durchbrechen. Sie nützten ihre klobigen Waffen zum Stoßen und Schlagen. Immer wieder. Tief war der Boden aufgewühlt. Staub wirbelte.
Da ging ein Schrei durch die Zuschauer. An der Schulter verletzt, taumelte einer der Kämpfer. Sein Gegner drängte nach; mit kreisendem Schwung über dem Kopf ließ er die Keule auf den Helm niederkrachen. Schwer brach der Getroffene in die Knie. Zum nächsten Schlag bereit, wartete der Gegner.
Noch war der Knappe nicht besiegt; schwankend stützte er sich hoch, trat einige Schritte zurück, zur Deckung hob er beide Arme. Der Angreifer ließ ihm keine Zeit; sein nächster Schlag zersplitterte den Holzschild, der nächste Hieb fällte den Taumelnden. Reglos lag er im Staub.
Während der Sieger sich vor Kaiserin Konstanze und den Edlen verbeugte, die ersten Wettsummen den Besitzer wechselten, packten zwei Knechte den Verlierer an Armen und Beinen und schleiften ihn zum Zelt.
»Macht euch bereit!« Der Schiedsmann winkte dem zweiten Paar.
Aufrecht stand Lupold neben seinem Wimpel rechts der Tribüne. »So ein Pech«, raunte der Diener, »du hast die Sonne von vorn«, und stülpte ihm den Topfhelm über die Haube.
Enge. Heftig sog Lupold den Atem ein, die Luft fehlte ihm. Enge. Das stickige Loch im kaiserlichen Heerlager. »Nicht.« Mit beiden Händen tastete er hinauf zum Helm. »Nicht.«
»Lass nur, ich bind ihn schon fest.« Von fern hörte er die Stimme seines Helfers, Licht drang grell durch den schmalen Sehschlitz, Lupold spürte wieder diese sengenden Sonnenstreifen, die durch den Schilfdeckel seines Gefängnisses fielen. Tag für Tag hatte er vergeblich versucht, sich vor ihnen zu verkriechen. Er zitterte.
»Geduld«, mahnte der Diener. »Gleich bin ich so weit.« Er streifte dem Knappen die ringbesetzten Fausthandschuhe über und hielt ihm die Keule hin. »Nun nimm sie doch.«
Lupold riss sich aus der Umklammerung. »Danke, Freund.« Fest packte er zu, schüttelte den Schild an seinem linken Arm. Ein Kampf. Nur ein Spiel, wie so oft, mehr nicht.
Trommelwirbel. Der schrill gestoßene Ton des Claro. Durch den Sehschlitz suchte Lupold seinen Gegner und stürmte auf ihn zu. Nach wenigen Schritten keuchte er. Das schwere Kettenhemd schnürte mit einem Mal seine Brust. Atemnot trieb das Blut in die Augen. »Ich ersticke.« Angst lähmte ihn, er blieb stehen, wie Blei wog die Keule in der Faust. Alle Kraft wich, von irgendwoher hörte er Lärm, Rufe der Zuschauer.
Durch einen roten Nebel sah er den Gegner, sah die Keule auf sich zufahren. Er wich aus, zu langsam, der Hieb traf den Halsschutz. Lupold versuchte den Schild zu heben. Ein furchtbarer Knall. Sein Kopf knickte zur Seite, Schmerz, der nächste Schlag warf den Kopf zur anderen Schulter. Das Dröhnen hörte nicht auf. Er spürte den Hieb mitten auf dem Helm, glaubte sein Schädel würde in den Hals geschlagen. Dann fühlte er sich leicht wie ein kreisender Habicht über dem Feld.
Der Gegner ließ den Angeschlagenen eine Weile hin und her torkeln, ehe er ihn mit einem leichten Stoß gegen die Brust zu Fall brachte. Kein begeistertes Klatschen der Zuschauer für den Sieger; sie fühlten sich um ihr Vergnügen betrogen. Pfiffe gellten, Spott und Flüche ertönten, bis der Verlierer weggeschafft war. Mit zornrotem Gesicht drohte ihm sein Herr hinterher.
Als Lupold zu sich kam, lag er ausgestreckt im Zelt. Der Diener hatte ihm den Helm abgenommen und wusch die Wunden an Ohren und Stirn.
»Was war nur?«, flüsterte Lupold.
»Ich versteh’s auch nicht. Du hast dich einfach schlagen lassen. Nicht gerührt hast du dich, bis du umgefallen bist.«
Von draußen drang das Lärmen des Endkampfes herein. »Es war mir eng, ganz plötzlich.« Lupold betastete seine Augen. »Wie ein Hexenbann.«
»So kann man’s auch nennen«, grinste der Helfer. »Für unsern Baron musst du dir sicher was Besseres einfallen lassen.«
Nach der Entscheidung kniete der siegreiche Edelknappe vor der Tribüne. Schwer gezeichnet nahm er den Beifall der Zuschauer entgegen. Kaiserin Konstanze beschenkte ihn mit einem Lächeln und fand lobende Worte auch für Mut und Geschicklichkeit der Unterlegenen. Als Hermann von Baden sie die hölzernen Stufen hinunterführte, drängte sich Prälat Winfried durch die adeligen Herren.
»Meine fürstliche Tochter!« Unruhige, kleine Augen; immer wieder glitt sein Blick an ihrer Gestalt hinunter, versuchte den faltigen Stoff zu durchdringen. »Die letzten Wochen der Ungewissheit erfüllten mich mit tiefer Sorge um Euer Befinden. Ich bin beglückt, Euch so zu sehen.«
Konstanze wandte sich ihm zu. Zorn stand in ihrem Gesicht, doch höflich erwiderte sie: »Wir wissen Eure Worte wohl einzuschätzen, ehrwürdiger Vater. Eure Fürsorge ist Uns stets eine große Stütze.« In jähem Entschluss öffnete sie den ärmellosen Mantel, raffte die Hälften zum Rücken. »Keine fromme Scham, ehrwürdiger Vater. Überzeugt Euch nur. Ihr seht, noch ist die kaiserliche Kuh hochträchtig.«
Der Prälat fuhr zusammen; schnell fasste er sich wieder. »Aber, Majestät, ich kann Euch versichern, meine Gebete …«
»Wir danken Euch.« Ohne ihn weiter zu beachten, nahm Konstanze in der Sänfte Platz. Hermann von Baden schloss die Seitentür und gab den Trägern das Zeichen.
Der Graf des siegreichen Knappen stolzierte zum Schiedsmann und strich die Preissumme ein. Außer ihm hatte niemand auf seinen Kämpfer gesetzt, so sammelte er genüsslich von den Edlen alle Wettgelder ein. Nicht der Entscheidungskampf wurde diskutiert, einziger Gesprächsstoff war die Blamage des Favoriten, des bisher so untadeligen Lupold. Beißende Schadenfreude steigerte das Vergnügen. »Diese geschickten Finten! Diese Schlagkraft! Ja, das ist das harte Holz, aus dem unsere kühnen deutschen Recken geschnitzt werden. Hoch lebe sein Lehrmeister!« Ohnmächtig vor Wut musste der Baron den Spott ertragen, während die übrigen Zuschauer und Edlen in heiterer Stimmung nach Ancona zurückschlenderten.
Kaum hatte sich das Feld vor dem Stadttor geleert, führten die Knechte stämmige Pferde zu den Zelten. Doch nur für den Sieger und die beiden anderen.
»Wo ist mein Gaul?« Lupold sah sich um. Jede Bewegung des Kopfes schmerzte, blaurot wucherte die Schwellung von der Stirn ins Haar, an Ohren und Hals klebte vertrocknetes Blut.
Sein Helfer zuckte die Achsel. »Du sollst laufen, hat unser Baron befohlen.«
»Was hat er noch gesagt?«
»Frag besser nicht.«
»Antworte!«
»Na, fluchen tut er.« In aller Ruhe bepackte sich der Waffenknecht mit Kettenhemd, Helm und Keulen.
»Ich weiß nicht, was mit mir war. Eins weiß ich, ich bin kein Feigling.«
»Schon gut. Wir gehen langsam. Dann schaffst du es auch zu Fuß.«
Lupold straffte den Rücken. Nach wenigen Schritten wurde sein Tritt fester.
Im Hof vor den Ställen des Palastes suhlten sich Schweine, Hühner scharrten im Boden. Mild wärmte die Dezembersonne den Mittag. Die Türen der Unterkünfte standen offen. Mithilfe der Diener untersuchten die drei Edelknappen ihre beschädigten Rüstungen. Hin und wieder warfen sie einen verstohlenen Blick zum dunklen Säulengang der Kapelle hinüber.
Kaum trat Lupold durchs Hoftor, verstummten die Gespräche, emsiger noch beugten sich die Männer über ihre Arbeit. Lupold beachtete sie nicht. Während sein Helfer den zerbeulten Helm und das Kettenhemd ablegte, schlurfte er zur Zisterne. Seine Zunge klebte am Gaumen. Trinken, dann schlafen, das Unglück vergessen; auf dem langen Weg zurück hatte er sich nach nichts anderem gesehnt. Er zog den Schöpfeimer am Strick herauf, trank aus der Kelle und schüttete sich das Wasser über den schmerzenden Kopf.
Aus dem Schatten des Säulengangs trat sein Herr. In riesigen Schritten war er bei dem Knappen. »Wie ein lahmer Straßenköter hast du dich verprügeln lassen!« Das Gebrüll überschlug sich in Flüchen und Drohungen. »Elender Feigling! Schande bringst du über mich und deinen Vater! Aber warte nur, ich werde den Mut in dich hineinprügeln.« Wutschäumend griff der Baron nach dem Holzschöpfer. Lupold sah den Schlag gegen seinen wunden Kopf und wich aus. Zu heftig war der Schwung; die Kelle entglitt seinem Herrn, wirbelte gegen den gemauerten Rand der Zisterne und fiel hinein.
Sofort schwieg der Ritter, ungläubig starrte er Lupold an. Ein Knappe hatte alle Züchtigung aufrecht zu ertragen. Der Jähzorn wandelte sich in gefährliche Ruhe. »Du widersetzt dich? Du verweigerst mir den Gehorsam?«
»Verzeiht, Herr. Es war nur …«
»Schweig. Du erhältst keinen Lohn mehr. Jedes verlorene Silberstück wirst du abdienen.« Der Ritter wies in die Zisterne. »Bring mir die Kelle wieder.«
Ohne Zögern setzte sich Lupold rittlings auf den Rand. Eiserne Bolzen waren untereinander ins Mauerwerk eingelassen, führten hinunter bis zum tief liegenden Wasserspiegel. Sein Fuß suchte den ersten Halt; er zog das andere Bein nach und stieg ins Loch. Kaum war der Hof seinem Blick entschwunden, fühlte Lupold wieder die dunkle Gefängnisenge. Unerbittlich griff eine Klaue nach ihm. Er rang nach Luft. Die Brust wurde eingeschnürt. Ihn schwindelte. Du darfst nicht aufgeben. Kämpfe gegen den teuflischen Zauber! Zitternd tastete er sich weiter in die Tiefe. Zweimal noch fand der Fuß den nächsten Steg. Angst lähmte die Muskeln. Unfähig zu jeder Bewegung hing er im Zisternenschacht.
»Wird’s bald!«, forderte sein Herr von oben.
»Ich … ich kann nicht«, keuchte Lupold.
Alle Flüche brachten keinen Erfolg. Schließlich hatte der Ritter ein Einsehen. An Stricken hievten die Edelknappen ihren Kameraden herauf und legten ihn behutsam neben den Brunnen. Nach einer Weile wich der Bann von Lupold; gierig sog er die frische Luft ein.
Der Baron schritt um ihn herum, öffnete und schloss die Fäuste; dabei ließ er Lupold nicht aus den Augen. Endlich beugte er sich über ihn, ohne Zorn, beinah besorgt: »Bist du krank?« Eine andere Erklärung konnte es nicht geben.
»Nein, Herr«, flüsterte Lupold. »Ein Hexenfluch. Heute Morgen traf er mich auch. Kaum hatte ich den Helm aufgestülpt.«
Die Edelknappen tauschten ungläubige Blicke; auch der Ritter ließ den Zauber nicht gelten. »Also bist du krank. Deshalb hast du beim Zweikampf versagt.« Diese Deutung war ihm als Ausrede vor seinen adeligen Freunden genug. Er schickte Lupold in den Schlafraum. Kopfschüttelnd sah er ihm nach, murmelte: »Weiß nicht, Junge, wie ich es deinem Vater erklären soll. Aber ein Knappe, der Angst vor dem Helm hat, der taugt nicht zum Ritter.«
Früh am nächsten Morgen verließ Hermann von Baden zu Pferd den Palazzo. Ihn begleiteten einheimische Führer und Bogenschützen, Hunde hechelten an den Leinen. Ein gewöhnlicher Jagdausflug, und keiner der Zuträger Heinrichs VI. schöpfte Verdacht.
Zwei Tage später kehrte der Baron zurück, ohne Beute. Sofort wurde er von der Kaiserin in ihren Gemächern empfangen. »Ich habe den geeigneten Ort gefunden, nur drei Wegstunden von Ancona entfernt: Jesi, eine seit alters stark befestigte, doch kleine und ärmliche Stadt in den Bergen. Eure Unterkunft bietet bescheidene Bequemlichkeit, die anderen Quartiere sind eher unwürdig zu nennen. Ich bin sicher, meine Fürstin, kaum einer der Edlen aus Eurem Gefolge wird Lust verspüren, das weiche Lager des Palazzos mit dem gestampften Boden einer Hütte einzutauschen.«
»Wie umsichtig Ihr seid, mon ami.« Konstanze griff nach dem Brief ihres Gemahls. »Wir handeln nicht gegen seinen Willen. Der Befehl lautet: In aller Öffentlichkeit auf dem Marktplatz. Von Ancona schrieb Heinrich nichts.« Ihre Gedanken eilten hinaus. »Jesi, ein schöner Name für den Geburtsort meines Sohnes.«
»Wann wird es so weit sein?«
»Ich bin ebenso unerfahren wie eine junge Magd vor ihrer ersten Entbindung. Doch der Knabe beweist jetzt schon die Eigenart eines Thronfolgers, immer häufiger bereitet mir seine Ungeduld heftige Schmerzen.« Hebamme und Medicus sagten die Geburt in der Weihnachtswoche voraus. »Um jede Gefahr zu meiden, sollten wir morgen nach der Messe aufbrechen. Ihr könnt es bekannt geben.« Konstanze zerknüllte das Pergament in den Händen. Ein Gedanke ließ sie innehalten. »Dieser Knappe, der uns den Befehl überbrachte, Lupold von Breisach, wie ergeht es ihm? So hilflos stand er beim Zweikampf vor seinem Gegner.«
»Meine Fürstin, Ihr solltet Euch jetzt auf das Ereignis vorbereiten und nicht …«
»Ihr kennt mich, mon ami. Die Sorge um andere lenkt von den eigenen Sorgen ab.«
»Was ich aus den Gesprächen der Edlen vor meinem Aufbruch bei Tisch entnommen habe, hat ihn sein Erzieher aus dem Dienst entlassen. Wie es scheint, taugt der junge Mann nicht mehr zum Ritter. Er fürchtet dunkle, enge Räume, selbst die Enge eines Helms. Von Feigheit wird geredet, andere sagen, er sei mit einem Mal krank im Gemüt. Sein Herr plant, den jungen Mann mit dem nächsten Kuriertrupp nach Hause zu schicken.«
»Das darf nicht geschehen!« Konstanze warf das Pergament auf den Boden. »Vielleicht lässt ihn die Kerkerqual nicht los? Und dafür trage ich die Verantwortung. Bringt ihn zu mir, jetzt gleich!«
Wenig später wurde Lupold hereingeführt. Gleich am Eingang blieb er stehen. Seinen farbigen Überrock hatte er bereits vor zwei Tagen ablegen müssen, jetzt trug er den schlichten Kittel eines Stallburschen.
»Komm näher.«
Mit gesenktem Blick gehorchte Lupold. Er beugte das Knie, blieb reglos in dieser Haltung; voller Scham erwartete er den Abschied von seiner Kaiserin. Seit dem Unglückstag entglitt ihm von Stunde zu Stunde ein Stück Hoffnung. Der Gedanke, so unehrenhaft auf die väterliche Burg heimkehren zu müssen, raubte ihm bei Nacht den Schlaf, und tagsüber mieden ihn die Kameraden wie einen Aussätzigen. Die größte Strafe aber war, den frisch ernannten Edelknappen in den Kleidern zu sehen, die bisher ihm gehört hatten. Gestern noch hatte er Lupold beim Wettkampf gedient, und heute musste Lupold ihm dienen.
Die Welt steht auf dem Kopf. Nein, ich lebe bei den Gegenfüßlern unter der Weltscheibe, dachte er bitter: Der Regen fällt umgekehrt. Meine Füße zeigen nach oben, mein Kopf hängt nach unten.
»Wo bleibt deine Erziehung?«
Die Stimme des Barons schreckte Lupold auf. »Verzeiht, ich, ich …« Er schwieg.
»Willst du nicht antworten?«
»Lasst nur, mon ami. Meine Frage kam zu schnell«, beschwichtigte die Kaiserin. »Solch ein Entschluss will bedacht werden. Lupold von Breisach, sieh mich an«, forderte sie.
Er zwang sich, die Augen zu ihr zu erheben, und blickte in ihr Lächeln.
»Nun? Bist du bereit, auf Ritterwürde, Kriegsgetümmel oder Turnierkämpfe zu verzichten? Willst du stattdessen in Unsern Dienst treten, Unser Page und nach einer Bewährungsfrist Unser Kammerherr werden?«
Langsam wächst Glück in der Dunkelheit, spät blüht es auf. »Ja, Herrin.« Lupold sagte es, bevor er begriff. Dann stammelte er: »Ja, Herrin. Mit aller Kraft, mit meinem Leben. Meine Treue wird …«
»Deine Bezahlung erhältst aus der Hand des Barons von Baden«, unterbrach sie lächelnd die Schwüre. »Nur Uns und ihm bist du Gehorsam schuldig. Und jetzt spute dich! Sabrina, Unsere erste Zofe wird dir angemessene Kleidung geben. Es gibt viel Arbeit. Hilf den Mägden die Truhen packen. Morgen wirst du Uns auf Unserer kleinen Reise begleiten.«
Kaum hatte Lupold das Gemach verlassen, verbeugte sich Hermann von Baden vor der Kaiserin. »Ich bewundere Euch, Fürstin. Trotz der Sorge um Eure Familie in Sizilien, trotz der nahen Geburt findet Ihr noch Zeit, Euch um das kleine Glück eines entlassenen Knappen zu kümmern.«