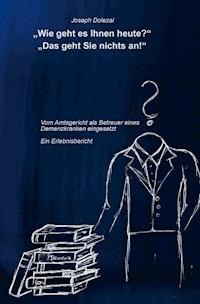
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es kann jeden Tag unverhofft passieren: Ein Anverwandter wird zum Betreuungs- und Pflegefall, kann allein nicht mehr zurechtkommen. Neben Versorgung und Pflege ist oft auch eine vom Amtsgericht eingerichtete Betreuung zu übernehmen. Plötzlich steht man als Betreuender im Mittelpunkt eines komplizierten Beziehungsgeflechtes von Gerichten, Ämtern, Krankenversicherungen, Ärztinnen und Ärzten, Pflegeeinrichtungen und Banken. Der Autor hat über zwei Jahre seinen kranken Vater im Auftrag des Amtsgerichtes betreut und berichtet darüber detailliert und einfühlsam. Mit seinem Bericht will er dazu beitragen, das Verständnis für den Beruf der (hauptberuflichen oder ehrenamtlichen) BetreuerInnen zu stärken. Das Buch soll Betroffenen eine kleine Hilfe bei der Bewältigung dieser Aufgabe sein. Fallbeispiele, Tagebuchnotizen, ein Leitfaden, Internetlinks und Literaturhinweise ergänzen die Chronik einer Betreuung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wie geht es Ihnen heute?“
„Das geht Sie nichts an!“
Vom Amtsgericht als Betreuer eines Demenzkranken eingesetzt
Ein Erlebnisbericht
von Joseph Dolezal
epubli GmbH
Impressum
„Wie geht es Ihnen heute?“
„Das geht Sie nichts an!“
Autor: Dr. Joseph Dolezal
Copyright: © 2015 Dr. Joseph Dolezal
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin
http://www.epubli.de
Lektorat: Johanna Neuling
(http://www.johanna-neuling.de)
Titelgestaltung: Benita Zabel
(http://photo-upper-art.com)
Der Autor
Dr. phil. Joseph Dolezal (geb. 1948) studierte Geschichte und Politik in Bonn. In seinem ebenfalls bei epubli erschienenen Buch „Im Todeshaus. Oberregierungsrat Paul Vacano. Leiter der Strafanstalt Berlin - Plötzensee. 1928–1943/44. Ein dokumentarischer Bericht“ schildert er die tragische Geschichte seines Großvaters.
Der Autor arbeitete über drei Jahrzehnte im Öffentlichen Dienst, zuletzt im Bundesministerium des Innern.
Auf seiner Website http://www.dolezal-reisebuch.de berichtet er fortlaufend über zahlreiche Reisen in alle Welt.
Er ist verheiratet und lebt in Wiesenburg/Mark.
Vorwort
Dies ist ein Bericht aus der Praxis, die genannte Betreuung wurde 2013 eingerichtet und dauerte zwei Jahre.
Die geschilderten Umstände sind ausnahmslos real und haben sich so abgespielt wie dargestellt. Personen und Orte habe ich verfremdet.
Als Betreuer wurde ich relativ unverhofft, und selbst bereits im Ruhestand, eingesetzt. Vorkenntnisse hatte ich, als Historiker, keine. Es war mir auch nicht klar, was für ein breites Arbeitsfeld eine Betreuung sein kann. Es geht nicht nur um die betreute Person, die BetreuerInnen stehen im Mittelpunkt eines komplizierten Beziehungsgeflechts von Gerichten, Ämtern, Krankenversicherungen, Ärztinnen und Ärzten, Pflegeeinrichtungen und Finanzinstituten und müssen ständig nach allen Seiten hin agieren. Dazu kommen – wie in meinem Fall – oftmals die Vermögensverwaltung des Betreuten und die Verwaltung seines Hauses.
Die gesetzlichen Vorgaben für die Betreuertätigkeit sind bis in Details geregelt, aber in der Praxis nicht immer hilfreich. Das Gesetz ist das Eine, wie man es interpretiert oder anwendet, das Andere. Grundlage ist das sogenannte Betreuungsgesetz (BtG) vom 12.09.1990 (Bundesgesetzblatt Teil I, S. 2002), in Kraft getreten am 01.01.1992. Um nur ein Beispiel von endlos vielen zu nennen, hat der Betreuer „die Pflicht und die Berechtigung zur Entscheidung über alle Angelegenheiten der Gesundheitsfürsorge“. Aber wenn z.B. zu entscheiden ist, ob – wie vom behandelnden Arzt vorgeschlagen – einem schwerkranken Menschen eine Magensonde gelegt oder Morphium verabreicht wird, steht der Betreuende allein da.
Fachliteratur gibt es unendlich viel zu Themen wie: Pflege, Pflegeeinrichtungen, Demenz und Messie-Syndrom, aber kaum zum Beruf bzw. zum freiwilligen Amt des Betreuers/der Betreuerin. Pflegekräfte, ÄrztInnen und RichterInnen wissen in der Regel, was sie tun müssen, weil sie vergleichsweise klare Regeln haben. Bei der Betreuung gibt es Grauzonen und Grenzfälle, wo so oder so gehandelt werden kann, weil die Vorgaben nicht eindeutig sind und nicht immer erkennbar ist, was in der konkreten Situation dem freien Willen oder dem „Wohl“ des Betreuten dient. Das ist z.B. der Fall, wenn man den Betreuten durch kleine Tricks daran hindert in ein Taxi zu steigen, um in sein Haus zu fahren, weil er dort wieder wohnen will, was aber von den Umständen her nicht geht. Oder wenn man nicht dem Wunsch folgt, eine Schere zu bringen, um Zeitungsartikel auszuschneiden. Die Schere kann nämlich auch als Waffe herhalten oder die betreute Person verletzt sich unbeabsichtigt damit.
Dieser Bericht schildert, anhand einiger längst nicht erschöpfender Beispiele, was in der täglichen Praxis einer Betreuung alles so „anfällt“. Er soll dazu beitragen, das Verständnis für den Beruf des (hauptberuflichen oder ehrenamtlichen) Betreuers zu stärken. Das Buch soll Betroffenen eine kleine Hilfe bei der Bewältigung einer Betreuung sein und anhand der vielen Handlungsfelder, die angerissen werden, die tägliche Praxis beschreiben. Sicher aus einer subjektiven Sicht, aber Betroffene, die selbst BetreuerInnen sind, werden das Eine oder Andere wiedererkennen. Die Ausschnitte aus dem „Tagebuch“, das ich eine Zeit lang geführt habe, mögen das zeigen.
Als praktische Hilfe gibt es am Schluss ein kleines Lexikon in Form eines Leitfadens.
Was das Buch nicht leisten kann, ist eine wissenschaftliche, juristisch oder gar medizinisch fundierte Gesamtdarstellung. Die sogenannte häusliche Pflege durch Verwandte im eigenen Haus wird, mangels eigener Erfahrung, gar nicht betrachtet. Die häusliche Pflege für Anverwandte ist in diesem Zusammenhang wohl der am stärksten fordernde und belastende „Job“.
Die Betreuung ist nur eine Facette der Alten- und Gesundheitspolitik, aber eine die immer wichtiger wird. Und: Es kann jedem von uns passieren, wenn er/sie noch ältere Verwandte oder Eltern hat, dass er/sie mit dem Thema Betreuung konfrontiert wird und sich entscheiden muss, ob er oder sie diese Aufgabe übernimmt. Aus ethisch-moralischen Gründen, aber auch weil Kinder verpflichtet sind für ihre Eltern einzustehen, sollte man sich dieser Aufgabe nicht entziehen. Bei allen geschilderten Problemen und Belastungen soll dieses Buch auch dazu ermuntern, sich der Aufgabe einer Betreuung zu stellen.
Seien wir also vorbereitet! Das gilt besonders für „Kinder“ mittlerer Jahrgänge oder schon im Rentenalter, wo Eltern in hohem Alter in die Situation kommen, in welcher sie allein nicht mehr zurechtkommen.
Und sich selbst kann man nur raten beizeiten, nicht erst wenn der Fall eingetreten ist, für den eigenen letzten Lebensabschnitt Vorsorge zu treffen, durch eine Patientenverfügung, Vollmachten und dergleichen. Und dazu gehört auch, dass man sich Gedanken macht, wer gegebenenfalls der eigene Betreuer oder die eigene Betreuerin sein sollte.
Was erwartet die LeserInnen?
Im 1. Kapitel wird der oft steinige und mühselige Weg hin zur Einrichtung einer Betreuung anhand meines tatsächlichen Falles beschrieben.
Im 2. Kapitel werden die Aufgabenfelder einer Betreuung vom Gesetz her und in der Praxis beleuchtet, wobei die mir übertragene Betreuung die denkbar umfangreichste war. Das zuständige Gericht kann natürlich auch eine Betreuung auf bestimmte Aspekte einschränken und z.B. die „Vermögenssorge“ ausnehmen.
Im 3. Kapitel schildere ich, was alles in den ersten Monaten zu tun war. Die erste Zeit ist besonders kritisch, weil alles gleichzeitig passiert, bis eine gewisse „Routine“ hergestellt ist.
Im 4. Kapitel berichte ich aus meinen Erfahrungen mit Pflegeheimen, von der Suche nach einem geeigneten Haus bis zum Vertragsabschluss und dem täglichen Leben in einer solchen Einrichtung. Das Bild der Pflegehäuser in der Öffentlichkeit ist teilweise verzerrt, weil vielfach angenommen wird, dass die Betreuten nicht gut und sachgerecht und den individuellen Bedürfnissen angepasst, behandelt werden. Das kommt sicher vor, auf der anderen Seite leben die BewohnerInnen einer Pflegeeinrichtung in der Regel in einem professionell geführten Haus und die MitarbeiterInnen wissen – aufgrund einer jahrelangen Ausbildung – was zu tun ist. Als pflegender Verwandter weiß man zunächst nicht, wie man ein Spritze setzt oder einen unbeweglich gewordenen Menschen im Bett aufrichtet und in den Rollstuhl setzt, ohne ihm Schmerzen zuzufügen.
Im 5. Kapitel versuche ich am Beispiel meines Vaters aufzuzeigen, wie sich trotz aller Pflege und Betreuung das Leben des betroffenen Menschen allmählich auflöst und Vertrautes verschwindet. Eine traurige Angelegenheit, wenn man es unmittelbar miterlebt.
Das 6. Kapitel behandelt den Sonderfall eines Demenzkranken, der zusätzlich unter dem sogenannten Messie-Syndrom leidet bzw. schon vor der Demenz daran gelitten hat. Beide Krankheitsbilder kommen häufig zusammen vor, was bei der Betreuung besonders Probleme bereitet, wenn auch noch ein vermülltes Haus bzw. eine Wohnung aufzulösen ist.
Im 7. Kapitel komme ich in der Chronologie noch einmal auf die Pflegeresidenz zurück und schildere den Umzug des Vaters von einer Stadt in eine andere.
Das 8. und letzte Kapitel ist der Versuch, meine subjektiven Erfahrungen zusammenzufassen und einige allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen.
Der Anhang enthält: Auszüge aus meinem Betreuungs-Tagebuch, einen kurzen Leitfaden für BetreuerInnen sowie ausgewählte Links und Literaturhinweise.
Inhalt
Vorwort 5
1. Kapitel: Es deutet sich an.16
Vom eigenen Haus in die Psychiatrie
Amtsarzt und Richter werden aktiv
Exkurs: Einfach war es (mit ihm) nie
2. Kapitel: Die Betreuung wird eingerichtet 27
Rechte und Pflichten
Vermögenssorge
Gesundheitsfürsorge
Aufenthaltsbestimmung
Wohnungsangelegenheiten
Vertretung gegenüber Behörden/Versicherungen/Renten- und Sozialleistungsträgern
Entgegennahme, Anhalten und Öffnen der Post im Rahmen der übertragenen Aufgabenkreise
3. Kapitel: Es wird losgelegt 44
Alles gleichzeitig!
Kurzbilanz nach sechs Monaten
4. Kapitel: In der Seniorenresidenz.52
Man wird „eingewiesen“, Vertragsabschluss
Eine andere Welt
Das Personal und die MitbewohnerInnen
Soziale Kontakte
Organisation des Pflegeheims
Ärztliche Versorgung und: Ab in die Psychiatrie?
Telefon, Radio und TV, Zeitung
5. Kapitel: Mosaike des Lebens.70
Besteht Ausweispflicht?
Teilnahme an Wahlen – der Wahlschein
Keine Lebensfreude
Vertrautes löst sich auf
6. Kapitel: Das eigene Haus.75
Zustand vor und nach dem Auszug
Es ist ein Messie-Haus
7. Kapitel: Umzug mit 88 Jahren.84
Ein schwieriges Unterfangen
Die neue Pflegeresidenz
8. Kapitel: BetreuerIn als Beruf und „Berufung“ 94
Einige grundlegende Fakten
Wer betreut die BetreuerInnen?
Anhang: Auszüge aus meinem Betreuungs-Tagebuch (Mai 2013 - November 2014) 104
Anhang: Leitfaden für BetreuerInnen.119
Anhang: Ausgewählte Links.128
Literaturhinweise
1. Kapitel: Es deutet sich an
Vom eigenen Haus in die Psychiatrie
Im April/Mai 2013 spitzt sich die krisenhafte Situation im Haus meines zu der Zeit 87-jährigen Vaters, in einer Stadt im Südwesten Deutschlands, zu. Seit einigen Jahren ging es mit dem Haus und ihm selbst stetig bergab. Bei meinen Besuchen war klar, dass es so nicht weitergehen konnte, denn mein Vater konnte als Alleinlebender seine „Angelegenheiten“, wie es im Amtsdeutsch heißt, nicht mehr „selbst besorgen“. Das freilich bestritt er heftig, so war keine Abhilfe möglich.
Eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht für seinen Sohn lehnte er ab, die Vordrucke lagen, unbearbeitet und über zwei Jahre, auf dem Wohnzimmertisch. Von einer Patientenverfügung hielt er – mit dem falschen Argument – nichts, ÄrztInnen könnten dann mit ihm umspringen, wie sie wollten. Den Einwand, ÄrztInnen hätten erst recht freie Hand zu tun und zu lassen, was sie für richtig hielten, wenn keine Patientenverfügung da ist, ließ er nicht gelten. Wenn überhaupt war für ihn nur der restriktive fraktionsübergreifende Gesetzentwurf einer bestimmten Abgeordnetengruppe im Bundestag relevant. Davon hatte er 2008/2009 in der Zeitung gelesen und als der nicht zum Zuge kam, war das für ihn erst mal erledigt. Jahre später, als er bereits in seiner Seniorenresidenz war, fand sich zu Hause dann doch ein ausgefülltes Formular der katholischen und evangelischen Kirche.





























