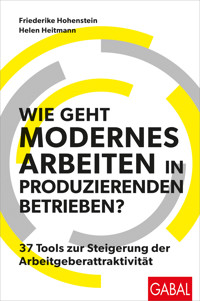
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GABAL Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dein Business
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet New Work für die Produktion? Fachkräftemangel – dieses Wort ist prägend, wenn man sich die Entwicklung der Industrie der letzten Jahre anschaut. Zwar können Tätigkeiten mit einem hohen Automatisierungsgrad immer häufiger durch technische Lösungen ersetzt werden, dennoch ist kein massiver Abbau an Jobs in der Produktion zu erkennen. Vielmehr verändert sich durch die fortschreitende Automatisierung das Anforderungsprofil von Mitarbeitenden in der Produktion und der Bedarf an hochqualifizierten Mitarbeitenden nimmt zu. Bis 2030 werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt Schätzungen zufolge bis zu 4 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Der War for Talents nimmt ungeahnte Dimensionen an und die produzierenden KMU haben immer größere Schwierigkeiten, die nötigen Hebel für die Gewinnung neuer Mitarbeitenden zu finden. Daraus lässt sich ableiten: Ohne eine moderne Personalabteilung und ein neues Verständnis von Personalarbeit werden insbesondere produzierende Betriebe am Markt nicht weiter bestehen können. Dieses Buch soll einen Weg aus der Krise aufzeigen, indem es sich folgenden Kernfragen widmet: - Was bedeutet New Work für die Produktion? - Wie gestalten wir den Arbeitsplatz in der Produktion, dass er für verschiedene Generationen in allen 6 Phasen des Employee Lifecycles attraktiv ist? Welche konkreten Maßnahmen können von Unternehmerinnen und Unternehmern implementiert werden? - Was braucht es als Arbeitgeber, um den Ansprüchen und Erwartungen der ArbeitnehmerInnen gerecht zu werden?Anhand des Employee Lifecycles, also der natürlichen Phasen, die Mitarbeitende in einem Unternehmen durchlaufen, werden anwendbare Kommunikationsstrategien und Change-Maßnahmen für die erfolgreiche Implementierung moderner Unternehmensstrategien für Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte und Personalerinnen sowie Personaler in produzierenden KMU in einer praktischen Toolbox zusammengefasst und mit praxisnahen Fallbeispielen versehen. Eine Themenpremiere auf dem Buchmarkt Erhalten Sie erstmals eine ausführliche Antwort auf die Frage: Wie geht modernes Arbeiten, wenn Homeoffice keinerlei Option ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friederike Hohenstein Helen Heitmann
Wie Geht Modernes Arbeiten In Produzierenden Betrieben?
37 Tools zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
Externe Links wurden bis zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches geprüft.
Auf etwaige Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt hat der Verlag keinen Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Ein Hinweis zu gendergerechter Sprache: Die Entscheidung, in welcher Form alle Geschlechter angesprochen werden, obliegt den jeweiligen Verfassenden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN Buchausgabe: 978-3-96739-225-8
ISBN ePUB: 978-3-96740-468-5
Lektorat: Susanne von Ahn, Hasloh
Umschlaggestaltung: Martin Zech, Bremen
Autorenfoto: Friederike Hohenstein | Helen Heitmann
Satz und Layout: Das Herstellungsbüro, Hamburg, www.buch-herstellungsbuero.de
© 2025 GABAL Verlag GmbH, Offenbach
Das E-Book basiert auf dem 2025 erschienenen Buchtitel "Wie geht modernes Arbeiten in produzierenden Betrieben? - 37 Tools zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität" von Friederike Hohenstein und Helen Heitmann.
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags. Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
www.gabal-verlag.de
www.gabal-magazin.de
www.facebook.com/Gabalbuecher
www.x.com/gabalbuecher
www.instagram.com/gabalbuecher
Inhalt
1.
Attraktive Personalarbeit – das A und O für den modernen produzierenden Betrieb
2.
Die neue intelligente Produktionswelt
2.1
Industrielle Fertigung: Arbeitsgestaltung im Wandel
2.2
New Work in der Produktion ist unmöglich – oder nicht?
3.
Der Employee Lifecycle: Arbeitgeberattraktivität in allen Phasen des betrieblichen Lebenszyklus sicherstellen
3.1
Phase 1: Talent Attraction in der heutigen Zeit – Selbstmarketing als Überlebensmaßnahme
3.2
Phase 2: Recruiting in herausfordernden Zeiten – der Blick über den Tellerrand
3.3
Phase 3: Onboarding – wenn Talente vom Outsider zum Insider einer Organisation werden
3.4
Phase 4: Development – das wichtigste Investment: Die Entwicklung der eigenen Belegschaft
3.5
Phase 5: Retention – Mitarbeitende halten: die schwierigste Aufgabe eines Unternehmens
3.6
Phase 6: Offboarding – das Band fürs Leben knüpfen
4.
Die Veränderungen richtig umsetzen: Change-Management als Hebel
4.1
Change-Management: Heiße Luft oder echter Hebel?
4.2
The best team wins
4.3
Ohne Kommunikation ist alles nichts
5.
Employee Lifecycle: An Bedeutung nicht zu unterschätzen
37 Tools
Anmerkungen
Quellenverzeichnis
Über die Autorinnen
1. Attraktive Personalarbeit – das A und O für den modernen produzierenden Betrieb
Strategisch aufgestellte Personalarbeit ist der wahrscheinlich am meisten unterschätzte Hebel für den Unternehmenserfolg. Eine Business-Strategie ohne untermauernde Personalstrategie kann nicht funktionieren. Beide Komponenten müssen zwangsläufig Hand in Hand gehen: Das Unternehmen will wachsen? Dann muss sich dies in der Personalplanung widerspiegeln. Das Unternehmen will neue Märkte erschließen? Dann muss dies in die Personalentwicklungsstrategie eingebunden werden. Das Unternehmen verliert im größeren Stil Mitarbeitende? Dann benötigt es eine Personalstrategie zur Mitarbeiterbindung. Die Liste an Einflüssen von Personalarbeit auf die Unternehmensziele ließe sich beliebig lang fortsetzen. Ein Unternehmen ist nur so gut wie die Menschen, die dort arbeiten. Und um die Menschen kümmert sich in einem Unternehmen die Personalabteilung. Daher ist es wichtig, diese relevante Abteilung des Unternehmens strategisch aufzustellen, als relevanten Key-Player zu identifizieren und in den Aufbau eines ganzheitlich gedachten und gelebten Personalmanagements zu investieren.
Besonders in kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU), darunter wiederum vor allem in produzierenden Betrieben, ist die Personalarbeit häufig von administrativer Zuarbeit geprägt und hat mit den strategischen Inhalten wenig Berührung. Dies wird sich mittelfristig als ein Problem herausstellen, denn gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, die vom Fachkräftemangel gekennzeichnet sind, muss die Personalarbeit die Geschäftsführung unterstützen, damit Ziele erreicht werden und Mitarbeitende gehalten bzw. gewonnen werden können.
Der Begriff KMU umfasst Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen. Das Statistische Bundesamt definiert Kleinstunternehmen als Unternehmen mit bis zu neun tätigen Personen und einem Umsatz von bis zu 2 Millionen Euro, kleine Unternehmen sind Unternehmen von bis zu 49 Mitarbeitenden und bis zu 10 Millionen Euro Umsatz und mittlere Unternehmen sind solche mit bis zu 249 Mitarbeitenden und bis zu 50 Millionen Euro Umsatz.1
Die deutsche Wirtschaft steckt infolge der global zunehmenden Krisen schon seit einigen Jahren in einer angespannten Situation, die Prognosen zum Wirtschaftswachstum nähern sich der Nulllinie an. Eine schwierige Zeit für Unternehmen, die sich mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sehen: Einerseits verlagern viele Unternehmen ihre Produktion ins Ausland und andererseits haben etliche Unternehmen Schwierigkeiten, geeignetes Fachpersonal zu finden.
Medial ist dieses Thema stets sehr präsent. Einem angekündigten Stellenabbau stehen Meldungen gegenüber, dass bis 2030 auf dem deutschen Arbeitsmarkt bis zu 4 Millionen Arbeitskräfte fehlen werden.2 Wir befinden uns in einer Welt, die von Ambivalenz geprägt ist.
Der demografische Wandel wird zu einem Problem für die deutschen Unternehmen, denn eine große Vielzahl von Fachkräften wird in den nächsten Jahren in Rente gehen. Natürlich scheint eine Verlagerung von Produktionskapazitäten in sogenannte best cost countries, also Länder, die sich durch ein Übermaß an Fachkräften und sehr niedrige Gehaltsniveaus auszeichnen, eine schnelle und vermeintlich einfache Lösung. Jedoch sind vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen in ihren Gemeinden historisch sehr verwachsen und der Schritt einer Verlagerung gilt oft als letzte oder auch als gar keine Option. Um hier den Herausforderungen produktiv und aktiv zu begegnen, ist es notwendig, dass man sich als Arbeitgeber dem Menschen widmet. Das zentrale Thema der Zukunft lautet: Arbeitgeberattraktivität. Denn: Je glücklicher und engagierter sich Mitarbeitende in einem Unternehmen entfalten können, desto höher die Produktivität, die Innovationskraft, die Mitarbeiterbindung und desto leichter die Anwerbung von neuen Talenten. Es ist also von elementarer Bedeutung, dass sich Unternehmen jeglicher Größe intensiv mit ihrer Personalarbeit auseinandersetzen, diese strategisch aufstellen und für die Mitarbeitenden einen attraktiven und wertschätzenden Employee Lifecycle aufbauen.
Stand in den vergangenen Jahren selbstverständlich die Kundenzentrierung im Mittelpunkt, muss dieser Fokus nun stark erweitert werden und auf die einzelnen Mitarbeitenden ausgedehnt werden. Warum? Weil wir nur dadurch ein wettbewerbsfähiges Umfeld schaffen, in dem Menschen gerne arbeiten und sich mit vollem Einsatz einbringen. Die Erwartungshaltungen, Bedürfnisse und Wünsche der Menschen zum Thema haben sich in den letzten Jahren grundlegend geändert und hier müssen Unternehmen vorbereitet sein, um diesem Umschwung zu begegnen. Wir haben uns als Gesellschaft verändert und werden uns nicht mehr zurückentwickeln.
Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie schnell Unternehmen es schaffen können, sich mithilfe von gezielten Maßnahmen auf neue Bedingungen einzustellen. Als sich im Februar 2020 eine seltsame Lungenkrankheit auf der Erde ausbreitet und in stetig steigender Geschwindigkeit die Macht über die Menschheit übernimmt, steht die Welt zunächst Kopf. Alles, was davor unsere Arbeitsnormalität geprägt hat, muss verändert werden und Unternehmen stehen vor der Frage, wie der Betrieb überhaupt aufrechterhalten werden kann. Nach drei Wochen Coronavirus arbeiteten in Deutschland auf einmal »alle« von zu Hause. Der Esstisch wurde zum Schreibtisch umgebaut, Bildschirm drauf, Laptop angeschlossen, Videokonferenz an. Am Anfang herrschte noch große Aufregung über den Zustand und ach, wie witzig war es doch, dass man auf einmal das Zuhause der Kollegen sah. Hatte Michael wirklich eine so komische Tapete im Wohnzimmer? Und wieso sprang Tina dauernd ihr Hund auf den Schoß? Jeder kennt die immer gleichen Rituale der Telefonkonferenzen: Du bist stummgeschaltet. Wir sehen deinen Bildschirm noch nicht. Sorry, ich bin gerade aus der Leitung geflogen, meine Frau hat auch gerade einen Call und das Internet macht das nicht mit. Meine Kamera muss heute leider ausbleiben …
Eine Aufregung, die sich schnell in Normalität verwandelte – alle sprachen vom sogenannten New Normal. Morgens kein Arbeitsweg mehr ins Büro, die Business-Klamotten seit Monaten nicht getragen im Schrank, flexibel arbeiten, wie man will, auch gerne nachts. Alles war erlaubt und wurde schnell in einer neuen Flexible Work Policy vom Unternehmen zusammengefasst. Es war ein Momentum: Auf einmal sprachen alle von New Work.
Eine unternehmensspezifische Flexible Work Policy ist für Mitarbeitende und Führungskräfte eines Unternehmens eine Art Governance. Darin werden die Rahmenbedingungen für die hybride Zusammenarbeit im Unternehmen beschrieben. Dort kann zum Beispiel geregelt sein, wie viele Tage Mitarbeitende im Schnitt flexibel ihre Schichten einteilen dürfen oder wann außerhalb der Produktionsstätte gearbeitet werden kann.
»Wir arbeiten jetzt im New-Work-Style«, hörte man stolz die Firmenchefs verkünden, die New Work als reine Remote-Arbeit interpretierten. Was vor der Pandemie als undenkbar galt, war schon nach wenigen Tagen der Normalzustand: Arbeiten mithilfe von digitalen Tools, von zu Hause aus, flexibel und überraschend selbstbestimmt. Was anfangs noch als ein Experiment für wenige Wochen gedacht war, wurde schnell zu einem verstetigten Dauerzustand. Aus der anfänglichen Unsicherheit, dass die Produktivität sinken könnte und Mitarbeitende machen, was sie wollen, wurde rasch die Gewissheit, dass diese flexible Arbeitsform auch viele Vorteile mit sich bringt. Manche Unternehmen kündigten sogar kurzerhand Mietflächen, denn so gesehen würde langfristig kein Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin mehr einen eigenen Arbeitsplatz im Büro brauchen, da alle diesen auch zu Hause hätten. Das war zumindest damals die Überlegung.
Inmitten dieser großen Veränderung wurde eine relevante Arbeitnehmergruppe in Deutschland vergessen: Mitarbeitende in Produktionsbetrieben der industriellen Fertigung. Ihre Situation sah und sieht noch heute ganz anders aus. Sie haben sich keinen Schreibtisch zu Hause eingerichtet. Eine Werkbank oder gar eine ganze Produktionslinie lässt sich nicht mit nach Hause nehmen. Der Arbeitsalltag musste trotz aller durch die Pandemie bedingten Einschränkungen irgendwie weitergehen Also fuhren diese Beschäftigten weiter zur Arbeit und mussten streng auf Hygieneregeln achten. Maskenpflicht, Abstandsregelungen, abgesperrte Stühle in der Kantine und im Pausenraum waren etwas ganz Normales. Eine Schicht tauschen? Plötzlich unmöglich. Die Anzahl der möglichen Kontakte im Unternehmen musste so gering wie möglich gehalten werden. Und das alles, während die Kinder zu Hause betreut werden sollten, weil Kinder, anders als ihre Eltern, ihre Schulaufgaben auch vom heimischen Schreibtisch aus machen konnten.
Vom viel besprochenen New Work war hier erst einmal nicht viel zu spüren. Wer einen Bildschirmarbeitsplatz hatte und keine körperliche Arbeit im Unternehmen verrichtete, war auf einmal als White-Collar-Arbeitnehmer gezwungen, von zu Hause aus tätig zu sein. Ganz anders sah und sieht die Situation bis heute bei den sogenannten Blue-Collar-Arbeitskräften aus. Während die White-Collar-Beschäftigten sehr stark von den neu gewonnenen Privilegien profitieren, hat sich die Arbeitswelt für die Blue-Collar-Kräfte bis heute nicht viel verändert. Homeoffice in der Produktion? Undenkbar. Zeitliche Flexibilität in der Schicht? Nicht erwägt. Mitbestimmung? Wenig vorhanden. Wir haben also unsere White-Collar-Gesellschaft in die New-Work-Ära katapultiert und dabei unsere Blue-Collar-Arbeitskräfte vergessen.
White-Collar-Arbeitskräfte sind Mitarbeitende in einem Unternehmen, die überwiegend einen klassischen Bildschirmarbeitsplatz haben und keine körperliche Arbeit verrichten.
Blue-Collar-Arbeitskräfte sind Mitarbeitende in einem Unternehmen, die überwiegend körperliche Arbeit abseits des Schreibtisches verrichten.
Sind wir so noch attraktiv für diese Gruppe an Beschäftigten? Wir glauben nicht.
Wir wollen und müssen etwas ändern, um in der Zukunft überhaupt noch Talente für die Produktion zu finden. In Deutschland gab es im Jahr 2023 8,13 Millionen Menschen, die ihren Lebensunterhalt in der produzierenden Industrie verdienten.3 Eine beeindruckend große Gruppe an Beschäftigten, deren Erwartungshaltung und Ansprüche an Arbeitgeberattraktivität sich verändern bzw. verändern werden. Es werden immer neue Generationen auf den Arbeitsmarkt kommen, die nicht mehr bereit sind, in den vorhandenen starren Strukturen ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen. Entwicklung, Perspektive, Lernen – all dies werden relevante Elemente für diese Arbeitsplätze sein. Während in den vergangenen Jahren die White-Collar-Belegschaft einen hohen Zugewinn an Freiheit, Flexibilität und Selbstwirksamkeit verbuchen konnte, müssen wir uns nun darum kümmern, dass wir im eng gesteckten Rahmen für die Blue-Collar-Beschäftigten nachziehen und auch hier den Fokus auf Mitbestimmung, Flexibilität und Entwicklung legen.
An dieser Stelle muss die Personalarbeit eines Unternehmens strategisch aufgesetzt sein und anders agieren als bisher. Das Verständnis, dass Personalarbeit aus rein administrativer Tätigkeit besteht, die vor allem dafür sorgt, dass die Löhne am Ende des Monats gezahlt und die Meldepflichten eingehalten werden, muss aufgebrochen werden. Personalarbeit ist und kann so viel mehr. Richtig angegangen haben wir hier den Hebel, der helfen wird, Unternehmen auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Dafür braucht es einen Ansatz, der sicherstellt, dass die strategische Personalarbeit in den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus verwoben ist. Doch wie soll dieser Wandel in der Produktion gelingen? Die Verbindung von theoretischen Ansätzen aus der Wissenschaft mit in der Praxis erprobten Initiativen hilft, Antworten auf die relevanten Fragen zu geben. Modernes People-Management hört nicht am Bildschirm auf, sondern lässt sich mit einigen Tricks und Tipps auf die Industrie übertragen.
Große Unternehmen haben hier oft durchgesteuerte Programme, die von einer strategischen Personaleinheit getragen und navigiert werden. Wir sehen die größte Herausforderung bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen, die dieselben Probleme haben wie die großen, jedoch weniger Ressourcen und Kapazitäten, um sich hier anders aufzustellen. Für genau diese Unternehmen wollen wir Impulse setzen, denn was sich auf den ersten Blick als unlösbare Anforderung darstellt, lässt sich mit einem neuen Verständnis von Personalarbeit und einfachen Tools schon praktisch verändern. Wichtig ist uns hierbei, dass Personalmanagement ein Teamsport ist. Die Personalabteilung gibt den Takt vor, aber nur gemeinsam mit der Geschäftsführung, den Führungskräften sowie der gesamten Belegschaft kann es gelingen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.
Wir sprechen die ganzheitlichen Verbindungen der einzelnen Schritte im Employee Lifecycle (siehe folgende Abbildung) an:
Alle Phasen des Employee Lifecycles
Angefangen bei der Werbung um neue Talente, dem Recruiting, über die ersten Schritte im neuen Unternehmen, die Entwicklung, die Mitarbeiterbindung und den Austritt – all diese Phasen sollten neu und strategisch aufgesetzt werden, um als Unternehmen für alle vorhandenen, aber auch für alle neuen Mitarbeitenden maximal attraktiv zu sein. Es muss ganzheitlich gedacht werden: Alles hat auf alles einen Einfluss, nichts ist zu vernachlässigen.
Wir wollen verdeutlichen, dass auch der produzierende Betrieb sich an die Anforderungen von Gegenwart und Zukunft anpassen kann. Standards und Tools helfen, sich auf die neuen Generationen am Arbeitsmarkt einzustellen.
Wir haben bereits festgestellt, dass eine erfolgreiche Unternehmensstrategie eine passende Personalstrategie enthalten muss. Dabei ist der Employee Lifecycle ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Umsetzung der Personalstrategie. Doch bevor wir in die unterschiedlichen Abschnitte des Mitarbeiterlebenszyklus einsteigen, wollen wir genauer verstehen, wie sich die Arbeit in der produzierenden Industrie in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, welche Einstellungen heute vorliegen und wie wir diesen Veränderungen begegnen können, um langfristigen Erfolg sicherzustellen. Und da Erfolg sich nicht allein an unternehmerischen Kennzahlen ablesen lässt, sondern auch an relevanten Kennzahlen der Personalarbeit (wie zum Beispiel der Fluktuationsquote), ist dieses Buch nicht ausschließlich für Personaler gedacht, sondern auch für Unternehmensleitungen und Führungskräfte, die erkannt haben, dass sich etwas ändern muss. Die Anforderungen haben sich verändert und darauf wollen wir uns gemeinsam einstellen.
2. Die neue intelligente Produktionswelt
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass selbst kleine Veränderungen ein sorgsam gepflegtes System immens beeinflussen können. Wie zum Beispiel ein Frachtschiff, das 2021 im Suezkanal auf Grund gelaufen ist. Die Havarie eines einzigen Schiffes hat globale Lieferketten für Wochen blockiert. Ein Frachtweg, der normalerweise innerhalb von zwei Wochen bestritten werden konnte, hat durch dieses Unglück plötzlich mehr als doppelt so viel Zeit beansprucht. Wichtige Waren und Rohstoffe konnten nicht rechtzeitig geliefert werden und Wertschöpfungsketten wurden für eine lange Zeit negativ beeinflusst. Eine wahre Katastrophe für das Supply-Chain-Management, also das Management aller Lieferketten in einem Unternehmen. Nach Jahren von Lean Management und Just-in-time-Produktion waren die Lagerbestände wichtiger Produktionsrohstoffe schnell leer und der Backlog, also der Auftragsbestand, hat sich rasant aufgestaut. Für die Unternehmen ein großes Problem, denn was nicht produziert wird, kann auch nicht abgerechnet werden.
Lean Management ist eine Unternehmensphilosophie, die darauf abzielt, Prozesse effektiver und effizienter zu gestalten. Das Ziel ist es, Verschwendung zu beseitigen und die Wertschöpfungskette zu optimieren.
Beim Just-in-time-Produktionsansatz (JIT) werden die Materialien mengengenau erst dann geliefert, wenn sie tatsächlich für die Herstellung gebraucht werden.
Das Beispiel verdeutlicht: Ein unplanbares Ereignis wie ein auf Grund gelaufener Frachter hat einen mächtigen (und sehr teuren) Einfluss auf die globale Wertschöpfungskette. Dieses eine Ereignis konnte relativ schnell behoben werden, es deuten sich jedoch schon sehr viel größere Herausforderungen durch anstehende unkontrollierbare Krisen an. So machen sich die Auswirkungen des Klimawandels mehr und mehr in den globalen Lieferketten bemerkbar. Wetterkatastrophen sind nicht vorhersehbar, nehmen zu und beeinflussen in ansteigender Stärke das globale Wirtschaftssystem. Auch die Regulatorik passt sich an. Für klimapolitische Ziele müssen Unternehmen vermehrt regulatorischen Pflichten nachkommen und durch ESG-Berichterstattung ihr Nachhaltigkeitsengagement unter Beweis stellen. Ein neues Spannungsfeld, das Unternehmen und Mitarbeitende vor Herausforderungen stellt. Denn: Mitarbeitende brauchen hierzu neue Kompetenzen und Unternehmen neue Prozesse – alles zusätzlich zum bestehenden Tagesgeschäft.
Um in Krisensituation angemessen agieren und nicht nur reagieren zu können, bedarf es organisationaler Resilienz. Die grundlegende Annahme der organisationalen Resilienz ist die, dass auch im Störungsfall die Funktionalität einer Organisation erhalten bleibt bzw. schnellstmöglich wiederhergestellt werden kann. Dazu müssen in Unternehmen bestimmte Strukturen und Prozesse widerstandsfähig gestaltet werden. Zudem müssen Unternehmen in der Lage sein, ihre Performance im Krisenfall angemessen zu steigern, um unmittelbare oder längerfristige negative Auswirkungen kompensieren zu können. Im Optimalfall werden die Erkenntnisse des Störungsfalls genutzt, um langfristig die Wertschöpfung zu steigern. Dazu müssen Krisen antizipiert und entsprechende Kompetenzen vorgehalten sowie ausgebaut werden.
Organisationale Resilienz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Gestaltungsprinzipien auf organisationaler Ebene. Grundgedanke bei der Betrachtung der organisationalen Resilienz ist, dass es gestaltbare Strukturen und Prozesse auf der Ebene der Arbeitsorganisation gibt, die dazu beitragen, gegenüber einer dynamischen Umwelt resilient zu sein. Der Begriff »resilient« meint dabei, die Funktionalität im Hinblick auf bestimmte Outcomes aufrechtzuerhalten oder nach einer Störung schnellstmöglich wiederherzustellen.4
Schon in den vergangenen Jahrzehnten wurden durch die Digitalisierung der Produktion viele Routineaufgaben automatisiert. Jedoch ist es durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen nun durchaus möglich, Mitarbeitende in ihrem täglichen Tun bei komplexen Analysen zu unterstützen und ganze Prozesse im Unternehmen intelligent, adaptiv und automatisiert zu steuern. Diese neuen technologischen Möglichkeiten zu implementieren und zu steuern, stellt eine Schlüsselkompetenz für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens dar. Damit verbunden steigt der Innovationsdruck, diese neuen Möglichkeiten für sich zu nutzen, um mittel- und langfristig bestehen zu bleiben. Und für die Menschen im Unternehmen bedeutet das, dass sie neue Anforderungen erfüllen und sich dem Wandel anpassen müssen. Um die Potenziale von KI zu nutzen und diese zur Produktivitätssteigerung effektiv einzusetzen, muss sich ein Arbeitgeber anders und neu auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden ausrichten. Für Unternehmen bedeuten diese neuen Technologien, dass sie sicherstellen müssen, die richtigen Kompetenzen aufzubauen, um zukunftsweisende Anwendungsgebiete überhaupt erst erschließen zu können.
Künstliche Intelligenz (KI) imitiert menschliche kognitive Fähigkeiten. Sie erkennt eigenständig Informationen aus Eingabedaten und sortiert diese auf der Basis von programmierten Abläufen oder auch maschinellem Lernen. Durch maschinelle Lernverfahren ist es möglich, große Datenmengen in kurzer Zeit zu analysieren und zu verarbeiten.5
Wenn man die Vielzahl der aktuellen Einflussfaktoren betrachtet, wird deutlich, dass sich die industrielle Fertigung in einem hochkomplexen Spannungsfeld befindet. Nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass die Komplexität des Umfeldes, in dem sich Unternehmen bewegen, zunimmt. Kleine und mittelständische Unternehmen in der industriellen Fertigung stehen vor der herausfordernden Aufgabe, vielen komplexen Problemen gleichermaßen und gleichzeitig gerecht zu werden. Sie müssen dynamisch auf diverse Umwelteinflüsse reagieren können. Schaut man sich die Anzahl der zu bewältigenden Krisen an, wird deutlich, dass wir nicht in den alten Normalzustand zurückkehren werden. Arbeitgeber müssen sich stets agil und flexibel anpassen, so kommen auch die bisher in Personalabteilungen genutzten Instrumente an ihre Grenzen. Die zunehmende Volatilität der Märkte, geopolitische Krisen und nicht zuletzt der Fachkräftemangel führen dazu, dass Unternehmen einerseits auf der Suche nach Stabilität sind und auf der anderen Seite unter einem steigenden Innovationsdruck stehen.
Die Vorhersagen darüber, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird, sind noch sehr schwammig. Wir können nur erahnen, wie der produzierende Betrieb der Zukunft aussehen wird. Unbestritten ist, dass unsere Wirtschaft im Wandel begriffen ist und sich die Betriebsabläufe in der industriellen Fertigung grundlegend verändern werden. Es werden sich neue, heute noch unbekannte Formen von Wertschöpfungsketten entwickeln. Auch für die Arbeitsplätze der Menschen und die Gestaltung ihrer Arbeit werden sich grundlegende Veränderungen ergeben.
Doch wie können KMUs es schaffen, die richtigen Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, um ihre Organisation resilient, dynamisch und krisentauglich auszurichten? Bevor man sich dem »Wie« widmet, ist eine Analyse des Status quo relevant. Wo stehen wir als Unternehmen eigentlich heute? Dabei helfen einfache Reflexionsfragen bei der Standortbestimmung im eigenen Betrieb.
Tool 1
Reflexionsfragen zur Standortbestimmung des eigenen Betriebs
■
Wie digital sind wir am heutigen Tage aufgestellt? Wo haben wir Nachholbedarf?
■
Welche manuellen Prozesse können kurzfristig von KI übernommen werden (und welche Arbeitsplätze fallen dann komplett weg)?
■
Welche Arbeitsplätze sind von der zunehmenden Automatisierung betroffen?
■
Welchen Einfluss haben Automatisierung und KI bei uns im Betrieb auf den Produktionsprozess?
■
Gibt es Positionen, die in der Vergangenheit bei einer Krise besonders wichtig waren, oder welche, die potenziell wichtig werden könnten?
■
Ist schon jetzt erkennbar, dass sich die Kompetenzen, die unsere Mitarbeitenden benötigen, verändern werden?
■
Welche Skills haben wir nicht in unserem Unternehmen, die aber wichtig werden?
Bei allem nötigen organisationalen Wandel kommt hier der Personalarbeit eine Schlüsselrolle zu. Bevor wir über konkrete Maßnahmen sprechen, wollen wir noch einen kurzen Blick auf den Status quo der Gestaltung der Arbeit in der industriellen Fertigung werfen und darauf, welche Rolle das viel besprochene New Work spielt.
2.1 Industrielle Fertigung: Arbeitsgestaltung im Wandel
Die Wertschöpfung ist in der industriellen Fertigung einer der wichtigsten Parameter, der historisch von einem Top-down-Managementansatz geprägt ist. Wer in der Produktion arbeitet, bewegt sich in einem Umfeld, das alles daransetzt, so risikominimierend und gleichzeitig so effizient wie möglich zu agieren. Im gesamten Wertschöpfungsprozess ist häufig wenig Spielraum für eigenständige und kreative Lösungen. Für die meisten der aufkommenden Prozesse oder auch Herausforderungen gibt es ein »Standardvorgehen«, einen Ablauf mit klar definierten Zuständigkeiten, Regeln und Best-Practice-Beispielen. Jeder Schritt in einem Prozess ist klar definiert. Sämtliche Eventualitäten, die während eines Produktionsprozesses auftauchen könnten, werden vorab in einer Handlungsanweisung beschrieben. Wenn sich alle Organisationsmitglieder in einem gewissen, für alle klar abgesteckten Rahmen bewegen, ist das Risiko für Verletzungen möglichst gering. Sicherheit und somit die Gesundheit der Mitarbeitenden hat stets oberste Priorität in einem produzierenden Betrieb. Gleichzeitig ist die Produktivität sichergestellt, denn Zeit stellt im Produktionsalltag einen entscheidenden Faktor für das Geschäftsergebnis dar.
Nicht selten führt diese Art von Management dazu, dass in einigen Bereichen die Dokumentation der Arbeit und die Berichterstattung über Prozessfortschritte einen großen Teil der Arbeitsaufgabe ausmachen. Wöchentliche, manchmal sogar tägliche Berichte in Form von tabellarischen Zusammenfassungen oder im Rahmen von Meetings bestimmen den Arbeitsalltag. Ob dies die Produktivität und Effektivität entlang der Wertschöpfungskette positiv beeinflusst, lässt sich zumindest in einigen Bereichen des Unternehmens infrage stellen. Doch wie sind wir hier gelandet? Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit.
Vor gut 100 Jahren entwickelte Frederick Winslow Taylor einen auf Wertschöpfung optimierten Managementansatz, bei dem durch festgelegte und effiziente Arbeitsabläufe der Ressourceneinsatz minimiert werden sollte. Damit sein Modell funktioniert, werden monetäre Anreize zum Beispiel mit einem festgelegten Arbeitspensum verknüpft. Erfüllen Mitarbeitende dieses fest definierte Ziel, werden sie finanziell belohnt. Schaffen sie es nicht, wird ihnen für den Tag Lohn abgezogen. Der sogenannte Taylorismus legte den Grundstein für festgelegte Arbeitsprozesse in der industriellen Fertigung. Noch heute, 100 Jahre später, bauen viele Produktions- und Arbeitsmodelle auf der Grundidee des Taylorismus auf. Durch hohe Spezialisierung von Mitarbeitenden lassen sich (Teil-)Aufgaben effizienter ausführen, sodass eine präzise Produktionsplanung ermöglicht wird. Mitarbeitende können sich schnell in neue (Teil-)Aufgaben des gesamten Prozesses einarbeiten. Doch ist mittlerweile auch deutlich, dass die Zerstückelung der Arbeit nicht nur Vorteile mit sich bringt. Die Arbeit ist schnell und repetitiv. Sie erfordert wenig bis keine Denkvorgänge, was zu Monotonie und einer einseitigen Belastung von Mitarbeitenden führt. Die Beschäftigten werden als Prozessmerkmale definiert, ihre Bedürfnisse als Menschen sind irrelevant.
Daher verwundert es kaum, dass sich eine Gegenbewegung zum Taylorismus entwickelte, die das Ziel hatte, den Menschen wieder in den Mittelpunkt der Wertschöpfungskette zu stellen. Die sogenannte Humanisierung der Arbeit hat das konkrete Ziel, durch eine Verbesserung der Arbeitsinhalte und der Arbeitsbedingungen die Arbeitswelt möglichst menschengerecht zu gestalten. Dazu entwickelte die Bundesregierung Mitte der 1970er-Jahre ein Forschungsprogramm, mit dem mehr als 1600 Projekte unterstützt wurden.
Diese Projekte hatten das Ziel, monotone Arbeit zu reduzieren und physische Gefahren bei der Tätigkeit in der Produktion zu verringern. Durch die Humanisierung der Arbeit sollen Vorteile und Chancen für die Beschäftigten entstehen. So haben zum Beispiel eine höhere Zeitsouveränität, Mitsprache bei der Wahl des Arbeitsortes oder auch stärkere Partizipationsmöglichkeiten in der Ausgestaltung von Arbeitsinhalten einen Einfluss auf die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Ergebnisse des Programms sind beispielsweise wichtige Erkenntnisse zu teilautonomen Arbeitsgruppen (Teams) in der Produktion oder über Grundlagen für die Kompetenzentwicklung bei der Arbeit sowie zur »qualifizierenden Arbeitsgestaltung«. Vor dem heutigen Hintergrund der Automatisierung und Digitalisierung wird der Wunsch nach einer humaneren Arbeitswelt größer und die Erkenntnisse des Programms von damals sind erstaunlich aktuell. So wurde schon damals festgestellt, dass beim Einsatz von Technologien Selbstbestimmung und die betriebliche Demokratie eine wichtige Rolle spielen.
Teilautonome Arbeitsgruppen sind kleine funktionale, sich selbst regulierende Teams innerhalb der Organisationsstruktur. Sie arbeiten konstant zusammen und erstellen eigenverantwortlich ein komplettes (Teil-)Produkt oder eine Dienstleistung. Sie planen, steuern und kontrollieren die übertragenen Aufgaben zumindest teilweise selbst.
Wie unterschiedlich die Ansätze des Taylorismus und der Humanisierung sind, wird am folgenden Beispiel deutlich: Stellen wir uns vor, die Geschäftsleitung entscheidet, dass zukünftig im Produktionsprozess eine neue Technologie genutzt werden soll. Dazu investiert sie in eine Software, die mithilfe von künstlicher Intelligenz den Produktionsprozess grundlegend verändert.





























